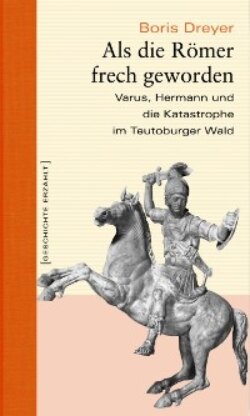Читать книгу Als die Römer frech geworden - Boris Dreyer - Страница 9
Rhein oder Elbe – Defensive oder Expansion
ОглавлениеAls die Römer frech geworden
Zogen sie nach Deutschlands Norden,
Vorne beim Trompetenschall
Ritt der Generalfeldmarschall,
Herr Quinctilus Varus.1
Die augusteische Germanienpolitik lässt sich unter drei Fragestellungen fassen. Zunächst geht es um die zeitlichen und inhaltlichen Abhängigkeiten der römischen Offensiven rechts des Rheins und damit auch um die Ziele. Sodann stellt sich die Frage, inwieweit die Römer nach der Unterwerfung der germanischen Stämme ihre Zielsetzungen als erfüllt betrachten konnten und welches Beherrschungskonzept sich daran anschloss. Drittens ist zu erörtern, wie es zur Clades Variana, zur Varuskatastrophe, kam und welche Konsequenzen sich aus der Niederlage des Varus und in der Folge aus der Abberufung des Germanicus ergaben.
Zuerst also soll eine Einordnung der Germanienpolitik in den Gesamtrahmen der augusteischen Außenpolitik und der römischen Rheinpolitik seit Caesar erfolgen. Sie ist die notwendige Voraussetzung zum Verständnis der römischen Offensiven im rechtsrheinischen Raum.
Der neue Monarch und seine Machtgrundlage
Die Übernahme der Herrschaft im Jahr 27 v. Chr., nach dem Sieg über den letzten innenpolitischen Konkurrenten, stellte sich als Machtdelegation auf Zeit vom Senat bzw. der Volksversammlung auf Octavian Augustus dar. Der Princeps, der nur durch sein persönliches Ansehen und seine Bewährung die Standesgenossen überragte, regierte innenpolitisch zunächst mithilfe der wiederholten Bekleidung des höchsten Amtes, des Konsulates, später durch die kunstvolle Kombination von Kompetenzen, die den traditionellen republikanischen Ämtern entliehen waren. Ganz wesentlich für die Dauerhaftigkeit seiner monarchischen Position im Staat sollte aber der Erfolg bei der Befriedung Italiens und besonders der Provinzen nach Jahrzehnten des Bürgerkrieges werden. Dafür erhielt er auf Zeit eine statthalterliche Befehlsgewalt (imperium proconsulare) über alle noch unbefriedeten Provinzen. Zunächst waren es fünf Provinzen, am Ende seiner Regierungszeit 19 Provinzen, dazu zwei germanische Militärdistrikte, auf die er so Zugriff erhielt. Später, ab dem Jahr 23 v. Chr., wurde diese Befehlsgewalt noch ausgedehnt. Sie war fortan übergeordnet (imperium proconsulare maius): Auch die senatorischen Statthalter der (schließlich kontinuierlich zehn) „öffentlichen“ Provinzen, die vom Senat verwaltet wurden, waren dem Princeps untergeordnet.
Während sich formal der Vorgang des Jahres 27 v. Chr. als eine Machtaufteilung zwischen dem Senat und dem Princeps auf Zeit ausgab, wirkte sich de facto die Machtdelegierung in der beschriebenen Form allein zugunsten des Augustus aus, denn in den unbefriedeten Provinzen standen bis auf wenige Ausnahmen alle Legionen.
Der Vorteil der jetzt legalisierten Macht des Augustus war auch gleichzeitig die entscheidende Schwäche: Rechtlich konnte das Privileg der außerordentlichen Machtausübung nur so lange bestehen, wie die Aufgabe, die Befriedung im Innern und die Absicherung nach außen, gewährleistet war. Mit jeder kleinen Störung in diesem „deal“, bei jeder kleinen Niederlage und bei jedem kleinen Missgeschick wackelte die Macht des Princeps insgesamt.
Princeps oder der Erste unter Gleichen
Inhaber des höchsten Ranges (an Ansehen), Ehrentitel in der römischen Republik unter den Senatoren. Um seine Regierungsform aus republikanischen Traditionen herzuleiten und sich von Caesars Diktatur abzusetzen, wählte Augustus diese Bezeichnung für seine überlegene Machtstellung, bestehend aus einem Konglomerat von einzelnen Amtskompetenzen der Republik. Dieser „Titel“ wird von den Nachfolgern übernommen.
Die neue Armee
Basis der Sicherung der Grenzen und der Befriedung der unbefriedeten Provinzen war eine schlagkräftige Armee. Dazu waren die Bürgerkriegsarmeen des 1. vorchristlichen Jahrhunderts denkbar ungeeignet: Nichts ist gefährlicher und unberechenbarer als eine Armee, die politisch denkt. Die ganze Periode der Bürgerkriegszeit hindurch, und besonders nach Caesars Tod, hatten sich die aufgeblähten Bürgerkriegsheere (bei Philippi im Jahr 42 v. Chr. kämpften insgesamt über 200 000 Mann!) auf allen Seiten mehrfach in das politische Geschehen eingeschaltet. Dabei haben sie den Lauf der Ereignisse in der Auseinandersetzung zwischen den großen Potentaten Antonius und Octavian (Augustus) erheblich mitbestimmt. So nützlich ihre Einmischung für den Adoptivsohn Caesars, Octavian, am Anfang seines kometenhaften Aufstiegs auch war: Im Besitz der konkurrenzlosen Macht nach dem Tod des Antonius, konnte der siegreiche Augustus solche unzuverlässigen Heere nicht weiter dulden und gebrauchen – und entließ sie.
Das war kein leichtes Unterfangen. Seit Marius’ Heeresreformen um 100 v. Chr. gehörte es kontinuierlich zum Kalkül mächtiger und ehrgeiziger römischer Militärpotentaten (potentes), dass sie „ihre“ Heere, die ihnen über Jahre durch Loyalität ihre Siege und damit ihren persönlichen Aufstieg garantierten, belohnten – mit Beute aus den Kriegszügen und mit Land nach der Dienstzeit. Damit schufen sich diese Potentaten auch auf Dauer eine treue Klientel: Soldaten in den Legionen waren immer Bürger; Bürger hatten immer Wahlrecht, das sie – wenn sie nahe an Rom siedelten – auch wahrnehmen konnten, aus Dankbarkeit für den fürsorglichen Anführer natürlich im Sinne des ehemaligen Feldherrn.
Der Zenturio in der römischen Armee
In der Zeit der Manipulartaktik hatte der rangältere Zenturio (centurio) das taktische Kommando in einem aus zwei Zenturien bestehenden Manipel. Die Ränge der 60 Zenturionen einer Legion bemaßen sich nach der Aufstellung in der Schlachtordnung. Der ranghöchste Zenturio einer Legion (10 Cohorten, 30 Manipel, ca. 5000 Mann) war der Primus pilus, der an den Feldherrnbesprechungen zusammen mit den Offizieren (Militärtribunen) teilnahm. Als Bindeglied zwischen Offizieren und Mannschaften hatten sie die Disziplinargewalt, weswegen sie einen Rebstock trugen (virga). Weitere Kennzeichen waren ein quergestellter Helmbusch, besondere Beinschienen und ein Goldring.
Die Ansiedlung von Veteranen in Italien war immer prekär und, besonders wenn nahe an Rom, mit Unruhen verbunden, denn normalerweise siedelten auf diesen attraktiven Parzellen Familien seit Generationen, die jetzt für die Neuansiedlung enteignet und deren Ländereien konfisziert werden mussten.
Augustus hatte darüber hinaus als Sieger nicht nur sein eigenes, inzwischen etwa 230 000 Mann starkes Heer zu betreuen. Die schnelle Kapitulation des unbesiegten, wenn auch führerlosen Landheeres des Antonius nach der Seeschlacht bei Actium war auch nur dadurch möglich, dass Octavian die Versorgung der Soldaten mit Land zusicherte. Erst ab 7 v. Chr. wurde – im Sinne der Veteranen, die nicht mit Land in einer fernen Provinz abgespeist werden wollten – zunehmend eine Entschädigung mit Geld am Ende der Dienstzeit anvisiert.
Octavian entließ zwischen 31 und 19 v. Chr. 120 000 Soldaten, soweit sie auf seiner Seite gestanden hatten. Insgesamt wurde das Reichsheer auf 25 Legionen zusammengekürzt, die an den gefährdeten Grenzen und in den unbefriedeten Provinzen konzentriert wurden, anfänglich noch in (mobilen) Holzlagern, später in Steinlagern.
Das Ergebnis war ein stehendes Kernheer, das gleichzeitig mit den Entlassungen systematisch neu aufgebaut wurde und loyaler sowie besser ausgebildet war. Die Soldaten wurden nach der Bedeutung der Truppen und nach Hierarchie abgestuft bezahlt. Im Jahr erhielt ein Legionär 250 Denare, ein Prätorianer 750 Denare, ein Auxiliar (etwa in Ägypten) 186 Denare und ein Zenturio 3750 Denare. Ein Denar war im 1. Jahrhundert ein guter Tagesverdienst eines Tagelöhners, der die Lebenshaltungskosten sicherstellte.
Die Effektivität des römischen Heeres war darüber hinaus durch einen ebenso kompromisslosen Bestrafungskatalog garantiert wie durch ein abgestuftes Belohnungssystem und differenzierte Aufstiegsmöglichkeiten. So blieben die Erfolgsrezepte des römischen Aufstiegs zur Weltmacht, die Disziplin der römischen Armee und die nahezu unbeschränkten Ressourcen an Menschen auch in der neuen Form unter der Monarchie zukunftsfähig, und noch mehr: Unter den ersten Principes waren diese Legionen noch äußerst mobile Einheiten, wie zur Zeit der Republik; darüber hinaus war nunmehr das raumgreifende, strategische Zusammenwirken unterschiedlichster Truppenteile von weit auseinander liegenden Ausgangspunkten aus möglich. Erst zum Ende des 1. Jahrhunderts n.Chr. hin wurde dieser Teil der römischen Armee, die Kernarmee, zu einem stehenden Heer, das in der Schlacht als eiserne Reserve eingesetzt wurde und so immer mehr von der ursprünglichen offensiven mobilen Kraft verlor.
Wichtiger wurden schon unter Augustus die Stammes- und Hilfstruppen-Einheiten (Auxilien), die vor Ort angefordert und zunächst auch dort eingesetzt wurden. Man kann unterscheiden zwischen den Stammesaufgeboten unter einheimischen Führern, die bei Bedarf ausgehoben wurden und keine feste Organisation hatten, den ständigen Stammestruppen unter einheimischer Führung (im Rang eines Präfekten), die fest in die römische Armee integriert waren, und den „regulären“ Auxilien. Diese standen in der Regel unter dem Befehl römischer Offiziere. Ihre Einheiten wurden laufend ergänzt, sodass sie ihren „nationalen“ Charakter zunehmend verloren. Nach 25 Jahren Dienstzeit bestand die Aussicht auf das römische Bürgerrecht für diejenigen, die in diesen Einheiten gedient hatten.
Die Auxilien
Ursprünglich volksfremde Hilfstruppen, nationale Spezialwaffengattungen, die die italischen Einheiten an Qualität übertrafen und dann ersetzten. Augustus organisierte die Auxilien neu und machte sie zu festen Bestandteilen des stehenden Heeres, die auch einheitlich bewaffnet und organisiert waren. Mit den Legionen (Kern des stehenden Heeres) und den Alen (Reitereinheiten) bildeten die Auxilien die Provinzbesatzung.
Durch die – teilweise auch unter Zwang durchgeführte – Einziehung der wehrfähigen Jugend sollten die Stämme, die sich Rom unterworfen hatten, zu dauerhafter Treue gezwungen werden. Das einigende Band innerhalb dieser Truppenteile war die lateinische Kommandosprache, sodass von hier auch ein beabsichtigter Impuls für die Romanisierung der eroberten Gebiete, die mit regulären Truppen und aus der Region stammenden Hilfseinheiten besetzt waren, ausging.
Ortspezifische Bewaffnung und Ortskenntnis der Hilfstruppen sollten die Schlagkraft des römischen Heeres erhöhen. Dass diese nachvollziehbare Absicht auch ins Negative ausschlagen konnte, zeigt die Varusniederlage. Die Stämme übergreifende Organisation der Erhebung konnte sich nämlich gerade auf die Organisationsstruktur der germanischen Hilfstruppen stützen, deren Mitglieder sich aus allen am Aufstand beteiligten Stämmen rekrutierten. Erst nach den ersten erfolgreichen Angriffen auf die Varusarmee und besonders als am Untergang der Römer kein Zweifel mehr bestehen konnte, wuchs die Zahl der angreifenden Germanen, sodass man von einem „Volksaufstand“ aller am Bündnis des Arminius beteiligten Stämme sprechen konnte.2 Nach dieser leidvollen Erfahrung des Jahres 9 n. Chr. trachtete man fortan, die Auxilien nicht in der Nähe ihres Ursprungslandes einzusetzen, sofern sie nicht ohnehin aufgrund der Ergänzungen ihren „nationalen“ Charakter schon verloren hatten.
Augusteische Außenpolitik und der „Auftrag“ der Grenzsicherung und Befriedung
Die augusteische Außenpolitik war im Vergleich zur aggressiven Politik römischer Potentaten der späten Republik ausgesprochen defensiv und folgte berechenbar „rationalen“ Kriterien. Das heißt nicht, dass es nicht auch – und sogar weiträumige – Offensiven gab. Solche Offensiven konnten sich auch aus rein äußerlichen Sachzwängen ergeben, wie aus Gründen der Beschäftigung und des Trainings, der Ablenkung oder der Belohnung der Soldaten. Das wird zumindest für den illyrischen Krieg der 30er-Jahre v. Chr. als Begründung angegeben.
Die Oikumene
Seit dem Aufkommen der Lehre von einer Weltkugel hat sich in der Antike die Vorstellung durchgesetzt, dass es symmetrisch um den Äquator gruppiert mehrere Weltinseln (oikumenai) gebe. Diese Weltinseln trennten den bewohnten von dem unbewohnten Bereich ab. Das Gebiet des Mittelmeers und die angrenzenden Bereiche bis zu den Gestaden des Ozeans wurden als eine Oikumene betrachtet – Britannien gehörte also nicht dazu –, welche die Römer unter dem Begriff orbis terrarum (Erdkreis) politisch mit ihrem Herrschaftsgebiet gleichsetzten. Für den Anspruch, die Oikumene zu beherrschen, gab es griechische Vorbilder (insbesondere Alexander den Großen).
Zumeist dienten Offensiven aber dem übergeordneten Ziel der Befriedung oder der Grenzsicherung. Sie waren in dieser Hinsicht (!) auch begrenzt. Auszunehmen sind die Ambitionen ehrgeiziger Feldherrn aus der Familie des amtierenden Princeps, die teilweise wie die Potentaten der ausgehenden Republik mit ganz persönlichen Zielsetzungen auftraten: Dazu zählten insbesondere Drusus und sein Sohn Germanicus, deren mitunter pathetisch zur Schau gestelltes politisches Selbstverständnis den Direktiven ihrer Principes jedoch letztlich eindeutig untergeordnet blieb.
Die römische Weltherrschaft (bezogen auf die antike Mittelmeeroikumene) führte nach römischem Verständnis zu einer Friedensordnung (Pax Augusta), die aus Siegen gewonnen war (parta victoriis pax). Ein solches Verständnis duldete zumindest keinen Gebietsverlust. Solche Verluste bedrohten das Renommee und damit mittelbar auch die Macht des Monarchen selbst und mussten daher umständlich interpretiert werden. Im Ganzen aber waren die Principes, besonders die starken fähigen Herrscher, bei ihren Offensiven kontrolliert, nicht uferlos, verfolgten feste Ziele, indem sie diese stets dem innenpolitischen Auftrag der Befriedung und Grenzsicherung unterordneten.
Oft sind die außenpolitischen Aktivitäten auf aktuelle innenpolitische Konstellationen zu beziehen, mitunter sogar unmittelbar mit diesen verknüpft: So wurde der als Krieg gegen einen äußeren Feind stilisierte Kampf gegen Antonius und Kleopatra nach der Rückkehr des siegreichen Octavian im Jahr 29 v. Chr. gefeiert, wobei Octavian immer näher an die göttliche Sphäre ge- und damit den möglichen innenpolitischen Konkurrenten entrückt wurde.
Im Jahr 25 v. Chr wurde der Janustempel symbolisch geschlossen, um die vermeintlich glückliche, wenn tatsächlich auch nicht erreichte Befriedung Spaniens zu feiern und damit innenpolitisch zu instrumentalisieren. Im Jahr 20 v. Chr. wurde die Einigung mit dem Partherreich über die Rückgabe der Feldzeichen, die 53 v. Chr. bei Carrhae schmählich verloren worden waren, und der noch lebenden Gefangenen zu Hause propagandistisch als Triumph gefeiert.
Nach einer Phase der innenpolitischen Konsolidierung, die mit einer Neustrukturierung der Kompetenzen des Princeps verbunden war, und im Zusammenhang der (nun endlich geglückten) Befriedung Spaniens wurde im Jahr 17 v. Chr. ein neues saeculum mit umfangreichen Festveranstaltungen eingeleitet. Damit reaktivierte Augustus eine alte republikanische Sitte, die auch die Kaiser nach ihm imitierten, wenn sie die ordnende Qualität und Stabilität des eigenen Regiments dokumentieren wollten, das gleichsam den Anfang eines goldenen Zeitalters der Prosperität markieren sollte. Mit dem neuen saeculum schien – ein kennzeichnendes Beispiel des engen Zusammenhangs von Innenpolitik und Außenpolitik – das mächtige Reich unter der fähigen Führung von Augustus nun auch in der Lage zu sein, durch eine Offensive in Germanien die unruhigen Nordgrenzen zu befrieden.
Ein neues Zeitalter
Nach ursprünglich etruskischer Vorstellung ist das saeculum ein von einem göttlichen Zeichen angezeigter Zeitabschnitt, der gewöhnlich 100 Jahre dauerte. Die neuen saecula wurden mit Festlichkeiten begangen, um das neue Zeitalter zu begründen. Augustus und Claudius haben 17 v. Chr. und 47 n.Chr. nach Fälschung der Festkalender (Fasti) neue saecula festlich begangen, um die mit diesen Festlichkeiten verbundenen sakralen Weihen für ihre Herrschaft innenpolitisch umzumünzen.
Als im Jahr 8 v. Chr. die Unterwerfung der nordgermanischen Stämme erreicht war, wurde die geheiligte Stadtgrenze Roms, das pomerium, erweitert. Auch das war ein alter republikanischer Ritus, den Augustus demonstrativ und symbolisch konform mit den alten legitimierenden Traditionen wieder aufleben ließ. In der Antike, das gilt besonders für Rom, wirkten alte Riten und Institutionen aufgrund der Ehrfurcht immer legitimierend für den, der in ihnen auftrat: Sie wurden daher auch nie abgeschafft, sie kamen allenfalls aus der Übung, d.h., sie trockneten aus. Seit mythischer Vorzeit erweiterte man das pomerium immer dann, wenn die Römer einen fulminanten Sieg errungen hatten. Auch darin setzte Augustus für die nachfolgenden Kaiser Maßstäbe, die außenpolitischen Erfolg in innenpolitische Stabilität ummünzen wollten.
Die „Grenzen“ des Reiches
Die Berichte über die Geschehnisse an den Grenzen des Reiches sind nicht gleich dicht. Doch haben unsere Quellenautoren eigene Schwerpunkte gesetzt und damit eine Filterung vorgenommen, je nachdem, wie wichtig die Region und gefährlich die Bedrohung war: In Nordafrika sind einzelne Expeditionen von Ägypten aus nach Süden oder nach Arabien sowie einige administrative Umstrukturierungen belegt, in Kleinasien hielt Augustus an dem System der Klientelkönigtümer als cordon sanitaire zwischen den römischen Provinzen „Asia“, Kilikien sowie Syrien auf der einen Seite und dem Partherreich auf der anderen Seite prinzipiell fest. Das System dieser vorgelagerten Königtümer, die abhängig von Rom waren, war bereits von Pompeius dem Großen in den 60er-Jahren des 1. vorchristlichen Jahrhunderts angelegt worden. Die Klientelkönige blieben in ihrer Innenpolitik weitgehend autonom, mussten sich aber den außenpolitischen Richtlinien und Bedürfnissen Roms unterordnen, d. h. Tribute zahlen und Truppen stellen. Nach Maßgabe der Sicherung der Verwaltung und zur Belohnung der Treue wurden fortan Gebiete diesen Klientelkönigtümern zugeschlagen oder Teile davon ins benachbarte Provinzgebiet einbezogen. Anlass zu solchen Gebietskorrekturen konnte aber auch einfach ein Herrschaftswechsel in diesen Königtümern sein.
Jenseits dieser Klientelkönigtümer, die fest an das Römische Reich angeschlossen waren und keinerlei eigenständige Außenpolitik betreiben konnten, lagen mitunter Klientelkönigtümer „im weiteren Sinne“ wie Armenien, deren Bindung an das Reich lockerer war als die der Klientelkönige innerhalb der „Reichsgrenzen“. Im Fall von Armenien war die Kontrolle immer zwischen Rom und den Parthern umstritten; manchmal war es der Kandidat der Parther, der dort als König eingesetzt wurde, meist aber – unter Augustus und Tiberius wenigstens – der römische Kandidat. Aber auch mit dem Erzfeind, den Parthern, strebte man eine friedliche Einigung an. Sogar wenn es zu Spannungen kam, wurde ein Krieg tunlichst vermieden.
An der Nordgrenze und in einigen westlichen Provinzen sah dies anders aus: In Spanien stand Augustus unter dem besonderen Druck, die seit 150 Jahren in den verschiedenen Landesteilen immer wieder aufflammenden Unruhen besonders im schwer zugänglichen bergigen Hinterland endlich zu befrieden. Dies gelang erst im Jahr 19 v.Chr. – gerade rechtzeitig, um die anstehenden Pläne an der Nordgrenze, am Rhein, umzusetzen. In Illyrien war Octavian schon in den 30er-Jahren v.Chr. offensiv tätig, hier allerdings nicht nur mit dem Ziel, einen schmalen Küstenstreifen und das Gebiet um Siscia zu erobern, sondern auch, um die Truppen für die Endauseinandersetzung mit Antonius zu trainieren und den eigenen militärischen Ruhm zu mehren.
Hier hatte er ein großes Defizit: Immer wenn es hart auf hart kam, hatte Octavian bislang gepatzt. Bei der Schlacht von Philippi 42 v. Chr. gegen die Mörder seines Adoptivvaters gewann der Noch-Bundesgenosse Antonius die Schlacht, während Octavian „im rückwärtigen Raum“ unpässlich war. Bei der Seeschlacht von Naulochos gegen den Sohn des Pompeius Magnus, Sextus Pompeius, im Jahr 36 v. Chr. gewann der treue Agrippa für Octavian die Schlacht, während der im Schiffsbauch seekrank darniederlag. Wie sollte man erwarten können, dass Octavian in der Lage sein würde, im Reichsinnern für Ordnung zu sorgen und nach außen die Feinde abzuwehren? Auch deshalb und um diesem Eindruck entgegenzuwirken, hatte der Adoptivsohn des vergöttlichten Caesar sich 39 v. Chr. den Vornamen „Imperator“ zugelegt, der später in die Kaisertitulatur einging.
Die Germanen, der Rhein und Caesar
Der präventiven Sicherung der Nordgrenze diente die Eroberung des Alpenraums im Jahr 15 v. Chr. durch Tiberius und Drusus, die bereits 16 v. Chr. durch Silius Nerva vorbereitet und begonnen worden war. Die römischen Aktionen rechts des Rheins und nördlich der Donau folgten einer eigenen Logik. Das heißt nicht, dass die Offensiven dort völlig unabhängig von allen anderen Feldern der Außenpolitik und den Bedingungen in Rom abliefen.
Die Siedlungsgebiete der einzelnen Germanenstämme änderten sich stetig, nicht zuletzt beeinflusst durch die Wanderungen der Sueben-Stämmegruppe zur Zeit Caesars und vor allem auch durch die Eroberungen der augusteischen Zeit. Erst nach dem Ende dieser Offensiven und der Festschreibung des Rheins als Grenze (mit einem vorgelagerten, vom Limes zwischen Koblenz und Regensburg eingefassten Gebiet im heutigen Südwestdeutschland) kamen die Stämme zur Ruhe. Diese Situation fängt der Historiker Tacitus mit seinem Werk Germania, das 98 n.Chr. erschien, ein. Dabei ging es dem Historiker nicht nur um die Beschreibung der Siedlungsorte und des freiheitsliebenden, einfachen und ungebundenen Lebens dieser Barbaren, die allein der Zwist untereinander von einem unbezwingbaren Zug gegen Rom abhielte. Es ging Tacitus auch um einen Sittenspiegel, den er, nach Jahren des Sittenverfalls und der Despotie unter Domitian (81–96 n. Chr), den Zeitgenossen, seinen Landsleuten und Standesgenossen, vorhielt. Geradezu beschwörend rief er daher aus:3
So hoffe ich doch wenigstens auf die ewige Beständigkeit des Hasses dieser Stämme untereinander, wenn sie uns schon nicht lieb gewinnen wollen, weil bei dem lastenden Verhängnis für das Reich das Schicksal nichts Größeres gewähren kann als den Zwietracht der Feinde.
Aber auch Tacitus hatte bereits Vorgänger: Neben dem Germanenwerk von Antidius Bassus, den Exkursen des Historikers Livius und dem Werk Bella Germaniae des Germanienkenners Plinius d. Ä. sind in diesem Zusammenhang vor allem die Exkurse über die Sitten der Germanen aus der Hand Caesars anzuführen.
Gaius Julius Caesar war der Erste, der zwischen Kelten und (rechtsrheinischen) Germanen unterschied. Während Poseidonios wohl den Germanenbegriff schon vorher eingeführt hat, damit aber einen Volksstamm im Nordosten Galliens meinte, beschreibt Caesar auf volkstümliche Art, d. h. mit der Absicht, auf eine breite Öffentlichkeit zu wirken, in seiner Darstellung über den Gallischen Krieg (de bello Gallico, 58–52 v. Chr.) unter diesem Oberbegriff die Sitten aller Stämme rechts des Rheins.
Die Beschreibung der Unterschiede zur gallischen Kultur erfolgt aus der Sicht der Kelten. Die Germanen siedelten zwar mehrheitlich rechts des Rheins, sie hatten aber bereits vor Caesar begonnen, die keltischen Stämme besonders am Oberrhein (hier die Sueben-Stämmegruppe unter Ariovist) und am Niederrhein zu verdrängen. Gerade dort, bei den Belgern, hatten sich Germanen und Kelten schon vermischt.
Caesars Exkurse über die Germanen stammen aus der Zeit der Gesamtredaktion der Schrift de bello Gallico aus dem Jahr 52/51 v. Chr. Inhaltlich sind diese Berichte allerdings bereits in den obligatorischen jährlichen Rechtfertigungsschriften Caesars über seine Tätigkeiten als Prokonsul an den Senat seit 58 zugrunde gelegt. Schon die Verhandlungen Caesars mit dem Suebenkönig Ariovist im Jahr 58 v. Chr. hatten gezeigt, dass die Germanen eine andere Sprache sprachen als die Kelten.
Nach den caesarischen Exkursen unterschieden sich die Germanen darüber hinaus vor allem durch das Fehlen einer sesshaften Struktur (oppida), an der Herrschaft greifen konnte, und einer Stämme übergreifenden Organisation – generell durch ein Defizit an Infrastruktur – von den Kelten. Caesars Ziel war es nachzuweisen, dass der Rhein als Völkerscheide ein sinnvolles Ziel und Ende der Eroberungen in Gallien darstellte.
Gleichwohl werden heute in der Regel die zwei Rheinübertritte der Jahre 55 und 53 v. Chr. als Versuche Caesars interpretiert, auch ins rechtsrheinische Gebiet auszugreifen. Caesar selbst aber betont, dass diese Expedition mit dem Bau und der Sicherung einer Rheinbrücke dem Zweck der Abschreckung diente, um die Unterstützung für die aufständischen Kelten aus dem germanischen Gebiet auszutrocknen. Heute wird Caesar mitunter vorgeworfen, dass er mit dieser Darstellung nur einer missglückten Militäroffensive nachträglich einen Sinn zu geben versuchte.4
Es sind jedoch auch die zwei Ausgriffe nach Britannien in den Jahren 54 und 53 dieser Zielsetzung der Abschreckung hauptsächlich untergeordnet. Weiter hatten die rechtsrheinischen Feldzüge des Tiberius kurz nach der Varusniederlage (9 n.Chr.), die unumstritten allein der Sicherung der Rheingrenze dienten, in Zielsetzung und Ausführung denselben Charakter wie diejenigen Caesars rechts des Rheins.
Rheinpolitik als Grenzpolitik
Auch in der Zeit nach 52 v. Chr. ist man bis zum Jahr 16 v. Chr. nicht von dieser Politik abgewichen und hat offenbar die Argumente Caesars für stichhaltig gehalten. In dieses Bild fügen sich auch die organisatorischen Maßnahmen zwischen 44 v. Chr. und den Drususoffensiven.
Es sind nur zwei weitere rechtsrheinische Feldzüge überliefert: von dem „Statthalter“ Agrippa im Jahr 39/8 v. Chr. und von Vinicius im Jahr 25 v. Chr. Aussagekräftiger werden erst die Belege für die zweite Statthalterschaft des Agrippa im Jahr 19 v. Chr. Doch auch der zweite Mann im Reich nach Augustus hielt an den Leitlinien der Politik Caesars prinzipiell fest, nämlich den Rhein als Grenze zu festigen. Während Caesar aber immer von einer Umsiedlung von Germanen ins linksrheinische Gebiet abgeraten hatte, leitete Agrippa nun ein umfangreiches Ansiedlungsprogramm ein: Spätestens jetzt wurden die Ubier aus ihren Gebieten gleich östlich des Rheins ans linksrheinische Ufer umgesiedelt.
Dort gründeten sie das oppidum Ubiorum als Vorgänger Kölns. Die Chatten ersetzten dagegen die Ubier im rechtsrheinischen, ursprünglichen Siedlungsgebiet. Mit den Chatten wurde ein auf zehn Jahre befristeter Vertrag (bis 10/9 v. Chr.) ausgehandelt. Auch die Sugambrer aus dem Großraum Düsseldorf erhielten ein foedus.
Die Bataver wurden an der Rheinmündung angesiedelt. Bei Neuss und Nijmegen wurden erste Lager gebaut, die zwischen 19 und 15 v. Chr. besetzt waren5 – mit Truppen, die nach der Befriedung Spaniens frei geworden waren. Weiter wurde eine Hauptstraße von Metz über Trier, wo die Moselbrücke (dendrochronologisch auf das Jahr 18/17 v. Chr. datiert) gebaut wurde, bis zum Rhein angelegt.
Bei dieser Politik der Sicherung der Rheingrenze mit einer Hauptbasis bei Neuss wäre es geblieben, wenn nicht aufgrund der wiederholten Übergriffe von Horden germanischer Stämme ins linksrheinische Gebiet – die in der Lollius-Niederlage 16 v. Chr. kulminierten – ein Umdenken in der Strategie gegenüber dem rechtsrheinischen Raum eingesetzt hätte.
Die Lollius-Niederlage und die Folgen
Die Niederlage des Lollius, bei der eine Legion von der Jungmannschaft (d. h. der wehrfähigen Jugend) vor allem der Sugambrer aufgerieben wurde und auf römischer Seite der Verlust eines Feldzeichens zu beklagen war, fiel an sich nicht ins Gewicht. Es stand nicht einmal der ganze Stamm hinter dem Einfall dieser Horde. Vielmehr leistete der Stamm schnell Genugtuung. Aber peinlich war der Vorfall schon: Die Niederlage verursachte „mehr Schande als Schaden“, konstatieren daher auch die Quellen.
Augustus hatte gerade das neue saeculum gefeiert, als die Nachricht von der peinlichen Niederlage des Lollius eintraf. Der Princeps sah sich gezwungen, nach Gallien und zum Rhein aufzubrechen, um persönlich die Verhältnisse dort zu ordnen. Auf diese Weise sollte dem Eindruck der Instabilität entgegengewirkt werden.
Alle Regelungen, die dabei ins Werk gesetzt wurden, bedeuteten eine eindeutige Abkehr von dem, was seit Caesar bis zum zweiten Rheinkommando des Agrippa Leitlinie gewesen war. Augustus ordnete den gesamten rückwärtigen Raum Galliens neu, indem er drei neue Provinzen schuf: die Belgica, Aquitanien und die Lugdunensis. Darüber hinaus verlegte er weitere Legionen an den Rhein und stationierte sie in zwei neuen Hauptbasen, die bei den künftigen Invasionen als Ausgangspunkt dienen sollten. Fortan waren neben der Legion von Neuss mindestens jeweils zwei weitere Legionen in Xanten und Mainz an wichtigen Einfallstraßen im rechtsrheinischen Gebiet stationiert: Von Xanten aus entlang der Lippe und von Mainz aus durch die Wetterau und entlang des Main.
Schließlich bestellte er den jüngeren Sohn seiner Gattin Livia, Drusus, zum Oberbefehlshaber, der gleich daran ging, die administrativen Maßnahmen des Augustus im Sinne der neuen Politik weiterzutreiben. Drusus schuf einen gesamtgallischen Landtag in Lugdunum/ Lyon mit einem Loyalitätskult für die Göttin Roma und Augustus, wie er auch im Osten schon bekannt war.6 Als Vorbereitung für die Offensiven führte er auch in üblicher Weise einen Zensus (eine Steuerschätzung der Bevölkerung) durch.
Ein weiterer Einfall der Sugambrer im Jahr 12 v.Chr. bildete dann den Anlass und die rechtliche Grundlage, die längst geplanten Invasionen als „gerechten Krieg“ in Angriff zu nehmen. Von Anfang an schlossen die großräumigen Offensiven den gesamten Siedlungsraum der Rhein-Wesergermanen sowie der Nordsee- und Elbgermanen (bis zur Elbe) ein, und zwar gleichzeitig von Mainz und Xanten aus sowie über die Nordseeströme.
Die Drususoffensiven
Im Jahr 12 v. Chr. stieß Drusus vom Niederrhein aus und mit der Flotte über die Nordseeströme ins Chaukengebiet vor, während weiter im Süden andere Heereseinheiten aktiv waren. Ein Jahr später zog eine Heeresgruppe unter Leitung des römischen Oberbefehlshabers entlang der Lippe bis zur Weser und von dort ins Gebiet der Cherusker. Doch dann wurde die beständige Achillesferse der römischen Offensiven im rechtsrheinischen Gebiet offenbar, die den geographischen Gegebenheiten und dem Klima geschuldet war: Auf dem Rückzug am Ende der Feldzugssaison geriet der Heerbann unter den schwierigen Wetterbedingungen wegen der schlechten Wege in eine Krise. Das war der strategische Vorteil der Gegner, den später Arminius systematisch ausnutzen sollte.
Die großen Marschlager dieser Offensivphase im sogenannten Oberardenhorizont sind – wie z. B. Oberarden selbst mit 54 ha – insbesondere an den Einfallstraßen etwa entlang der Lippe errichtet worden, um Heeren von drei bis vier Legionen für den Vormarsch kurzfristigen Schutz zu bieten. Lager dieser Zeit, wie das Versorgungslager Rödgen in der Wetterau oder das Lager in Dangstetten, wurden nach dem Unfalltod des Drusus und der Unterwerfung der Germanen 8 v.Chr. systematisch aufgelassen.
Diese Marschlager wurden in der Folge durch kleinere, rechteckig-regelmäßige, für eine längere Dauer konzipierte Lager wie Haltern mit 18 ha entlang der Lippe ersetzt. Das weiter östlich gelegene Lager Anreppen mit 23 ha gehört ebenfalls dem „Halternhorizont“ an, wenn auch beide Lager nicht ganz deckungsgleich in der Belegungsdauer sind, vielmehr nur grob der Zeit der römischen Eroberung zwischen 7 v. und 9 n. Chr. angehörten.
Die zeitliche Einordnung der Lager Oberarden und Anreppen ist weitgehend abgesichert durch dendrochronologisch auswertbare Bauhölzer. Bei anderen Lagern müssen andere Erwägungen hinzugezogen werden: Terra Sigillata und Münzen. Die Münzfunde – neben der Edelmetallprägung das sogenannte Soldatengeld – geben mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten wichtige Anhaltspunkte für die Datierung dieser Lager. Da antike Prägungen immer Bedarfsprägungen sind, hat man zwischen Prägung und Ausgabe nur einen ganz geringen Zeitraum zu veranschlagen.7 Das ist ganz besonders für die Datierung der Lager der Zeit der Okkupation und der Varus-Statthalterschaft zwischen 8 v. Chr. und 9 n. Chr. wichtig, und nicht zuletzt für die Einordnung der militärischen Auseinandersetzungen, deren archäologischen Spuren man bei Kalkriese, Osnabrück, gefunden hat.
Das Verhältnis zwischen Edelmetallmünzen und Kupfergeld ermöglicht Aussagen über das Ereignis: Während bei den systematisch aufgelassenen Lagern Funde von Gold- und Silbermünzen eher selten sind, findet man „Barschafts-“ oder Hortfunde mit hohem Anteil an Edelmetallen gegenüber dem „Kleingeld“ oder „Soldatengeld“ aus Kupfer dort häufig, wo es den Soldaten nicht mehr gelungen ist, ihre wertvollen Ersparnisse wegzuschaffen. Da ein solcher Befund im Engpass von Kalkriese vorliegt – wie auch in Pompeji, das bekanntlich beim Vesuvausbruch 79 n. Chr. untergegangen ist –, hat demnach dort eine Katastrophe stattgefunden, bei der eine römische Armee mitsamt Tross den germanischen Angreifern unterlegen war.
Die Lager am Rhein – vor allem bei Xanten und Mainz – erfüllten als Hauptbasen strategisch einen doppelten Zweck: Sie dienten dem Schutz der gallischen Provinzen und der Absicherung der germanischen Eroberungen.
Im Jahr 10 auf 9 v. Chr. zog die Heeresabteilung, die Drusus befehligte, über den Main gegen die Chatten sowie gegen die Markomannen und Quaden, die zur Suebengruppe gehörten. Der Heerzug, der bis zur Elbe gelangte, ist neuerdings ebenfalls archäologisch fassbar: In Hedemünden bei Göttingen ist ein Reiter- bzw. Versorgungslager (Lagerkomplex I–IV, 25 ha) an strategisch wichtiger Stelle entdeckt worden. Weitere Lagerspuren in der Nähe, nicht weit von der Werrafurt, weisen diese Stelle als eine Station aus, die das Drususheer auf dem Weg zur Elbe bzw. auf dem Rückweg von dort bezogen hatte.8
In der Tradition seines großen Vorbildes Alexander ließ Drusus an der Elbe ein großes Tropaion, ein Siegesdenkmal, errichten. Diese Aktion sollte für alle sichtbar dokumentieren, dass hier, an der Elbe, das Ziel der Eroberung erreicht war. Die schnelle Unterwerfung der Germanenstämme noch im folgenden Jahr (8 v. Chr.) bestätigt, dass die Feldzüge erfolgreich abgeschlossen wurden. Diese Unterwerfung erlebte Drusus nicht mehr, da er sich bei einem Reitunfall so schwer verletzt hatte, dass er kurze Zeit später mitten in Germanien im Winterlager Scelerata verstarb.
Als weiteres Indiz für den durchschlagenden Erfolg der Drususoffensiven kann gelten, dass sein Bruder Tiberius, der unmittelbar auf die Nachricht des Unfalls die Nachfolge anzutreten und das führerlose Heer zu übernehmen hatte, quer durch Germanien mit nur einem Mann Bedeckung zum Totenbett des Drusus reiten konnte, ohne dabei bedroht worden zu sein. Inzwischen müssen die Wege so gut ausgebaut gewesen sein, dass Tiberius seinen jüngeren Bruder noch lebend erreichen konnte. Die Eroberungen, Umsiedelungsmaßnahmen und Deportationen dürften schon weit gediehen gewesen sein.
Nichtsdestotrotz ist die Unterwerfung der rechtsrheinischen Germanenstämme und die Auflösung des Sugambrerverbandes nach Ausweis der Quellen erst unter dem Oberkommando des Tiberius (9–7/6 v. Chr.) erfolgt. Allein die Auflösung der Stammesgruppe der Sugambrer zeigt, dass die Unterwerfung der nordwestgermanischen Stämme die Rechtsform einer deditio in fidem hatte, also vollkommen war. Dem siegreichen Feldherrn als Vertreter der Siegermacht stand nämlich – wie im Falle der Sugambrer praktiziert – die Freiheit der vollständigen Auflösung der (staatlichen bzw. hier Stammes-) Existenz offen.
Das Verhältnis zu den in den Osten deportierten bzw. gedrängten Stammesverbänden, die sich im Böhmischen Kessel unter der Führung ihres Königs Marbod zusammengefunden hatten, musste jedoch anders geregelt werden: Vor dieser bedrohlichen Machtkonzentration, die vorerst nicht zu bezwingen war und gefährlich nahe an Norditalien lag, hatte man in Rom großen Respekt. Als Marbod viele Jahre später vor seinen innenpolitischen Gegnern fliehen musste und bei den Römern um Zuflucht bat, frohlockte daher Tiberius:
Nicht Philipp sei für die Athener, nicht Pyrrhos oder Antiochos für das römische Volk in gleichem Maße zu fürchten gewesen. Noch ist die Rede vorhanden, in der er [Tiberius] auseinander setzte, wie groß dieser Mann sei, welche wilde Kraft in den ihm untertänigen Völkerschaften liege, wie nahe der Feind Italien sei und welche Maßregeln er getroffen habe, um ihn unschädlich zu machen.9
Bilanz und Ergebnis der Eroberungen der Drususzeit
Im Ganzen stellen die Drususfeldzüge ein Eroberungsunternehmen dar, das von Anfang an die Elbe als Ziel hatte und die rückwärtigen gallischen Provinzen gegen einen Einfall germanischer Stämme absichern sollte, indem die Elbe fortan als geeignete Grenze nach Osten hin fungierte. Dafür war von Beginn an der gesamte Rhein-Main-Elbe-Raum über die Einfallstraßen Main, Wetterau, Lippe und Nordseeströme Operationsgebiet. Damit wollte man den Warnungen Caesars Rechnung tragen, der von der Eroberung Germaniens abgeraten hatte. Es handelte sich folglich kaum um eine Eskalation wider Willen, die letztlich zu einer unbeabsichtigten Eroberung wurde. Und kaum wird man den Erfolg der Eroberungen bestreiten können: Die Drususoffen-siven führten tatsächlich zur Herrschaft der Römer über den rechtsrheinischen Raum bis zur Elbe.