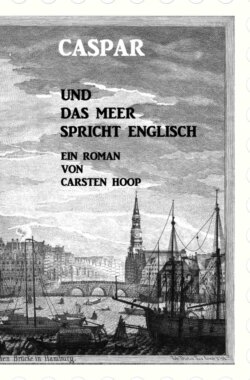Читать книгу Caspar rund das Meer spricht Englisch - Carsten Hoop - Страница 8
6. … und das Meer spricht Englisch
ОглавлениеNach vollen drei Wochen auf See ohne besondere Vorkommnisse steuerten wir ohne Umwege auf die amerikanische Ostküste zu. Das hieß allerdings, nicht ganz ohne besondere Vorkommnisse, denn eines war schon erwähnenswert, um nun erzählt zu werden.
Wir begegneten zuerst zwei britischen Walfängern, dann drei britischen Handelsschiffen, und zuletzt zwei Fregatten der britischen Kriegsmarine, die sogleich ihre Geschützpforten öffneten. Wo waren die anderen Seefahrer abgeblieben? Wo trieben sich die Franzosen, Spanier, Portugiesen, Holländer oder Schweden herum.
„Reiner Zufall“, meinte Kapitän Broder beschwichtigend, doch er wusste, warum wir mit der verstärkten Präsenz des Vereinigten Königreichs konfrontiert wurden. Wir hatten vorsichtshalber und aus gutem Grund den Union Jack aufgezogen. Man wusste nie, was passieren würde. Wir erledigten einen englischen Auftrag von Fishbone & Sons und fühlten uns berechtigt, ja sogar verpflichtet unter dem sichersten Banner der Welt zu segeln. Die Begegnung mit der britischen Marine machte mir nochmals allzu deutlich wie es sich anfühlte Amerika ein zweites Mal im Kriegszustand erfahren zu müssen. Entgegen meiner bekundeten Absicht, das Land wieder unter diesen Bedingungen aufzusuchen! Es würde nicht die letzte bedrohliche Situation sein, soviel war uns gewiss. Der Auftrag der nahen Kriegsschiffe, die Versorgung Neufrankreichs zu unterbinden, brachte häufige Begegnungen mit Briten auf See mit sich. Doch diesmal hatten wir bessere Voraussetzungen im Gepäck.
In der vierten Woche sahen wir das mit Wolken verhangene Festland, aus denen die Sonne vereinzelnd ihre intensiv flutenden Strahlen schickte. Plötzlich tauchte steuerbordseitig eine Brigg auf, die überraschend auf uns zu hielt.
„Alle Mann an Deck!“, krächzte Kapitän Broder, der sein Schiff schon sicher im nahe liegenden Bostoner Hafen sah. Jan rannte auf seine alten Tage mit dem Fernrohr auf das Achterdeck, um die Nationalität des Seglers festzustellen. Der Ausguck konnte bisher nichts erkennen.
„Ich kann die Identität der Brigg nicht ausmachen, Kapitän!“, rief er Broder entgegen. Inzwischen verteilte Hinrich die Handfeuerwaffen. Hannes und Alfred machten die vier Steuerbordkanonen klar zum Gefecht. Sie hatten an der gebotenen Schnelligkeit nicht eingebüßt, die unter Umständen das Leben sicherte. Der 2. Steuermann Jaspar hatte indes die britische Flagge erkannt. Aufatmen! Die Matrosen rafften die Segel des Groß- und Besanmastes.
„So schnell waren sie auf dieser Fahrt noch nicht in den Wanten!“, rief ich zu Hinrich. Der Kapitän nahm der Konstanze die Fahrt und ließ die Segel brassen, um dem herannahenden Dreimaster mit doppelter Kanonenzahl unsere defensive Haltung zu signalisieren. Kapitän Broder musste sogar den Kurs ändern. Sonst hätte es zur Kollision kommen können. Die Brigg änderte keineswegs den Kurs und segelte haarscharf in voller Fahrt an unserem Heck vorbei, um schließlich eine Halse zu drehen. Die Briten ließen uns eindrucksvoll spüren, wer in diesen Gewässern der Herr ist. Obwohl die kleine Brigg nicht unbedingt zum Fürchten aussah, riskierten wir keinen Hochmut. Sie holten bald auf und verweilten längsseits zum üblichen Palaver unter Seeleuten. Peter teilte seinen Landsmännern im feinsten Londoner Englisch mit, was wir geladen hatten, und welche Bestimmung die Ladung in Boston hatte.
„Immerhin haben sie diesmal nicht gleich geschossen“, raunzte Broder anschließend in seinen weißen Bart. Die Hafeneinfahrt war in Sichtweite und die britische Brigg drehte ab, zum womöglich erneuten Auflauern der nächsten Ankömmlinge vor der Küste Massachusetts.
„Eins muss man ihnen lassen, sie holen aus den bestehenden Möglichkeiten das absolut Erreichbare heraus“, sinnierte Hinrich voller Bewunderung für die Purzelbäume der Briten auf See, die wir eben bestaunen durften.
„Ja, ja, das Meer spricht Englisch!“, rief ich Kapitän Broder, Hinrich und Peter Fishbone zu. Sie lachten, weil die vielen Begegnungen mit Briten auf den Meeren tatsächlich eine eigene Sprache beinhaltete, die alle anderen zunächst in Schrecken und auch oft in Seenot versetzte. „Peter kannst du uns was über Boston erzählen. Du warst doch bestimmt schon einmal hier?“, fragte ich Mister Fishbone, dessen Ängste vor Kanonendonner noch nicht verflogen waren. Nebenbei überspielte ich so meine eigene Furcht, die mir seit dem Vorfall in den Gliedern saß. Die Erinnerungen an Begegnungen dieser Art entflammten in mir, als wäre die erste Walfangfahrt samt allen Gefahren gestern gewesen. >Und so ein Kerl will sich feindlichen Indianern gegenüberstellen und seinen Cousin Jacob retten<, dachte ich mit Grausen und überlegte mir, was ich da eigentlich, wie vom Wahnsinn getrieben, vorhatte.
„Nur aus zweiter Hand kann ich etwas erzählen, Caspar. Ein Besuch in Boston blieb mir zwar verwehrt. Mein Vater Mortimer war ein paar Mal hier, sonst wären die Handelsbeziehungen nicht die, die sie schließlich geworden sind. Also, ich versuch es mal. Vor uns seht ihr einen richtigen Naturhafen. Um die Bucht von Boston befinden sich zerklüftete Gesteinsformationen, die, wie man sieht, sichelförmig ausgerichtet sind und für Sicherheit und ruhiges Gewässer innerhalb des Hafens sorgen. Sie bremsen die Naturgewalten ohne, dass die Menschen selbst Hand anlegen müssen. Deshalb zählt Boston zu den natürlichen Keimzellen der englischen Kolonisation in Amerika. Bereits 1630 gründeten die Puritaner diesen Ort an der Massachusettsbay, der sich schnell zum bedeutendsten Handelsposten und Umschlagplatz entwickelte. Allerdings wurde die erste Kolonie 1620 durch die Pilgerväter in Plymouth gegründet, die zuvor aus England fliehen mussten, weil sie sich von den Anglikanern, unsere englischen Protestanten, abspalteten. Auch Plymouth` Institutionen zählen zur Massachusetts-Bay-Company, die den Handel tatkräftig organisiert.“
„Was sind Puritaner, Peter?“, wollte Arian wissen, der schnell begriffen hatte, dass er zu den Auserwählten gehörte, die sich demnächst in der Neuen Welt mit den hier lebenden Menschen zurechtfinden musste.
„Das sind Abweichler der reformierten anglikanischen Kirche in England, die sich im Gegensatz zu den Pilgern aber nicht abspalteten. Also Protestanten, die ihrerseits protestierten, äh … nah, so ähnlich jedenfalls. Sie spalteten sich von der Abspaltung ab. Ist auch nicht besser, was?“
„Doch, doch, ich hab dich schon verstanden, Peter. Vielleicht könnte man sagen, Puritaner sind die französischen Calvinisten!“
„Das werden die wiederum nicht gerne hören, Caspar. Egal, aufgrund der Entfernung zur englischen Mutterkirche ist indes von einer Veränderung der Kirche, auch und vor allem in der gesamten Lebenseinstellung in der Neuen Welt zu hören. Die Menschen haben hier einfach andere Probleme, als in England. Grundsätzlich kann ich mit Gewissheit sagen, dass die Unterschiede zum Katholizismus der Franzosen beträchtlich sind. Ihre verachtende Haltung uns gegenüber rührt eben auch daher, sonst würden sie uns nicht als Ketzer beschimpfen.“
„Die verachtende Haltung der Briten gegenüber den Franzosen sollte aber keineswegs unterschätzt werden, Peter!“, entgegnete ich mit fester Stimme. Schließlich pachteten beide keine moralische Instanz, die dem Gegner alle Rechte auf Selbstbestimmung absprachen. Hier war einzig und allein Toleranz gefragt. Ein Begriff, der im Krieg natürlich nichts zu suchen hatte, und deswegen auch nicht dieser Tage über meine Lippen kam. Städte wie Altona oder Wandsbek hatten gezeigt, was religiöse Toleranz bedeutete. Nämlich ein friedliches Miteinander unterschiedlichster Religionen auf kleinem Raum. Da konnte sich auch Hamburg noch viel abgucken, da sie in der Konsequenz intoleranter waren und Einzelfallentscheidungen bevorzugten.
„Alles klar zum Festmachen“, brüllte Jan, der den Kapitän vertrat. Ein gut geordneter Hafen lag uns zu Füßen. Schaute man von der Konstanze auf die Stadt, ragte eine bebaute Landzunge mittig in die Bay und teilte den Hafen in zwei Hälften. Die Stadt hatte in ihrer kurzen Schaffenszeit beträchtliche Ausmaße angenommen. Die vielen Kirchtürme wiesen auf rege religiöse Anteilnahme der Bevölkerung hin. Felsenartige Kegel im Stadtgebiet sahen wie emporgeschossene Pilze aus. An einigen Felsen trugen Arbeiter Gesteinsmassen ab, um die Landgewinnung im Stadtgebiet voran zu treiben.
Der Hafenmeister wies uns an, unser Schiff längsseits der dominierenden großen Überseebrücke festzumachen. Neugierig kamen die Menschen zusammen. Man fragte sich, was ein fremder Walfänger am Anfang der Saison hier zu suchen hatte. Noch dazu in dieser Farbe! Kapitän Broder und Peter Fishbone besprachen mit dem Hafenmeister die Formalitäten. Die Briten durchsuchten das Schiff. Schließlich war Krieg und es wäre nicht das erste Mal, dass ihre Feinde versuchten, auf diesem Wege Sabotageaktionen zu initiieren. Immer mehr Menschen liefen auf die große Seebrücke und tuschelten vor unserem Schiff, als ob sie ein Weltwunder zu bestaunen hätten. Sie hatten mit großer Sicherheit noch nie einen so hässlich angestrichenen Walfänger gesehen. Der Hafenmeister gab das Schiff frei und wies uns einen Platz im Hafen zu, wo die begehrte Fracht in Zeiten des Mangels gelöscht werden konnte. Wir legten also wieder ab und nur langsam löste sich die Versammlung der Neugierigen und Taugenichtse auf der Brücke auf. Peter hatte einen Laufburschen zur Company geschickt. Einer von vielen, die hier für ein Trinkgeld auf Botengänge warteten. Doch oftmals erreichte die Nachricht unserer Ankunft den Handelspartner schon vorher.
Kurz darauf erschien der Importeur der Fishbones, Mister Benjamin Smith. Ein stattlicher Herr um die 50, mit langen grauen Koteletten und einem strengen Ziegenbart, der seine ernsten Wesenszüge unterstrich.
„Endlich lerne ich einen der Söhne meines Freundes Mortimer kennen. Herzlich willkommen in Amerika! Du müsstest der geschäftige Peter sein, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.“
„Ja, der bin ich. Auch mich freut es außerordentlich hier sein zu dürfen, Mister Smith!“, antwortete er mit freudiger Begeisterung. Peter stellte uns vor, während die restliche Mannschaft ins nahe Quartierhaus für Seeleute zog. Das ungewöhnliche Schiff sorgte auch bei Benjamin Smith für leichte Verwirrung, sodass Peter schnell alles aufklärte, was er zu diesem Zeitpunkt für notwendig erachtete. Nicht ohne eine Einladung zum Abendessen bei Familie Smith verließen wir die Hafenanlagen von Boston. Peter hatte das Privileg, als Gast bei Mister Smith wohnen zu dürfen. Schon bald würden wir auf der Weiterreise nicht sehr komfortabel untergebracht sein, da wäre eine Ablehnung von Peter schon deshalb töricht gewesen. Zudem diente sie nicht der Förderung der wichtigen Amerikakontakte, die es galt weiter auszubauen und in die nächste Generation zu tragen.
Wie nach einer Atlantiküberquerung in Bostons Handelshäusern üblich, wurde die Führungsmannschaft mit einem Festessen von der Familie Smith verwöhnt. Leicht irritiert lernten Peter Fishbone, Kapitän Broder, mein Bruder Hinrich, Jan Behrens und ich die ausführlichen Tischgebete der Puritaner kennen, die strengen Regeln unterlagen. Peter hatte uns auf die Eigenarten englischer Kolonisten, die der reformierten englischen Kirche angehörten, hingewiesen. Ihre Art der Religionsauslegung bestimmte kompromisslos ihr gesamtes Leben. Grundsätzlich war für die Puritaner, die die Bibel wörtlich nahmen, jeder Mensch verdorben. Zeit seines Lebens musste er gegen das Höllenfeuer ankämpfen, indem unbedingte Frömmigkeit oberstes Gebot auf dem Weg zum guten Menschen unerlässlich war. Die dadurch gebotene Lebensart machte sie misstrauisch, weil sie hinter jeder weltlichen Begebenheit den wahrhaftigen Teufel vermuteten, der sie auf ihrem Weg zu Gottes Auserwählten abfangen wollte. Nicht gerade die besten Voraussetzungen fremde Handelspartner aus Übersee zu bewirten. So mochte wohl Smith seine Arbeit als schwere Prüfung im Kampf gegen das Böse verstanden wissen.
Benjamins Frau, sowie deren fünf Kinder nahmen ebenfalls am Schmaus teil. Die strengen Zöpfe der fast erwachsenen drei Töchter, ihre Demutshaltung und die scheuen Blicke beherrschten meinen ersten Eindruck im Hause unseres Gastgebers. Der eigenwillige Bart des Importeurs Smith bildete sozusagen das männliche Pendant zu den Zöpfen der Kinder. Erst nach dem Essen, das nach einer langen Seefahrt keine Wünsche offen ließ, war eine ausführliche Unterhaltung im Arbeitszimmer Benjamins gewünscht. Wir hielten die Spielregeln ein. Sie führten uns vor Augen, wo wir selbst standen. Es konnte Menschen nicht schaden, ab und zu einen Spiegel vorgesetzt zu bekommen. Nachdem der Hausherr unsere ganze Geschichte inklusive unseres Anliegens gehört hatte, erhofften wir offene Worte des Wohlwollens von Mr. Smith zuhören. Jedoch nach einer Weile des Schweigens, sagte er nur barsch mit nachdenklicher Miene:
„Wir haben keine eigenen Schiffe, meine Herren. Wir sind keine Reeder!“
„Kennen Sie denn jemanden?“, fragte Peter kurzum und Smith guckte böse.
„Allerdings denke ich, ihr könntet auf einem Schiff meines Freundes James Dwight euer abenteuerliches Vorhaben angehen. Das zu organisieren wäre nicht schwierig, vorausgesetzt James ist einverstanden.“
„Wieso wäre es nicht schwierig - in diesen Zeiten - Mr. Smith?“, wollte ich wissen.
„Dazu kommen wir noch, junger Herr! Ich wüsste nur nicht, wie es für Sie weitergehen könnte. Schauen wir einmal auf die Karte.“ Mister Smith holte eine Amerikakarte hervor, die anders aussah, als die mir bekannten französischen Karten. Nach intensivem Studium hatte ich des Rätsels Lösung gefunden; die dreizehn Neuengland-Kolonien waren im Verhältnis größer eingezeichnet, als die französischen Besitzungen der Nachbarschaft. Oder meinetwegen auch umgekehrt. Die Neufrankreichkarten waren größer auf den französischen Karten eingezeichnet. Die beiden europäischen Mächte hatten sich wie Pfauen aufgeplustert, um den jeweils anderen zu imponieren. Kein Wunder dachte ich, dass uns damals die Landkarten so oft im Stich ließen! Mr. Smith fuhr fort:
„Ihr habt zwei Möglichkeiten: Zu Massachusetts gehört das nordöstlich gelegene Maine. Seht, hier oben.“ Er zeigte auf eine kleine Stadt der nördlichen Ostküste.
„Von Portland in Maine mit Schiffen den Kennebecfluss nach Norden. Vielleicht könnt ihr am Kennebec im Fort Western oder weiter oberhalb im Fort Halifax, kurz vor der Grenze am Mount Mégantic, versorgt werden. Dort kann man von Waldläufern oder Pelzhändlern Kanus erwerben. Es gibt dort eine kleine Garnison. Über den Mégantic-Pass der Appalachen geht es weiter Richtung Norden zum Sankt Lorenz Tal nach Quebec. Der Chaudière River führt, wie ihr auf der Karte sehen könnt, zum Sankt Lorenz und mündet dort als großer Wasserfall in den großen Strom. An seinem Unterlauf ist der Fluss von Franzosen besiedelt. Bis dahin sind es von der Mündung des Kennebec in den Atlantik ungefähr 230 Meilen. Nach eurem Maß sind es ungefähr 370 Kilometer. Nun zur zweiten Möglichkeit: mit dem Schiff nach New York und von da aus den Hudson River hoch nach Albany. Dieser Weg hätte den Vorteil, dass ihr in Albany erfahrene Männer findet, die euch in das Gebiet führen könnten. Obwohl über Albany eine längere Strecke zu segeln ist. Mein Freund James Dwight fährt beide Strecken, sowohl nach Portland, als auch nach Albany über New York. Was soll ich ihm sagen?“
Peter und ich schauten nochmals auf die Karte. Plötzlich hatte Smith es sehr eilig. Fast schon beinahe seltsam mit anzuschauen wie seine aufgesetzte Freundlichkeit und seine ungehörige Ruppigkeit harmonierten. Hing von unserer Entscheidung doch eine Menge ab. Hinrich, Jan und Kapitän Broder hielten sich heraus, guckten aber etwas wunderlich. Es ging hier eben nicht um den anstehenden Walfang mit der Konstanze, den sie zu bewältigen hatten.
„Gibt es zwischen Portland und dem Oberlauf des Kennebec keine weitere Stadt, die mit Albany vergleichbar wäre?“, fragte ich Mister Smith.
„Eine äußerst gute Frage, Mr. Kock. Sie haben genau die Lücke in meinen Erläuterungen gefunden! Die Antwort ist: vielleicht! In den Forts Western und Halifax werdet ihr auch Männer finden, die euch weiter helfen können. Die Standorte sind jeweils noch im Aufbau beziehungsweise im Wiederaufbau. Wo gestern drei Holzhäuser standen, können es morgen schon sechs sein. Vor Ort gibt es kleine Nester mit Handelsniederlassungen der Boston-Company, die aber auf der Karte nicht eingezeichnet sind. Bevor ich es vergesse, sollten wir noch über einen anderen wesentlichen Punkt sprechen. So wie sie sagen, wäre es denkbar, dass die Gruppe um ihren Cousin von Indianern entführt worden ist.“
„Ja, anders ist es nicht zu deuten, was wir von der Mannschaft der Konstanze erfuhren“, bestätigte ich.
„Dann werden die Irokesen wahrscheinlich dafür verantwortlich sein. Sie streifen oftmals durch die französischen Siedlungsgebiete am Chaudière River entlang. So wie die Verbündeten der Franzosen, die Abenaki, im Gegenzug bei uns Terror und Schrecken verbreiten. Jedoch liegt das Stammesgebiet der Mohawks, dem östlichsten Irokesenstamm, ursprünglich weiter westlich im Mohawk Tal, sehen sie hier auf der Karte. In der Gegend um Albany eben. Vielleicht wäre es deshalb sinnvoller gleich in Albany mit der Suche anzufangen, verstehen sie?“
„Es ist vernehmlich, was sie meinen, Sir. Kommt es denn oft vor, dass die Indianer Weiße verschleppen?“, wollte Peter wissen.
„Ja, leider häufig. Zwei Cousins von mir wurden vor drei Jahren in den Bergen entführt. Traditionell füllen die Indianer ihre eigenen Reihen, die vorher im Kampf gefallen waren mit ausgesuchten Kindern oder besonders tapfer kämpfenden Feinden wieder auf. Unsere Familie hatte Glück. Einen alten Trapper aus den Bergen engagierten wir damals, um Klarheit zu schaffen. Er konnte die Cousins schnell ausfindig machen. Gegen ein paar alte Flinten und Schnaps lösten wir die beiden anschließend aus. Doch es endet nicht immer so glimpflich.“
Doch ich wollte keine Skepsis: „Wir haben eine Chance sie lebend vorzufinden. Das ist doch was. Lass uns aus dem positiven Ende der Geschichte die Kraft schöpfen, die nötig sein wird, Peter.“ Ich wandte mich anschließend an unseren Gastgeber.
„Wir danken ihnen, Mr. Smith. Meine Hoffnung, Jacob und seine Freunde lebend zurück zu bekommen, ist durch ihre Ausführungen genährt worden. Fragen sie bitte ihren Freund nach einer Fahrt an den Kennebecfluss. Mir scheint der Weg von Albany an den Chaudière sehr weit zu sein, zumal der kürzere Weg schon knapp 400 Kilometer beträgt. Darum möchte ich von Portland Richtung Kanada vorstoßen und südlich von Quebec am Chaudière mit der Suche beginnen, wo letzte Spuren der vermissten Gruppe entdeckt worden waren.“ Zu guter Letzt hatte Benjamin Smith wegen der Entführung seiner Cousins doch noch begriffen, dass wir ohne entsprechende Hilfe unserem Vorhaben aussichtslos gegenüberstanden und er seiner Christenpflicht genügen musste. Er wird uns deswegen nicht mehr mögen, als vorher, aber er schien sich an seine eigene Zeit der Ungewissheit erinnert zu haben, die man vielleicht nicht einmal gewöhnlichen Ketzern oder anderen Ungläubigen wünscht.
Als 1754 die ersten Gefechte um das Ohiotal entbrannten, sprach sich bald auch in Massachusetts herum, dass die Niederlage Washingtons bei Fort Necessity nur der Anfang eines großen Krieges um Amerika war. Das Gerangel der Kolonialmächte dauerte bereits eine ganze Weile, bis der letzte Funke endgültig einen langen entscheidenden Krieg um Nordamerika in Gang brachte. Die Boston-Bay-Company versuchte, dünn besiedelte Gebiete dem unaufhörlichen Siedlerzustrom zugänglich zu machen. Sie beschleunigte den Ausbau der Handelsstationen an den großen Wasserläufen Neuenglands, die wesentlich zur Attraktivität des inneren Kontinents beitrugen. Die mächtige Company sorgte für den Schutz der geschaffenen Einrichtungen durch die Soldaten des britischen Königs. In dieser Zeit entstanden weitere Forts an jenen neuralgischen Punkten, wo der Handel schon vor der Landnahme der Europäer stattgefunden hatte. Es waren meist Flussmündungen oder strategisch günstige Flecken, die den Machtbereich des Besitzers absicherten. Die regelmäßige Versorgung der Handelsstationen wurde von Reedern, wie James Dwight übernommen, die als linientreue Royalisten von den Gouverneuren eingesetzt wurden. In gleichmäßigen Abständen erhielten die Vorposten der Zivilisation die nötigen Dinge des Lebens und die Boston-Bay-Company die Früchte der Wildnis, die insbesondere aus Pelzen und Holz bestand.
Der glückliche Zufall wollte es, dass ausgerechnet zwei Tage später Mr. Dwight mit dem Zweimaster Adventure zum Kennebec Fluss aufbrach. Selbiger war einer jener Flüsse, die das Wasser des Appalachen-Gebirges aufnahm, um es anschließend 240 Kilometer zum Atlantik zu befördern. Der Appalachen-Gebirgszug trennt den britischen Einflussbereich vom französischen im Nordosten Amerikas. Es war eine ganz routinemäßige Versorgungsfahrt des Mr. Dwight, die viermal im Jahr zum Fort Western führte. Der Fluss verlief in etwa von Nord nach Süd. Das bedeutete, jede Meile flussaufwärts würde mich Quebec ein wenig näher bringen und damit hoffentlich auch zu meinem Cousin Jacob und seinen Weggefährten.
Der Reeder James Dwight war auch gleichzeitig der Kapitän der Adventure. Benjamin Smith hatte sofort am folgenden Tag mit ihm gesprochen. Auf das nächste Schiff nach Albany am Hudson wäre meine Geduld zehn Tage lang auf die Probe gestellt worden. Geduld war noch nie meine Stärke gewesen. Kein einziges Schiff hätte mich eher aus Boston in Richtung New York herausgeschifft. Außer einigen Krabben- und Hummerfischern vielleicht, die allerdings ein Zusatzverdienst nicht verschmähten. Es gab keinen Grund mit dem Schicksal zu hadern, die Würfel waren für Mr. Dwight und das Kennebectal gefallen. Die Konstanze fuhr am nächsten Morgen mit der Flut aus dem Bostoner Hafen. Hinrich und Kapitän Broder versicherten mir, spätestens am Ende des Septembers wieder dort sein zu wollen. Auch die Fishbones in London rechneten mit der Heimreise ihres Sohnes erst zum Ende der Walfangsaison im Oktober. Dieses Mal sollte der angestrebte Fang der Konstanze unbedingt auch Hamburg erreichen, Krieg hin oder her. Wir wussten allerdings, dass Walfang nicht nach exaktem Zeitplan funktionierte und so war der Abholtermin in Boston von vielen Dingen im Verlauf der Fangperiode abhängig. Das waren Hinrichs letzte Worte, bevor der graue Walfänger sich von der Hafenanlage entfernte und nochmals dem Spott der Bostoner Bevölkerung ausgesetzt wurde, die die Aktivitäten mit Argusaugen im Hafen beobachteten.
Kurz danach widmeten wir uns in Boston den Ausrüstungshäusern, die zahlreich am Hafen vertreten waren. Wir versorgten uns mit dem Nötigsten zum Überleben in der Wildnis. Auch das Überwinden der Appalachen-Bergkette musste so oder so mit unserem Gepäck zu schaffen sein. Hannes suchte sorgfältig die Vorderlader aus, sowie damals in Quebec, vor der Durchquerung des amerikanischen Kontinents. Der gut Englisch sprechende Matrose Arian begleitete ihn, während Peter und ich mit Benjamin Smith zur allmächtigen Boston-Bay-Company gingen. Dort stellte man uns die entsprechenden Passierscheine aus, damit wir unser Fortkommen in Maine gesichert sahen. Im Land herrschte bekanntlich Kriegszustand mit allen grässlichen Auswirkungen. Das natürliche Misstrauen der Menschen hatte bereits in Friedenszeiten Spuren in den Gesellschaften der Kolonisten aus Europa hinterlassen, die oftmals in der Wildnis auf sich selbst gestellt waren und sich meist selbst organisieren mussten.
Am Abend hatten wir nochmals die Ehre, von Familie Smith zum Essen eingeladen zu werden. Die Prozedere bei Tisch nahm den bekannten Verlauf, nur dass wir uns diesmal vorbereiteten und unsere Umgangsformen dementsprechend anpassten. Selbst Arian und Hannes durften der neuerlichen Einladung entsprechen. Für gemeine Mannschaftsdienstgrade waren solche Einladungen als außergewöhnlich zu bezeichnen. Mr. Smith hatte verstanden, dass sie als unverzichtbare Teilnehmer einer Expedition in das Grenzland gleichberechtigt agierten. Dabei wurde die Hierarchie, die an Bord unseres Schiffes existierte, zweifelsohne außer Kraft gesetzt. Ein Vorgang, der seinesgleichen suchte, denn die Abgrenzung zwischen Mannschaften und den Schiffsführungen war vor allem durch die Aufrechterhaltung von Disziplin und Ordnung begründet, ohne die eine effektive Führung des Schiffes nicht gelingen konnte. Doch hier galten ganz andere Maßstäbe.
Überraschenderweise durfte während des Essens gesprochen werden. Arian wurde von Benjamin Smith sogar aufgefordert, aus seiner nordfriesischen Heimat zu erzählen. Da mussten Matrosen, je weiter sie sich von zuhause entfernten, nicht lange überlegen. Es ist, als ob man an einem Hebel zog, der eine Folge von Selbstverständlichkeiten auslöste, die nur noch schwer zu stoppen waren. Arian hatte keine Anlaufschwierigkeiten. Das Interesse an seiner Heimat beflügelte ihn umso mehr:
„Oft suchen heimtückische Stürme unsere schöne Insel Sylt in der Nordsee heim. Der reine Strandsand - wie Puderzucker hell und pulverig, wird durch die Kräfte von Wasser und Wind im Nu fortgetragen. Die qualvoll herbeigeschafften Steine und Holzpfähle, die sommers in die Erde gerammt werden, um die Küste zu befestigen, werden winters meist durch ebenjene Gewalten wieder weggespült. Dabei muss das ganze Dorf mithelfen, weil die Arbeit sonst nicht in der kurzen Zeit zu schaffen ist. Denn, viele Fischer werden um ihre Existenz gebracht und von manchem Bauern schwindet Grund und Boden, wenn der Sturm wiedermal zugeschlagen hat. Der Kampf beginnt jedes Jahr aufs Neue. Wer den Mut zum Neuanfang hat, gerät unter Umständen in die Hände der königlich-höfischen Schergen, die Matrosen für den dänischen König suchen und meist auch fündig werden. Nur durch die Heuer auf überwiegend holländischen und deutschen Schiffen, abseits der Heimat können die Männer ihre Familie ernähren, und dem perspektivlosen königlichen Zwangsdienst auf dänischen Kriegsschiffen eine Zeit lang entkommen. Heimatflucht, wenn man so will … zum Wohle der Heimat!“
„Interessant, Arian! Gehen Sie hier aus freien Stücken mit in die Wildnis?“, fragte Mrs. Smith unbedarft, sodass ihr Mann vor Scham versank und die Augen verdrehte. Scheinbar war er es nicht gewöhnt, wenn seine Frau eigene Gedanken äußerte. Doch die Antwort interessierte offensichtlich auch den Hausherren, der in Lauerstellung hin und hergerissen weilte.
„Ich bin stolz, dass Herr Kock dabei an mich dachte und ich hoffe einen großen Dienst leisten zu können, Madame. Wir werden Jacob und die anderen finden, da bin ich ganz sicher. Ich werde jedenfalls mein Möglichstes tun!“ Nun lächelte sogar Mr. Smith, weil die Antwort Arians weniger peinlich für seine Frau ausfiel, als er als Einziger befürchtete. Doch Mrs. Smith Wissensdurst schien an diesem Abend unerschöpflich zu sein. Schließlich hatte man hier nicht alle Tage Besuch vom alten Kontinent, noch dazu junge unverbrauchte Leute, die einmal nicht über Politik und den Krieg sprachen und längst nicht immer hatte man die Erlaubnis des Hausherrn zur Konversation.
„Wissen sie denn nicht, welche Gefahren in den Bergen lauern, Arian? Die Wilden skalpieren alle, die von Süden über die Pässe der Bergkette kommen!“
„Nun mach aber mal einen Punkt, Henrietta! Die Wilden hinter der Bergkette unterscheiden sich von denen vor der Bergkette nur dadurch, dass die Einen mit uns verbündet sind und die anderen nicht! Mister Kock ist bereits quer durch Amerika gereist und hat noch sämtliche Haare auf dem Kopf, oder vielleicht nicht?“ In dem Moment bereute Benjamin Smith endgültig, die bewährten Tischsitten gelockert zu haben. Sein sich verdunkelnder Gesichtsausdruck ließ keine andere Schlussfolgerung zu. Henrietta Smith verstummte leider, obwohl ihre Mimik den nächsten Satz verriet, den sie parat in der Vorbereitung hatte. Bedauernswerte Stille breitete sich stattdessen am Tisch aus und ich überlegte, ob ich nun noch aus anderen Bereichen des Lebens von der Familie unzensierte Antworten erhalten würde. Doch soeben hatte der Hausherr mit nur einem brummigen Knurren die alte Tischordnung wieder hergestellt. Mit dürftiger Authentizität unserer Gastgeber war im weiteren Verlauf des restlichen Abends zu rechnen.
Die jüngste Tochter Jannis errötete, als Arian sie unverblümt lange anschaute. Jannis saß Arian direkt am Tisch gegenüber und hatte keine großen Chancen seinem neugierigen Blick auszuweichen. Eine viel zu große Kopfhaube aus weißen Leinen mit Spitzen verdeckte ihr zartes Antlitz, wie die ledernen Scheuklappen eines Zugpferdes. Ihre Eltern konnten durch die Sichteinschränkungen der Haube keinen Verdacht schöpfen. Schon bald senkte sie ihren Blick als letzten Ausweg, um dann doch noch einmal kurz zu schauen, ob Arian ihr gegenüber standhaft geblieben war. Dann wurde das kurzweilige Schauspiel abrupt unterbrochen. Hannes hatte Arian einen kräftigen Tritt unter dem Tisch verabreicht, der einerseits berechtigt, aber andererseits meiner Neugierde die Nahrung entzog. Letztlich hatte Arian seine gerechte Strafe erhalten, denn Jannis hatte sich die Zwänge der strengen Erziehung nicht ausgesucht und konnte nur als Verliererin dastehen. Aber dennoch schien sie an Arian nicht uninteressiert zu sein.
Der Gastgeber bat uns abschließend in den Salon, seine Stimmung stieg nun zusehends. Er wollte den Abend in Eintracht mit seinen weit gereisten Gästen verbringen, ohne uns mit Widrigkeiten zu konfrontieren. Seine Frau und die Kinder verschwanden lautlos in den Wirtschaftsräumen des großen Hauses, als ob sie gar nicht da gewesen wären.
Am nächsten Morgen verließen wir mit dem Segler Adventure den Bostoner Hafen. Beladen mit Gerätschaften, Saatgut und Lebensmitteln für den Außenposten Fort Western am Kennebecfluss, unserem ersten Ziel auf der Suche nach Jacob, irgendwo in der Wildnis Richtung Nord-Nordost.
Wir segelten entlang der schroffen felsigen Ostküste, die mich eher an die Azoren, als an das Amerika erinnerte, was ich vorhergesehen hatte. Der Eigner und Kapitän Mister Dwight war ein bärbeißiger Mann in den besten Jahren. Schweigsam stand er am Steuer seines Schiffes und ich hatte den Eindruck, dass er die Begegnung mit uns rein geschäftlich verstand. Schließlich sollte er uns nur ins Kennebectal bringen. Es war zu viel verlangt, von jedermann mit offenen Armen empfangen und mit bedingungsloser Wissbegier und Herzblut erdrückt zu werden. Es war Krieg in diesem Land. Wenn auch noch nichts davon zu merken war, außer der Militärpräsenz der Rotröcke in der Stadt wie die Indianer die Briten vornehmlich nannten. Entscheidend für den weiteren Verlauf der Expedition nannte uns Mr. Dwight den Namen des Mannes, den wir im Fort Western für unsere Belange ansprechen konnten. Peter, Hannes, Arian und ich standen gespannt um das Steuerrad der Adventure herum und horchten den Ausführungen, mit der sich der gleichgültig wirkende Kapitän viel Zeit ließ. Dann aber zweifelsohne erstaunliche Sätze formulierte:
„Sein Name ist Ernest Mansfield. Er hält sich als einer jener Pioniere dort auf, die als Wegbereiter der Zivilisation am Kennebec River anzusehen sind. Hin und her gerissen, zwischen Rot und Weiß, kennt man ihn im ganzen Tal des mächtigen Stromes. Sein Vater Jonathan Mansfield war der erste Weiße, der dort eine Handelsstation aufbaute und freundschaftlichen Kontakt mit den beheimateten Abenaki-Stämmen pflegte. Schon bald nach Gründung des Standortes verliebte er sich in eine der bronzefarbenen Schönheiten, die die Wilden zweifelsohne vorweisen können. Sie halfen beim Aufbau der Handelsstation, in der Hoffnung in Frieden leben zu können. Was blieb ihnen auch anderes übrig? Jonathan Mansfield brachte mit der Indianerin namens Sally-the-sun vom Stamm der Cussenock-Indianer den Sohn Ernest Mansfield, dem späteren Grenzgänger der Kulturen, hervor. Ernest oder auch Nightowl, so wie er im Kennebec Tal später ehrfürchtig genannt wurde, bringt euch vielleicht sogar selbst sicher über die Berge nach Kanada. Er ist der Mann für alles: Händler, Fallensteller, Pelzhändler, Fährtenleser, Postkurier und Kundschafter. Alles in einer Person!“
„Mr. Dwight, was meinen Sie mit Grenzgänger der Kulturen?“, wollten wir zwar alle wissen, doch Hannes, der gelassen seinen grauen dünnen Pferdeschwanz verknotete, traute sich prompt mit seinem gereiften Selbstbewusstsein als Ältester von uns diese Frage zu stellen. Sein Englisch hatte sich beeindruckend entwickelt, sodass er uns allein deshalb überraschte.
„Ein Halbblut hat halb weiße - halb rote Hautfarbe. Ein Halbblut ist, zumindest theoretisch, teils in der christlichen, wie andernteils in der indianischen Welt zuhause. So einfach ist das. Der arme Kerl kann ja nichts dafür!“ Verdutzt schauten wir uns an. Hatte Mr. Dwight Mitleid mit Mr. Mansfield, weil er ein Mischling war oder was meinte er?
„Ist er denn nicht reich an übergreifendem Wissen, kulturellem Bewusstsein und reichhaltigen Erfahrungen? Könnte er nicht Missverständnisse ausräumen?“, fragte ich Kapitän Dwight vorsichtig, der mich nicht verstanden hatte oder nicht verstehen wollte.
„Kann er denn nicht viel zur friedlichen Verständigung beider Völker und Lebensformen beitragen?“, formulierte ich den Satz um.
„Frieden wird es mit denen nie geben, Fremder! Und Mansfield wird eher das Problem haben, dass ihn niemand als halber Mensch akzeptiert, sondern er eben nur wegen seiner beruflichen Fähigkeiten zu Recht kommt!“, entgegnete Mr. Dwight zielsicher und blickte gleichzeitig selbstzufrieden über das Steuerrad der Adventure, als hätte er die Welt als einziger verstanden. Wurde er doch soeben in seinem seichten Umgang mit uns bestätigt, nämlich, das eine tief greifende Unterhaltung über das Land und die Leute mit diesen Fremden, also uns, sinnlos sei. Wir guckten uns an und hatten verstanden. Wenig später hörte Peter einer merkwürdigen Unterhaltung zwischen dem Kapitän und seinem Bootsmann zu. Piet hatte den Kapitän ablösen wollen. Kurzum fragte James Dwight ihn hinter vorgehaltener Hand. Ganz so wie kleine Kinder, die sich vor anderen interessant machen wollen. Dann brüllte er doch los, um gegen denn heulenden Wind, der in der Takelage der Adventure tanzte, gegen anzukommen.
„Sind die Ketzer aus Europa weit genug von der Ladung entfernt? Die müssen nicht alles sehen, was wir dabei haben!“
„Wieso sind es Ketzer, Kapitän. Sie sind doch keine katholischen Bastarde?“, sagte der Bootsmann verdutzt und James Dwight antwortete erneut in seinem speziellen Flüsterton, der alles andere als leise war.
„Sie sind fast noch schlimmer als die scheinheiligen Franzosen, denn sie haben gar keine Moral und glauben an nichts. Ich glaube auch nicht, dass sie in weiter Ferne ein Familienmitglied suchen. Vielleicht wollen sie unsere Truppenstärke am Kennebec ausspähen, wer weiß das schon? Wie soll ich ihnen da den Rücken zudrehen?“
Wir waren einen Moment sprachlos und schockiert.
„Würde der knochige Kapitän trotzdem sein Versprechen einhalten oder hatte er vor, uns irgendwo über Bord zu schmeißen?“, fragte Hannes und traf damit den Kern unserer Befürchtungen.
„Eigentlich müsste er doch seinem Freund Mr. Smith trauen, oder?“, meinte ich enttäuscht.
„Komisches Volk, diese Puritaner!“, beschwerte sich Hannes, „aber wir wollen hier sowieso keine Wurzeln schlagen, stimmt es?“
„Sie haben sich ihre kleine böse Welt aufgebaut und die Aufgeschlossenheit zivilisierter Leute abgelegt. Vielleicht sind sie zu viel alleine in der Wildnis!“, fügte Peter an und Arian nickte zustimmend.
„Die Besatzung der Adventure könnte uns auch für Saboteure halten, schließlich ist Krieg in Amerika! Also, lasst uns weiter geduldig unsere Aufgabe verfolgen und uns nicht weiter darum kümmern. Dann werden sie uns in Ruhe lassen“, sagte ich und hoffte, dass nun das Thema beendet wurde.
„Ein Auge sollten wir schon auf die Gesellen haben, Caspar!“, entgegnete Arian und alle nickten übereinstimmend.
„Das passiert von ganz alleine!“
Gewiss überforderte unsere Geschichte Mr. Dwight und seine gediegene Besatzung, warum wir nach Amerika gekommen waren. Sie hatten einfach Angst von Fremden in Kriegszeiten überrumpelt zu werden und später womöglich als Tollpatsche in Boston dazustehen. Dann war da noch der religiöse Faktor.
Gott sei Dank lernten wir Glaubensbrüder kennen, die wesentlich abgeklärter im Umgang mit Fremden waren. Auf der Suche nach dem Glück auf Erden und einem Leben in Frieden und Freiheit gehen die Menschen manchmal eigene Wege, die für Außenstehende gelegentlich unbegreiflich sind. Besonders wenn es sich um religiöse Strömungen handelt, die einem gänzlich unbekannt sind. Auch wir verlangten von den Fremden unsere Art und Lebenseinstellung zu tolerieren, ohne unseren Gästestatus hierzulande zu vergessen. Doch das gleiche Recht mussten wir Ihnen zugestehen und uns dementsprechend anpassen und benehmen.
Cape Elizabeth ist eine schmale bizarre Landzunge an der Atlantikküste, die als tapferer Vorposten des Kontinents ins tosende Meer hereinragt. Die dahinter liegende Fläche wird vor der starken Brandung und den meist stürmischen Winden durch die natürlichen Felsenwälle des Capes geschützt. Und da wollten wir hin. Wir hatten bereits Cape Elizabeth passiert und schon fast die Hafeneinfahrt vom Städtchen Falmouth erreicht, einer dieser Tage größten Fischereihäfen Maines wie man uns versicherte. Wir legten bei Ebbe an der gewaltig wirkenden Landungsbrücke an. Die mit Muscheln besetzten Holzbohlen verrieten den Wasserstand bei Flut, die auf einen mächtigen Tidenhub schließen ließ. Ich fragte mich, ob man hier überhaupt bei Flut anlegen konnte. In Falmouth sollte lediglich die Post getauscht werden. Auf dem von den Gezeiten gezeichneten Landesteg starrten die einheimischen Fischer unser Schiff an, ohne aus ihrer relativen Körperstarre wirklich zu erwachen. Nebenbei flickten sie unaufhörlich ihre Netze, trotz ihrer allgemeinen Bewegungsunfähigkeit. Wie sollte es nur jemals durchführbar sein, aus diesem unendlichen Netzknotengewirr Funktion und Ordnung wieder herzustellen? Dafür bewunderte ich die Fischer. Unsere Ankunft blieb nicht unbemerkt. Lauthals liefen einige Kinder auf der Seebrücke mit ihren grob geschnitzten Holzschuhen auf und ab. Dabei verfehlten sie jedes Mal nur knapp die ausgebreiteten Netze, die den meisten Platz der Seebrücke beanspruchten. Die Gebäude der königlichen Post und der Hafenmeisterei verdeckten die Sicht auf die kleine geschützte Stadt, die sich dahinter vor dem Brausen der See duckte. Lediglich der Kirchturm ragte hervor, während die gedrungenen Dächer der übrigen Häuser lediglich eigenwillige Schornsteine vorzuweisen hatten. Die Enden der Adventure wurden mühevoll von ein paar herbeigeeilten Gehilfen des Hafenmeisters vertäut, der zufrieden Pfeife rauchend dem Geschehen beiwohnte und wie ein Zuschauer nur zufällig da zu sein schien. Sie wussten, dass Kapitän Dwight nur kurz festmachen ließ. Die Fahrt zum Fort würde noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Die Fischer nahmen in beschaulicher Manier ihre Netze vom vereinnahmten Steg, damit die Postsäcke von Falmouth ihren Weg in die Welt finden konnten. Sie lagen auf einem Handkarren, der polternd zum Segler vom Postmeister geschoben wurde, der zusätzlich durch das Tragen einer eigenwilligen Uniform auffiel. Selbst die geschnitzten Holzschuhe der Kinder hatten dem Lärm der Karre nichts entgegen zu setzen. Auch Kapitän Dwight entledigte sich seiner für Falmouth bestimmten Post. Ich fragte Piet, warum auf einem großen Schild die Namen Machigonne, Casco und Falmouth zu lesen waren. Piet überraschte mich mit ortskundigem Wissen. Demnach war Machigonne ein befestigtes Dorf der Wampanoag-Indianer, die hier bis 1632 lebten. Die ersten Siedler hatten den Namen der Einfachheit halber übernommen. Doch die Wompanoag überließen den Weißen nicht kampflos diesen Ort. Sie brandschatzten ihn mehrmals und bald darauf hieß der neu entstandene Ort Casco, wie die gleichnamige Bay. Doch die Feuerbrunst machte auch in Casco keine Pausen und nach weiteren Angriffen der Wilden im Jahre 1658, wie er sagte, hieß der Ort Falmouth, der jedes Mal größer und schöner wieder neu aufgebaut wurde. Im Jahre 1675 wurde Falmouth nochmals im „König-Philips-Krieg“ komplett zerstört.“
Letztlich gingen auch aus diesem Krieg die Indianer als Verlierer hervor und verloren ihre Heimat, Identität und oft ihr nacktes Leben. Übrig blieben dann kleine Geschichten mit den nüchternen Fakten, die sich meist wie Grabsteine lesen lassen. Gelegentlich werden sie mit weißen Heldenepen ausgestattet, dann sind sie natürlich lebendiger und die jeweiligen Erzähler lassen ihrer Fantasie freien Lauf.
Sodann wendete sich der Bootsmann dem Hafenmeister zu und wechselte ein paar Worte zum Zwecke des raschen Informationsaustauschs. Ich stellte mir den Wortwechsel folgendermaßen vor:
„Ist die Welt da draußen noch in Ordnung? Lebt unser König noch? Haben wir die Rebellen endlich ins Meer gejagt? Hat der Teufel die Oberhand gewonnen? Bei uns ist hier alles in gewohnter Weise!“, sagte der Hafenmeister und der Bootsmann antwortete:
Dem König geht’s wohl gut. Der Krieg ist noch nicht gewonnen und der Teufel versucht immer wieder uns alle ins Verderben zu locken! Sonst ist auch bei uns alles in gewohnter Weise, so wie Gott will!“
Doch in der Post für den Bestimmungsort waren auch Zeitungen aus Boston, die die Provinz mit Informationen versorgten.
Im Anschluss steuerte der Kapitän bereits auf die Casco Bay zu, die mit kleinen üppig grünen Inseln und vielen Seevögeln auf waten konnte. Der Mannschaft der Adventure wurde das Manövrieren durch die natürlichen Hindernisse ziemlich erschwert. Doch man sah auch als gewöhnliche Landratte, als die ich mich trotz Navigationspatent verstand, dass die Männer darin geübt waren, ihr nächstes Ziel unfallfrei zu erreichen.
Hinterrücks der Bay säumten bizarre Felsformationen die Einfahrt zum Hafen von Bath, dem nächsten Ort unserer Weiterfahrt nach Fort Western. Dort erwartete uns die starke Strömung des Kennebecflusses mit seiner beeindruckenden Mündung, der sich an dieser Stelle in den Atlantik ergoss. Versteckt hinter mit Hemlocktannen und Weißkiefern bewaldeten Inseln und geschützt von der Brandung des Meeres tauchte das beschauliche Bath auf. Eine Siedlung von Fischern und Schiffserbauern, deren Vorfahren Abtrünnige von frühen Virginiakolonisten waren. Eine kleine Werft, sowie viele Fischerboote, Trockengestelle und Lagerstätten für Netze und Segel ließen erkennen, dass deren Gewerke noch heute das Leben der Bewohner von Bath bestimmten. Sechs Passagiere - Frauen und Kinder - warteten an der Landungsbrücke auf die Ankunft des Seglers aus Boston. Allerlei Gepäck auf der Landungsbrücke veranlasste den Kapitän, sein Schiff ordnungsgemäß zu vertäuen. Schnell sprach sich auf der Adventure herum, dass es sich bei den Passagieren um die Frauen der Offiziere in Fort Western handelte. Wollende Stolen, die bis zu den Hüften der Frauen reichten, verdeckten ihre Häupter. Nur ihre kleinen zierlichen Gesichter verrieten Frohsinn, Lebendigkeit und jugendliche Neugier, obwohl ihre jungen Jahre hinter ihnen lagen. Nach dem Tausch der Postsäcke und der Aufnahme der Passagiere kämpfte der Zweimaster gegen die starke Strömung des Kennebec, der sich wenig später überraschend zu einem gewaltigen Binnenmeer öffnete. Die Gaffelsegel des Schoners pusteten sich auf und bei voller Fahrt segelten wir unserem Ziel nun schneller entgegen. Am Ende des Binnenmeeres lag Fort Richmond. Von hier aus erfolgte vor drei Jahren die Erschließung des eigentlichen Tales im Norden, nachdem es dort zu Übergriffen durch Franzosen und Abenaki kam. Doch ein Halt war heute im Fort nicht geplant, das mit seiner Garnison vorzugsweise von der königlichen Marine versorgt wurde. Ein Weißkopfseeadler flog im Sturzflug unweit des Schoners der Wasseroberfläche entgegen, um blitzartig einen fetten Fisch zu greifen und die Beute in Windeseile fortzuschaffen. Noch ergriffen von dem Ereignis, nahm ich Kontakt zu den Passagieren auf, die zweifelsohne denselben Beutezug des mächtigen Greifvogels verfolgt hatten.
„Gestatten, mein Name ist Caspar Kock aus Hamburg. Das liegt in Europa auf der anderen Seite des … äh … Atlantiks. Es freut mich sehr, ihre Bekanntschaft zu machen.“
„Guten Tag, Herr Kock! Mein Name ist Katharina Weller, ehemals Goldmann. Ich komme aus Altona. Das ist in Europa!“ Ein sympathisches Lächeln aus dickem Tuch überraschte mit heimischer Zunge und weiblicher Spontanität. Ihre flinken grauen Augen funkelten und reflektierten das Sonnenlicht, das die Wasseroberfläche erhellte und wir sahen eine Frau, die uns für einen kurzen Moment sprachlos machte.
Das Eis war sofort gebrochen und wir lachten schon bald, wechselten die Sprache, lachten lauter und merken, dass die beiden anderen Frauen erstaunt schauten, weil sie unsere Sprache nicht verstanden, die eine Mischung aus Holsteinischem, dänischem und Hamburger Platt, sowie einigen Brocken von königlichem Amtsdänisch und schließlich Englisch war. Interessiert guckten die beiden anderen Damen mit erwartungsvollem Lächeln.
„Darf ich ihnen meine Freundinnen vorstellen, Herr Kock? Hier ist die Ehefrau des Kommandanten von Fort Western, Mrs. Rosalie Livingston und dies ist Mrs. Hester Jane Evans mit ihren drei Kindern.“
Wir machten uns bekannt, nachdem auch Arian, Hannes und Peter unser Kauderwelsch hörten und ich erfuhr, dass durch die Adventure die Offiziersfrauen in Fort Western bei ihren Männern bleiben werden. Die Festung Fort Western war erst 1754 entstanden, nachdem erkannt wurde, dass gegenüber den Franzosen eine klare Position im Tal bezogen und das Tal gesichert werden musste. Man brauchte die Zeit, um auch Quartiere für die Familien der Soldaten zu bauen. Doch nun, drei Jahre später, sollte es soweit sein und man wollte übermorgen die Fertigstellung der Behausungen in Fort Western gebührend feiern. Nachdem wir die Hintergründe unserer Reise erzählten, musste ich Mrs. Weller natürlich aus ihrer Heimat berichten, die nur einen Steinwurf von Hamburg entfernt lag, bevor sie ihre Geschichte von ihrer Ausreise erzählte:
„Lars Goldmann hatte von seinen Eltern einen kleinen Bauernhof am Stadtrand von Altona geerbt. Er warf nicht viel ab. Es reichte gerade zum Überleben für uns. Bald darauf sollte auf unserem Anwesen eine neue Kaserne für die königliche Garnison der Stadt gebaut werden. Lars weigerte sich heftig, den elterlichen Hof aufzugeben. Schließlich stellten die Unterhändler des Königs ein Ultimatum. Die Zeit verstrich gnadenlos. Wir führten heftige Diskussionen, ob weiterer Widerstand sinnvoll oder nicht sinnvoll sei. Doch schon allein wegen unserer Kinder musste bald eine Lösung her. Am entscheidenden Tag stand der Unterhändler mit einem großen Bautrupp und zusätzlichen Soldaten vor der Tür. Lars und ich sollten beeindruckt und eingeschüchtert werden, was ihnen leider auch gelang. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit das Nötigste zu packen. Ein Säckchen mit Goldmünzen reichte man uns, mit dem Hinweis, dass wir noch Glück hätten …“
„Dann war das keine freiwillige Entscheidung, sondern Erpressung!“, stellte Hannes fest und Katharina Weller fuhr schluchzend fort:
„Das Geld reichte, um über England die Überfahrt nach Boston zu bezahlen. Doch wie sich bald herausstellte, war es keine gute Idee von uns gewesen.“
Sie machte eine Pause. Mrs. Weller atmete schwer und große Tränen kullerten über ihre Wangen. Mrs. Evans legte ihren Arm um sie. Nach einer Weile hatte sie sich wieder gefangen. Ohne von uns gedrängt zu werden, erzählte Katharina weiter, während über unseren Köpfen eine laut schnatternde Schar Wildgänse flog:
„Meine beiden Söhne starben auf dem Schiff, noch bevor wir die amerikanische Küste sahen. Wir konnten sie nicht einmal vernünftig beerdigen ... und zwei Tage nach unserer Ankunft starb Lars an dem gleichen tödlichen Fieber …“ Mrs. Weller vergrub ihr zartes Gesicht an der Schulter von Mrs. Evans. Wir waren sehr bewegt, denn wer öffnete sich so schnell fremden Menschen gegenüber? Nun bot Mrs. Livingston ihre Hilfe an, indem sie den Rest der Geschichte erzählte:
„In Boston lernte Katharina meinen Vetter Kenneth Weller kennen. Schon bald hatte er mehr abgefallene Knöpfe an seiner Uniform, als es überhaupt nur möglich war. Später erfuhren wir, dass er auch die Uniformen der Kameraden in die Nähstube brachte! Zumal die Sachen eigentlich in der Kaserne geflickt werden. Doch dazu muss man wissen, dass die hübsche Katharina Goldmann mit ihrem allerletzten Geld aus Altona eine kleine Nähstube eröffnet hatte, die sie erfolgreich in der Stadt betrieb. Jedermann wusste von ihrem Schicksal und so war es nicht verwunderlich, dass vor allem Männer sie aufsuchten, auch um ihr einen Höflichkeitsbesuch zu machen. Seit nunmehr zwei Jahren sind Kenneth und Katharina glücklich verheiratet.“
„Was wurde aus der Nähstube?“, fragte Peter spitzbübisch.
„Die habe ich vor einem halben Jahr verkauft. In der neuen Heimat am Kennebec geht die Kleidung auch kaputt, da bin ich ganz sicher!“, antwortete Katharina selbst, nachdem sie die Flut ihrer Tränen überwunden hatte.
„Ihr Mann Kenneth ist zu beneiden, eine so starke Frau an seiner Seite in der Wildnis. Meinen Respekt, Frau Weller!“, schmeichelte Arian seiner ehemaligen Landsmännin mit friesischen Obertönen, die seiner Sprache eine schöne Färbung beimischte.
„Wir sind da!“, schrillte Mrs. Livingston und schaute halb links auf eine Bucht, die mit meinen Augen so aussah wie alle anderen auch. Hannes und Peter liefen mit den Kindern von Mrs. Evans zum Bug, während die Matrosen routiniert die Segel des Schoners strichen. Auf der Backbordseite sah ich langsam die Umrisse einer Flussmündung, die mit dem breiten Kennebec zusammentraf und in ihrer Mitte eine stattliche Landzunge bildete. Die Gestade waren mit einer Anlegestelle samt Brücke überbaut, die den regionalen Schiffsverkehr aufnehmen konnte. Ein Schoner, mehrere Schaluppen mit einfachen Masten, Hausboote und flache Lastensegler, die für die Weiterfahrt zum Fort Halifax geeignet waren, lagen hinter dem Anleger. Eine breite Brücke und Holzstege führten zu den höher gelegten Bereichen des befestigten Ufers, sodass bei Hochwasser die Füße zum Fort trocken blieben. Nun sah ich auch die Umrisse des Forts, die aus dem nahen Wald schwer erkennbar wurden. Aufrecht in den Boden gerammte grobe Holzpfosten bildeten die Begrenzung der Anlage, während Gebäude, Türme, Lagerhäuser und ein lang gezogenes Haupthaus zu sehen, beziehungsweise zu erahnen waren. Die Kinder von Mrs. Evans konnten das Anlegemanöver gar nicht abwarten und turnten gefährlich nah an der Reling des Schiffes herum, bis Piet sie ermahnte. Ich sah mich um und stellte fest, dass die Uferbereiche überall bewaldet waren. Hier hatten die Menschen noch keine großen Felder zum Anbau von Feldfrüchten geschaffen. Alles schien noch in dem ursprünglichen Zustand zu sein. Auf der Brücke zum Ufer bemerkte ich zahlreiche Kanus, die unterhalb auf dem angespülten Sand nebeneinander wie die Hühner auf der Stange dalagen. Sie waren von gleicher Bauart wie die Baumrindenkanus, mit denen ich selbst beinahe quer durch Kanada paddelte. Nach zwei Tagen Seefahrt auf der Adventure hatten wir unser erstes Etappenziel erreicht. Nun kam es darauf an, hier die richtigen Leute zu treffen, nachdem wir uns von Mr. Dwight und seiner Besatzung erholt hatten.
D. Die Neue Welt – Caspars Route