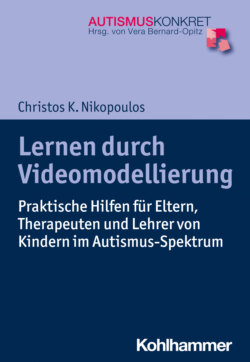Читать книгу Lernen durch Videomodellierung - Christos K. Nikopoulos - Страница 9
1 Definition der Videomodellierung (VM)
ОглавлениеUm die Bedeutung von VM zu verstehen, müssen wir uns mit dem Lernen am Modell befassen, denn hierauf beruht diese Methode. Beim Modellernen wird ein bestimmtes Verhalten des Kindes dargestellt und das Verhalten des Beobachters anschließend danach beurteilt, ob es vergleichbares Verhalten wie das Modell zeigt oder nicht (Martin & Pear, 2017). Modellernen findet statt, wenn der Beobachter das Verhalten des Modells nachahmt. Theoretisch gesehen kann die Modellvorgabe als Auslöser betrachtet werden, mit der Stimuluskontrolle über das Verhalten des Beobachters ausgeübt wird. Da das Verhalten des Beobachters schon nach einer einzigen Modellvorgabe verändert werden kann (Deguchi, 1984), kann dies ein wirkungsvolles Mittel sein, um sowohl neue Verhaltensweisen zu erlernen wie auch bereits erworbene zu verbessern. Eine einfache Definition von VM ist die folgende: Ein Kind-Beobachter verändert sein Verhalten entsprechend der Vorgabe eines Modells auf einem Video. Darüber hinaus »bietet VM einen Anstoß und eine Vorbereitung für eine zukünftige Aktivität oder Aufgabe des Beobachters« (Wang & Koyama, 2014, S. 747). Andere Autoren haben betont, dass »VM eine Instruktionstechnik ist, bei der Individuen ein kurzes Video eines Modells (z. B. Erwachsener, Gleichaltriger, Selbst) ansehen, das eine Abfolge von Schritten eines bestimmten Zielverhaltens ausführt. Anschließend wird es angewiesen, die beobachteten Schritte selbst auszuführen« (Gardner & Wolfe, 2013, S. 74). Bei der VM werden verschiedene Medien eingesetzt, wie z. B. Fernsehbildschirme (Shipley-Benamou et al., 2002), Computer (Ayres & Langone, 2007), Videospiele (Blum-Dimaya et al., 2010), DVD-Spieler (Mechling, Gast & Fields, 2008) und persönliche digitale Assistenten (PDAs) (Mechling & Ayres, 2012). Durch die leichte Verfügbarkeit verschiedener Darbietungsformen ist VM für viele Nutzer attraktiv und entwickelt sich zunehmend zu einem beliebten Lernmittel. Modell beim VM kann eine gleichaltrige Person, ein Geschwisterteil oder ein Elternteil sein (z. B. Sani-Bozkurt & Ozen, 2015). Daneben kann sich eine Einzelperson bei der Video-Selbstmodellierung (VSM) selbst dabei beobachten, wie sie ein bestimmtes Verhalten oder eine Aufgabe ausführt, die über ihr aktuelles Funktionsniveau hinausgeht (Gelbar et al., 2012; Bellini & Akullian, 2007).
Unter den vielen Vorteilen scheint VM im Vergleich zur In-vivo-Modellierung weniger zeitaufwendig zu sein (Rayner, Denholm & Sigafoos, 2009). Es zeigte sich auch, dass VM im Vergleich zu anderen Therapiestrategien weniger Erfahrung bei der Umsetzung erfordert und kostengünstiger ist. Darüber hinaus beschleunigt es den Erwerb von Fähigkeiten bei Kindern mit ASS (Sigafoos, O’Reilly & De La Cruz, 2007).
Nachdem ein Videomodell einmal erstellt wurde, kann es mehrfach eingesetzt werden. So können die Übungsmöglichkeiten eines Kindes verbessert und eine größere Selbständigkeit angebahnt werden. Hierdurch wird die kontinuierliche Beaufsichtigung durch einen Therapeuten verringert (Wang & Koyama, 2014).
Wenn man VM in der Therapie mit autistischen Kindern einsetzt, sollte man, wie schon von Nikopoulos und Keenan (2006) ausgeführt, die folgenden fünf Voraussetzungen berücksichtigen:
Erstens kann der Beobachter das Verhalten des Modells nur dann erfolgreich imitieren, wenn dieses neue Verhalten dem aktuellen Wissensstand des Beobachters um ein oder zwei Schritte voraus ist. Wenn das Verhalten eines Modells ihm demgegenüber mehrere Schritte voraus ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass der Beobachter ein ähnliches Verhalten erfolgreich durchführen kann (Baldwin & Baldwin, 1986).
Zweitens muss der Beobachter in der Lage sein, das Verhalten des Modells zu beobachten, um dasselbe oder ein ähnliches Verhalten zu zeigen (Miltenberger, 2015). So kann es in einer Therapiesitzung sinnvoll sein, dass das Kind sitzen bleibt, aufmerksam ist und den Therapeuten ansieht, wenn es gerufen wird. Das Kind sollte auch die gezeigten Gegenstände ansehen.
Drittens ist es wahrscheinlicher, dass der Beobachter die modellierte Reaktion imitiert, wenn er sieht, welche Konsequenzen auf die Modellvorgabe folgen. Die Konsequenz auf ein Modellverhalten kann auch für spätere Imitationen des Beobachters als diskriminativer Hinweis dienen. Wenn zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten zu unterschiedlichen Konsequenzen für das Modell und den Beobachter führt, ist es wahrscheinlich, dass der Beobachter das Modell weniger nachahmt. Generell gilt, dass man dazu neigt, das zu tun, was für einen selbst am besten ist, unabhängig von dem, was für das Modell galt (Deguchi, 1984).
Viertens muss das gezeigte Modellverhalten mit der aktuellen Kompetenz des Beobachters übereinstimmen. Wenn der Beobachter ein ziemlich komplexes Verhalten nachahmen muss, das Fähigkeiten erfordert, über die er nicht verfügt, ist es wahrscheinlich, dass der Beobachter das Modell nicht beachtet (Kazdin, 2001).
Schließlich erhöht eine frühere Verstärkung für die Imitation eines bestimmten Modells die Wahrscheinlichkeit, das modellierte Verhalten auszuführen, wenn diskriminierende Stimuli und Kontexte den früheren Settings ähnlich sind (Nikopoulos & Keenan, 2006).