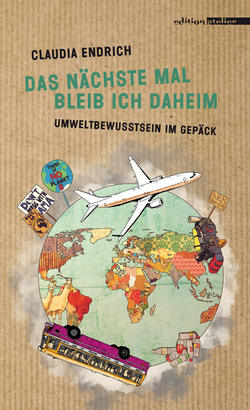Читать книгу Das nächste Mal bleib ich daheim - Claudia Endrich - Страница 14
EXCHANGE STUDENTS
ОглавлениеNun habe ich die magische Grenze, die ich selbst festgelegt habe, erreicht: Seit zehn Wochen lebe ich in Lima. Ich habe ein paar Ausflüge in andere Ecken dieses immensen Landes gemacht, doch Lima ist nun seit mehr als zwei Monaten mein Zuhause. Für Tom ist es bereits der siebte Monat, den er hier verbringt, und dementsprechend ist für ihn das meiste schon viel länger Routine als für mich. Bevor ich angekommen bin, hat er in einer großen WG voller Austauschstudenten gelebt. Er war etwas enttäuscht, keine WG peruanischer Studenten gefunden zu haben, aber die wohnen meistens noch zu Hause oder in Wohnheimen und ziehen erst in eine Wohngemeinschaft, wenn sie zu arbeiten beginnen. Ich habe Toms alte WG und ein paar der dort Wohnenden irgendwann kennengelernt und fühlte mich sehr an meine eigenen Austauschsemester erinnert. Egal ob WG oder Studentenwohnheim, die Welt der Exchange Students ist ein eigener kleiner Mikrokosmos. Gleich vorweg: Ich werde kein schlechtes Wort über jeglichen Studierendenaustausch verlieren. Projekte wie Erasmus sind Grundsteine einer modernen, offenen Gesellschaft. Wenn ich irgendjemandem Flüge erlauben möchte, dann Austauschstudenten – zumindest jenen, die auf dem Landweg nicht an ihr Ziel gelangen können. Dank Erasmus & Co. fühlen Menschen meiner Generation sich mehr als einer Nation zugehörig, gründen internationale Familien und sprechen mehrere Sprachen fließend. Erasmus hat es mir ermöglicht, ein Semester lang in Frankreich zu leben und mich selbst und die Welt neu kennenzulernen. Ironischerweise habe ich an einem europäischen Austauschprogramm teilgenommen, flog dafür aber elf Stunden Richtung Süden: Die Kolonialgeschichte Frankreichs macht es möglich, gibt es doch mehrere französische – und damit europäische – Inseln in den Weltmeeren, weit weg von Europa.
Die Ankunft auf einer dieser Inseln war für mich zuerst ein Schock – alles war anders, alles war fremd, zum ersten Mal in meinem Leben war ich völlig allein. Ich war überfordert und heulte mich am ersten Abend in den Schlaf. Doch schon am zweiten Tag wurde ich aufgefangen, ich lernte andere Exchange Students kennen, orientierte mich auf dem Campus, alles wurde schnell einfacher. Und wie so oft konnte ich mir nach wenigen Monaten kaum vorstellen, wieder wegzufahren. Ich hatte Freunde aus aller Welt gefunden, sprach inzwischen fließend Französisch, hatte Einblick in völlig andere Lebensrealitäten gewonnen und war beim Tiefseetauchen über die bisherigen Grenzen meines Mutes hinausgewachsen. Exakt zur Zeit meines Erasmus-Semesters veröffentlichte die ZEIT einen hoch umstrittenen Kommentar mit dem Titel »Erasmus, Orgasmus!«, in dem die allseits bekannten Exzesse von Austauschstudierenden hochgelobt wurden, denn sie stiften (europäische) Identität und seien damit viel wichtiger als gute Studienergebnisse.6 Sogar die Ärztin in Wien, zu der ich ging, um die notwendigen Impfungen zu erhalten, empfahl mir anstelle von aufwendigen Impfungen gegen tropische Viren vor allem einen Schutz gegen sexuell übertragbare Krankheiten. Zu diesem Zeitpunkt musste ich darüber sehr lachen, schließlich hatte ich keineswegs vor, während meines Austauschsemesters zur Nymphomanin zu mutieren. Und trotzdem, obwohl ich es absolut nicht geplant hatte, habe ich dann doch das bekannte Klischee gelebt: unglaublich viel gefeiert und mich hemmungslos sexuell ausprobiert. Warum tun das so viele genau im Ausland? Weil es egal ist, wer es mitbekommt. Weil du dich von Tag eins an neu erfinden kannst, weil niemand bereits eine Meinung von dir hat und weil du dir auch genüsslich ein furchtbares Image zulegen kannst, denn diese Leute wirst du in ein paar Monaten nie wiedersehen, wenn du es nicht willst. Und dann stellen viele erstaunt fest, dass sie Freunde finden, obwohl sie sich so ungeniert verhalten. Genauso ging es auch mir, und genau das hat mich nachhaltig verändert. Doch auch die gegenteilige Erfahrung war prägend: Ich war genauso oft allein, einsam und gelangweilt, was vielleicht sogar das Wichtigste war. Jede einzelne Erfahrung war unglaublich wichtig, um mich so selbstständig, mutig und frei zu machen, wie ich mich heute fühle. Die Veränderung war deutlich spürbar, als ich am Ende des Semesters einen besonderen Besucher auf der Insel empfing: meinen Vater. Zwei Wochen lang führte ich über seine neueste Abenteuerreise Regie, übersetzte Gespräche, plante Ausflüge und erklärte ihm Orte, die ihm völlig fremd und mir total vertraut waren. Er war sichtlich stolz auf mich, doch manches Mal schien ihm die neue Claudia nicht ganz geheuer zu sein. Ich genoss es, meine neu gewonnene Freiheit vor ihm zur Schau zu tragen. Besonders denkwürdig war der Moment, als ich meinem Vater eines Abends einen Joint anbot und dabei entspannt in seine vor Entgeisterung aufgerissenen Augen blickte. Ich konnte darin förmlich seine Gedanken lesen: »Ist das noch mein kleines Mädchen?« Nachdem er den ersten Schock verdaut hatte, nahm er das Angebot an. Meine Freunde und ich zerkugelten uns wenig später vor Lachen – nicht nur, weil wir zu viel geraucht hatten, sondern auch, weil mein Vater bereits am Tisch eingeschlafen war.
Wie sollte es anders sein, natürlich hatte ich mich während meines Erasmus-Aufenthalts auch verliebt. Die folgende Geschichte halte ich selbst bis heute für zu kitschig, um tatsächlich ernst genommen zu werden. In einem Tanzworkshop meiner Austauschuniversität traf ich einen Tänzer aus Mosambik, ein durchtrainierter Adonis mit kurzen Rastalocken und schwarzen Augen, deren Blick mich schon bei unserer ersten Begegnung zu durchdringen schien. Er sprach kein Französisch, nur Portugiesisch und Englisch, was uns vollkommen ausreichte. Er war nur für einen Monat wegen eines Engagements als Tänzer auf der Insel und wir verbrachten diese Zeit leidenschaftlich, verliebt und voller Hoffnung, irgendwie eine Zukunft zu haben. Als er abreisen musste, vergossen wir beide viele Tränen, doch wir schworen uns, alles zu versuchen, um wieder zueinanderzufinden. Als ich nach Österreich zurückkam und meinen Freunden von ihm erzählte, hagelte es uralte Scherze. »Pass auf Claudia: Once you go black, you never go back!«, »Und, war er wirklich so groß wie alle behaupten?« Auch das gehört zur Erfahrung, im Ausland zu leben: zurückkehren und sich sehr missverstanden fühlen. Mein Traummann und ich blieben in Kontakt, doch die Leidenschaft ließ nach, und bald wurde klar, dass unser Wunschdenken aussichtslos war. Ich hatte zu konkrete Pläne, um Österreich wieder zu verlassen, er hatte nicht die Mittel, um zu mir zu kommen. Trotzdem konnte ich ihn nie ganz vergessen. Völlig unverhofft, mehr als ein Jahr später, bekam ich die Gelegenheit, ihn wiederzusehen. Er hatte ein Engagement an einer Tanzschule in der Schweiz bekommen. Ich war völlig fertig mit den Nerven, als wir ein erneutes Treffen vereinbarten. Ich malte mir die verrücktesten Dinge aus und hoffte so sehr, dass meine kleine Seifenblase von der unendlichen, leidenschaftlichen Liebe zwischen uns diesmal nicht platzen würde. Sie platzte nicht – zuerst. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich sah, was ich sehen wollte. Dass er immer noch schön war, dass er immer noch gut küsste und liebte, dass wir immer noch viel Spaß miteinander hatten und reden konnten. Davon abgesehen aber hatten wir ganz andere Vorstellungen vom Leben, doch das sah ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Schlussendlich musste ich mich nie damit auseinandersetzen, denn nur wenige Wochen später verließ er mich für eine italienische Primaballerina. Es tat weh und gab mir gleichzeitig die Erlaubnis, ehrlich mit mir selbst zu sein: In Wahrheit hatte ich mich auch aus Exotismus in ihn verliebt, weil einfach alles an ihm und seinem Leben anders war. Wahrscheinlich hatte er das Gleiche empfunden, womöglich ging es ihm mit seiner neuen Flamme genauso. Kaum etwas ist so reizvoll wie das Fremde, ein Mensch, der anders aussieht, anders spricht, anders aufgewachsen ist. Unsere Welt heute macht es glücklicherweise möglich, dass diese Differenzen oft keine Hindernisse mehr für Beziehungen sind. Mir ist es lieber, von Fremdem fasziniert zu sein als Angst davor zu haben. Doch so zu tun, als würde diese Faszination für eine lebenslange Beziehung ausreichen, ohne auch andere Qualitäten in ihr zu finden, ist verblendet. Und so entscheidet sich bei den meisten Beziehungen, die auf Reisen oder während des Studienaustausches entstehen, irgendwann danach im heimischen Alltag, ob die Liebe mehr aushält als ein paar sorgenfreie Wochen unter Palmen.
Bestimmt machen nicht alle die gleichen Erfahrungen während ihres Studienaustausches. Alles bleibt eine Frage davon, wie sehr man sich auf das neue Umfeld einlässt. Zu Weihnachten nach Hause fliegen – wozu? Erstmals hast du die Gelegenheit, ein anderes Weihnachtsfest kennenzulernen. Stille Nacht, heilige Nacht kannst du in den nächsten Jahren noch oft genug singen. Aus anderen Gründen dazwischen noch mal einen Abstecher nach Hause machen ist ebenfalls Quatsch. Sich ganz auf sich alleine gestellt fühlen kann nur dann voll einschlagen, wenn ich auch wirklich nicht nach Hause zu Mami laufe, und sei es auch manchmal hart.
Austauschsemester können aber natürlich genauso gut ohne Drogenrausch und Liebschaften aus dem Groschenroman ablaufen, sondern sich ganz zahm abspielen. Dafür war meine Zeit in Kanada der beste Beweis. Für den typischen alternativen Globetrotter auf der Suche nach Abenteuer ist Kanada erst mal kein spannendes Reiseziel: Es ist teuer, es ist gut organisiert, es ist friedlich, es hat Justin Trudeau. Die meisten würden lieber dort sesshaft werden, als nur einen Zwischenstopp zu machen. Ich entschied mich also, nach längst verjährten Erasmus-Orgasmen mein zweites Auslandssemester in der überschaubaren kanadischen Klein- und Hauptstadt Ottawa zu verbringen. Ich ging mehr als entspannt in diese Zeit, denn: Auslandsaufenthalte kannte ich, die gängigen Sprachen beherrschte ich perfekt und überhaupt fühlte ich mich allem und jedem überlegen. Kulturelle Differenzen würde es wohl keine geben, dachte ich mir, und tatsächlich, das Seltsamste war meist, wie furchtbar viel furchtbar dünnen Kaffee die Kanadier trinken. Die Zeit wurde für mich vor allem eine Erfahrung des Alleinseins, der Disziplin und der fleißigen Arbeit. Sowohl das Niveau der kanadischen Universität als auch meine eigene Abschlussarbeit forderten mich sehr. An meinen freien Wochenenden lernte ich trotzdem erneut großartige Menschen kennen, entdeckte leckere Märkte und tolle Sportmöglichkeiten und fühlte mich binnen der inzwischen bekannten zehn Wochen ganz wie daheim. Ich hatte mich bewusst gegen eine Studenten-WG entschieden, hielt ich mich doch inzwischen für zu alt und erwachsen für chaotische Buden, in denen ständig gefeiert wird. Stattdessen zog ich zu einer einsamen alten Cat Lady in ihr adrettes Vorstadthäuschen im Kolonialstil und freute mich auf hochintellektuelle Gespräche mit der weitgereisten Dame. Die Haupterkenntnis, die ich am Ende zog, war, dass ich vor der übertrieben freundlichen, furchtbar komplizierten alten Dame und ihren fauchenden Katzen wann immer ich konnte in die WGs meiner Freunde flüchtete. So alt war ich dann wohl doch noch nicht. Und so grauenhaft würde ich hoffentlich niemals werden.
Am Ende meiner Zeit in Kanada konnte ich sogar mein Fazit routiniert ziehen: Auch diese Reise hatte mir viele Selbsterkenntnisse beschert und war für mich eine wahre Bereicherung gewesen. Doch nun drängte sich mir eine neue, selbstkritische Frage auf: Was hatte mein Auslandsaufenthalt den Menschen in Ottawa oder der Gesellschaft insgesamt gebracht? Bis auf das völlig nichtssagende Ergebnis meiner überkomplexen Masterarbeit und meine Teilnahme an einer Charity-Sportveranstaltung fällt mir wenig bis gar nichts ein. Ein Freiwilligenengagement hätte sich für die wenigen Monate nicht gelohnt, war ich überzeugt: Bis du dich auskennst, musst du wieder weg. Bei den Hochschülerschaftswahlen an meiner Universität habe ich auf mein Stimmrecht verzichtet, denn während man seine Koffer packt noch solche Entscheidungen mitzutreffen, erschien mir unfair. Wer durch die Welt zieht, ist selten Teil eines Systems, sondern eine freischwebende Einheit mit losen Enden. Für manche mag das wie ein Traum klingen, ich hatte bei meiner Abreise aus Ottawa endgültig genug davon.
Und nun, nach zehn Wochen purer Freizeit in Lima, sehne ich mich nach Alltag. Ich habe mich tatsächlich in den vergangenen Wochen wieder etwas verloren gefühlt und nicht recht gewusst, welche Aufgabe ich mir hier suchen soll. Ein freiwilliges soziales Engagement? Ein ganz normaler Job, in einer Bar oder in einem Hostel? Einfach privat Sprachen unterrichten? Oder doch beginnen, ein Buch zu schreiben? Ich bin absolut unschlüssig. Ich weiß, dieses Gefühl könnte mich in dieser Lebensphase, nach dem Abschluss meines Studiums, in Österreich genauso ereilen wie hier in Peru. Doch das Wissen, dass ich von hier in drei Monaten schon wieder wegziehen werde, macht meine Orientierungslosigkeit nur noch größer. Ich fühle mich immer noch wie diese freischwebende Einheit mit unzähligen losen Enden. Die losen Enden reichen inzwischen auf vier verschiedene Kontinente, überall habe ich angefangene Freundschaften, Netzwerke, nützliches Wissen, Routinen und Möglichkeiten, mich in die Gesellschaft einzubringen, zurückgelassen. Hier in Lima ist meine einzige feste Verbindung immer noch Tom. Die Vorstellung, mich in nächster Zeit zu Hause einzuigeln, macht mich genauso wahnsinnig wie die Idee, wieder mit dem Aufbau von Kontakten von vorne zu beginnen, nur um dann alles in drei Monaten wieder in die Tonne schmeißen zu müssen. Wie ist das bloß passiert, dass mein größter Traum, die Welt zu bereisen und mir auf jedem Kontinent ein kleines Zuhause zu schaffen, zu einer schrecklichen Drohung mutiert ist? Wie kann ich es mir überhaupt erlauben, so über eine Chance zu denken, von der viele ein Leben lang träumen, ohne die Möglichkeiten zu haben, sie in die Tat umzusetzen? Bin ich inzwischen über-reist?
6 DIE ZEIT Nr. 10/2012. www.zeit.de/2012/10/C-Erasmus (06.01.2019)