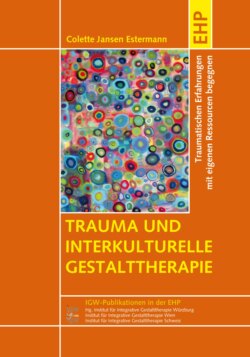Читать книгу Trauma und interkulturelle Gestalttherapie - Colette Jansen Estermann - Страница 11
Оглавление1. EINFÜHRUNG
1.1 Motivation
Das vorliegende Buch besteht aus einem Versuch, mitten im Prozess einen Moment anzuhalten, um aus einer gewissen Distanz zu beschreiben, was ich wahrnehme und spüre. Ich werde einzelne Bilder, Gefühle, Erlebnisse und Begegnungen aus meinem Erfahrungsschatz hervorholen, nochmals genau betrachten und dann wieder aufheben. Das Schreiben macht mir Spaß, es ist ein Stück Verarbeitung und meine Art, einer stellvertretenden Traumatisierung vorzubeugen. Zudem gehe ich davon aus, dass meine Befunde den Lesern und Leserinnen1 nützlich sein werden. Es ist mir wichtig, dass die Menschen in Bolivien von den Menschen am anderen Ende der Welt nicht vergessen und in ihrer Andersartigkeit verstanden werden. Dieses Buch ist einerseits das Ergebnis eines Forschungsprojektes zum Thema »Traumatische Erfahrungen und eigene Ressourcen jugendlicher Studierender in den Städten La Paz und El Alto in Bolivien«, das 2009 in eine Dissertation mündete und bereits auf Spanisch herausgegeben wurde (Jansen Estermann 2010). Andererseits beinhaltet es eine Zusammenfassung meiner persönlichen und beruflichen Erfahrungen als Gestaltpsychotherapeutin und Ausbildnerin während einer Zeitspanne von 15 Jahren in Lateinamerika.
Was mich damals bewegt hat, zuerst nach Peru und später nach Bolivien auszureisen, vermag ich nicht eindeutig zu erkennen. Im Nachhinein denke ich mir, dass der Stachel der Ungerechtigkeit und der Hang zum Abenteuer eine gewisse Triebfeder waren. Im Laufe der Zeit kam noch dazu, dass ich mich in Lateinamerika wie ein Fisch im Wasser fühle. Dies hat mit der zwischenmenschlichen Kommunikation zu tun, der Herzlichkeit und Körpernähe. Ich habe niemals erwartet, dass ich in La Paz ein Forschungsprojekt vorantreiben, den Doktor machen, einen Studiengang in ›Psicoterapia Gestáltica‹ aufbauen und eine Stiftung für Gestalttherapie gründen würde. Da kann ich nur staunen und es erfüllt mich eine große Dankbarkeit. Ich gehe davon aus, dass ich im richtigen Augenblick am richtigen Ort war – Kairos. Es waren aber die Menschen in La Paz, die positiv auf mein Angebot reagiert haben. Gemeinsam konnten wir in Übereinstimmung mit ihren Bedürfnissen dies alles erreichen. So haben sich die vereinzelten Puzzleteile des Lebens zu einem wunderbaren Netzgewebe gefügt. Dennoch möchte ich nicht verschweigen, dass die Entscheidung, trotz aller Fremdheit und Frustration über längere Zeit vor Ort weiterzumachen, auch sehr viel Kraft und Ausdauer gefordert hat.
Dieser langjährige Aufenthalt in einem fremden Kulturkreis hat mir aber die einmalige Chance gegeben, meinen unbewussten ›Introjekten‹ auf die Spur zu kommen. Mit diesem gestalttherapeutischen Begriff meine ich meine verschluckten, verinnerlichten Modelle oder anders gesagt, die Regeln, Normen, Vorgaben, geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze in unserer (europäischen) Umwelt (Hartmann-Kottek 2004: 266). Dieser allmähliche Bewusstwerdungsprozess, bei dem ich am eigenen Leibe erfahren musste, dass meine Selbstverständlichkeiten nur manchmal unter ganz bestimmten Umständen gegeben sind, war mühsam und schmerzhaft. So wird ›Freundschaft‹ oder ›Sicherheit‹ im bolivianischen Umfeld anders erlebt, als ich sie vorher gewohnt war. Das Lebensgefühl in Bolivien und die Bedeutung vieler Ausdrücke unterscheiden sich erheblich von denen in Deutschland, Holland oder der Schweiz. Die vorherrschenden Gewohnheiten in Bolivien sind nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Gleichzeitig hat die Relativierung und sogar Zerstörung meiner Introjekte sehr befreiend auf mich gewirkt und schließlich zu mehr bewusster Selbstbestimmung geführt.
Der horizontale Dialog nach dem Ich-Du-Prinzip von Martin Buber stellt für mich in diesem interkulturellen Kontext nach wie vor eine spannende Herausforderung dar. Denn erstens sind die Verhältnisse unvorstellbar schräg. Während ich z. B. zu jeder Zeit nach Europa zurückkehren könnte, kann mein Gegenüber höchstens ein Touristenvisum beantragen, vielleicht bekommt er jedoch nicht einmal das. Zweitens bin ich nicht nur in meiner Tätigkeit als Psychotherapeutin, sondern auch als weißhäutige ausländische Frau in Bolivien eine ständige Projektionsfläche. Ob es zutrifft oder nicht: Ich werde hier aufgrund des in den Fernsehserien vermittelten Bildes einer Gringa als reiche, gut geschulte und privilegierte, gleichzeitig naive und sexuell freizügige Person gesehen, die leicht übers Ohr zu hauen ist, zu einem gewissen Vorschussvertrauen oder zu beruflichem Neid Anlass gibt. Drittens passieren immer wieder kleine, ungewollte und gegenseitige Verletzungen im Kontakt. So war die Frage einer unbekannten Person bei einem Fest, wann ich denn wieder fortgehe, wahrscheinlich gar nicht verletzend gemeint, da es in La Paz wegen der zahlreichen Botschaften und NGOs (Non-governamental organizations) von ausländischem Personal wimmelt, das etwa alle drei Jahre ausgewechselt wird.
Obwohl Gestalttherapeuten als Kontaktspezialisten gelten, hinterfrage ich regelmäßig mich und meine berufliche Wirksamkeit in einer Umgebung, die mir wohl immer fremd bleiben wird. Es gibt solche eigenartigen Gewohnheiten und Ausdrücke, die ich auch nach anderthalb Jahrzehnten in Lateinamerika noch nicht ganz verstehe. Zudem gelingt es den Menschen hier ziemlich oft, mich zu überraschen. Folglich gehe ich möglichst offen auf sie ein, hake immer wieder bei einem Wort oder einer Geste nach und bin ständig darauf bedacht, sie nicht zu vereinnahmen. Im Grunde genommen habe ich gerade als europäische Gestalttherapeutin in Bolivien eine spezifische Rolle und Aufgabe. Indem ich nämlich den Menschen zuhöre, ohne mir ein Urteil anzumaßen, ihnen mit tiefem Respekt begegne und mich auf die gleiche Ebene stelle, gebe ich ihnen gleichsam zurück, was die Conquistadores ihnen – neben dem Gold und Silber – weggenommen haben: das Vertrauen in sich selbst, in die eigene Kraft und besondere Fähigkeiten.
1.2 Die Geschichte Boliviens
Das Leben in Bolivien sieht anders aus als das in Europa, es spielt sich unter anderen Bedingungen und Umständen ab. Mir scheint es notwendig, den Kontext gleich am Anfang dieses Buches zu schildern, weil eine Figur ohne klaren Hintergrund nicht deutlich wahrgenommen werden kann – eine Erkenntnis, die aus der Gestaltpsychologie stammt. Ein echtes Verständnis der Resultate des Forschungsprojektes und meiner persönlichen bzw. beruflichen Erfahrungen in Bolivien ist nur aufgrund eines Wissens um dessen Geschichte und aktuelle Gesellschaft möglich. Zahllose Gegebenheiten, heftige Emotionsausbrüche, extreme Meinungen und Konflikte in der Gegenwart,2 die in den Augen eines Außenstehenden völlig unverständlich und irrational erscheinen, lassen sich größtenteils aus der Vergangenheit und dem zeitgenössischen sozio-politischen und wirtschaftlichen Kontext erklären.
Interessanterweise haben die bolivianischen Schulkinder ein Pflichtfach, das inhaltlich unter anderem aus dem Studium der Französischen Revolution besteht, während die Kinder in Europa in der Schule doch eher selten etwas über die Zeit der Militärdiktatur in Bolivien erfahren. Die heutige Regierung hat sich erst neulich zum Ziel gesetzt, das Erziehungswesen und überhaupt die öffentlichen Einrichtungen zu »entkolonialisieren«, wie sie selbst diesen politischen Schritt bezeichnet. In diesem Sinne war ich erstaunt, als ein Mitglied der Forschungsequipe,3 das ich beauftragt hatte, die Geschichte und aktuelle Lage seines Landes zu resümieren, mir eine trockene Abhandlung aufeinander folgender Epochen überreichte. Aus irgendwelchen Gründen hatte er keine einzige der haarsträubenden geschichtlichen Ungerechtigkeiten erwähnt und keinen einzigen der unpatriotischen Präsidenten beim Namen genannt. Wollte er nach einer nicht existierenden Objektivität vorgehen, sich gegenüber den Herrschenden seiner Heimat loyal zeigen oder sich nicht emotional aufwühlen lassen? Hatte er eine Lücke in seinem Geschichtsverständnis oder ausgerechnet diese Fakten einfach ›vergessen‹?
Ich bin mir durchaus bewusst, dass die folgende Darstellung der Geschichte und aktuellen Lage Boliviens subjektiv ist. Selbstverständlich habe ich mich an die Fakten gehalten, wobei ich nicht auf alle Einzelheiten eingehen konnte, sondern besondere Geschehnisse und Sachverhalte herausgenommen habe. Bei dieser Schilderung des Hintergrundes geht es mir darum, in erster Linie einen kurzen historischen Überblick, in zweiter Linie aber auch die jeweilige kollektive Bedeutung und inhärente Gefühlsladung zu vermitteln.
Die Geschichte Boliviens ist von Jahrhunderten langer blutiger Gewalt gekennzeichnet: von der Eroberung durch die Inkas und der darauf folgenden Conquista durch die Spanier, dem kolonialen System, dem Unabhängigkeits- (1809-1825) und Bürgerkrieg (1899), der Revolution von 1952 mit anschließender Agrarreform und vielen Verstaatlichungen, den verschiedenen Militärdiktaturen zwischen 1964 und 1982 mit ihren Staatsstreichen und Massakern bis hin zur Wiederherstellung der Demokratie, den soziokulturellen Aufständen wegen einer unvorstellbaren Hyperinflation, den erzwungenen Umsiedlungen von Minenarbeitern und den rigorosen Privatisierungen mit großer Arbeitslosigkeit.
Die ursprüngliche Bevölkerung wurde seit 1535, der Ankunft von Diego de Almagro in Nuevo Toledo (dem heutigen Bolivien), mit den traumatischen Ereignissen der Conquista konfrontiert. Im Verlaufe der Zeit wurde sie dann in Indígenas (einheimische Urbevölkerung), Criollos (Spanier, die in der Kolonie geboren sind) und Mestizos (Mischlinge) aufgeteilt. In der Vergangenheit standen die Einheimischen immer wieder den Mischlingen und Weißen gegenüber; die Bauern, Minenarbeiter und Gewerkschafter immer wieder den Soldaten und Polizisten, die auf der Seite der herrschenden Klasse standen. Die Bevölkerung wurde andauernd fremdbestimmt, sie wurde missioniert, unterdrückt und ausgebeutet.
Ein Beispiel früher institutionalisierter Ausbeutung der Bevölkerung war die Mita, was auf Ketschua »Arbeitsschicht, Arbeitszeit, Jahreszeit« bedeutet. Sie wurde zur Inkazeit als System der Tributleistung durch Arbeit eingeführt. Die Mitayuq oder Fronarbeiter bekamen keinen Lohn, sondern wurden vom Inka-Staat lediglich verpflegt. Dieser öffentliche Frondienst wurde allerdings später von den Spaniern in verschärfter Form fortgeführt. Diese zwangen nämlich einen erheblichen Teil der indigenen Bevölkerung aus den Dörfern zur Mita. Obwohl das System formal streng reguliert war, beuteten die Spanier die Arbeitskräfte aufs Schärfste aus, insbesondere in den Bergwerken. Das goldene Zeitalter in Europa war nur durch den Raubbau der europäischen Mächte möglich, und die industrielle Revolution im Abendland wurde vor allem auf diese Weise finanziert.
Die Spanier schickten vor allem zahllose indigene Dorfbewohner nach Potosí, einem aufstrebenden Minendorf auf etwa 4.000 Metern Höhe, und zwar ins Innere des Cerro Rico (»Reicher Berg«), auf Ketschua Sumaq Urqu, mit den größten Silbervorkommen der spanischen Kolonialzeit. Die Stadt Potosí hatte damals (17. Jahrhundert) gleichviel Einwohner wie London und übertraf europäische Städte wie Madrid, Paris oder Berlin. Hunderttausende von Zwangsarbeitern, die vielfach nicht einmal aus dem andinen Hochland stammten und trotz der dünnen Luft zu Höchstleistungen unter riskanten Bedingungen angetrieben wurden, kamen dort ums Leben. Wie hoch die menschlichen Opfer tatsächlich waren, ist wissenschaftlich umstritten. Im Jahre 1719 raffte der Typhus allein in Potosí in zehn Monaten 22.000 Menschen dahin. Nach dem Forscher Dobyns starben in den ersten 130 Jahren nach der Ankunft Kolumbus’ etwa 95 Prozent der gesamten indigenen Bevölkerung Amerikas aufgrund des Genozids, unbekannter Seuchen und Erschöpfung (Dobyns 1983). Obwohl in Bolivien genaue Angaben fehlen, haben die Menschen dieses kollektive traumatische Geschehen in Form eines packenden Bildes in Erinnerung. Man erzählt sich hier nämlich, dass man mit dem gesamten Silber, das während der Kolonialzeit aus dem Cerro Rico zutage gefördert wurde, eine Brücke über den Atlantischen Ozean von Bolivien nach Spanien bzw. eine ebenso lange Brücke aus den Gebeinen der Toten, die in den Minen des Berges umgekommen sind, bauen könnte. Dieses Bild mag sehr dramatisch anmuten, dennoch trifft es annähernd die historischen Tatsachen.
In den Kriegen gegen Chile (1879-1883) und Paraguay (1932-1935) sowie in den Grenzverhandlungen mit Argentinien, Brasilien und Peru war Bolivien immer wieder der Verlierer.4 Innerhalb eines Jahrhunderts hat das Land über die Hälfte seines Grundgebietes – zum Teil reich an Salpeter, Kupfer und Kautschuk – an die umliegenden Staaten abtreten müssen. Zahlenmäßig verlor Bolivien seit seiner Unabhängigkeit im Jahre 1825 1.265.188 Quadratkilometer, sodass das nationale Territorium heute noch 1.098.581 Quadratkilometer beträgt. Der sogenannte Pazifikkrieg (1879) mit Chile ist im Bewusstsein der Menschen noch immer verankert, da den Kindern im Geschichtsunterricht beigebracht wird, Chile als Erzfeind zu betrachten und den verloren gegangenen Meereszugang von Chile zurückzufordern. Hinsichtlich des sogenannten Chacokrieges (1932-1936) erinnern sich viele Bolivianer daran, wie ihre Großväter oder Großonkel von dieser Hölle erzählt haben. Dieser für ganz Amerika größte und blutigste Krieg des 20. Jahrhunderts fand in einer Steppen- und Sumpflandschaft statt. Während der Grabenkämpfe kamen auf bolivianischer Seite etwa 55.000 und auf paraguayischer Seite 40.000 Soldaten durch Kugeln, Malaria oder Wassermangel ums Leben.5 Paraguay verdoppelte sein Staatsgebiet, aber die vermuteten Bodenschätze stellten sich als fiktiv heraus. Die Hoffnung Boliviens, via Río Paraguay einen Zugang zum Atlantik zu ergattern, nachdem es den Zugang zum Pazifik verloren hatte, erfüllte sich so nicht.
Zudem wurde die bolivianische Bevölkerung regelmäßig von der eigenen Regierung – das heißt von Vater Staat – verraten, weil diese den nationalen Interessen zuwider einen Kurs persönlicher Bereicherung und des Ausverkaufs der Bodenschätze fuhr. Bei den Grenzverhandlungen mit den Nachbarländern Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und Peru zog Bolivien immer den Kürzeren; entweder aus Eigennutz der Verhandelnden, Inkompetenz oder Identifikation mit dem ausländischen Gewinner. Im Standardwerk der Geschichte Boliviens6 werden die Präsidenten Achá, Melgarejo, Morales und Daza, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Land regierten, als »jähzornig, griesgrämig und wenig vorbereitet« (Mesa 2003: 417) beschrieben. In Bezug auf Mariano Malgarejo (1820–1871) wird ein klares Urteil gefällt: »Aber in Wirklichkeit war die Akzeptanz dieser neuen Grenzlinie und die Aufteilung der Reichtümer, welche eine Übergabe der Gewinne aus Mejillones an Chile und an reiche ausländische Geschäftsleute bedeutete, ein unverzeihlicher Fehler der Regierung von Melgarejo.« (Mesa 2003: 431). Im Volksmund wird oft – ohne jeglichen erkennbaren Gefühlsausdruck – erzählt, wie dieser unpatriotische Präsident den enormen Landesteil Acre im Tausch gegen ein weißes Pferd Brasilien geschenkt hat.7
Wenn man sich in die Geschichte Boliviens vertieft, bekommt man leicht ein Gefühl der Unwirklichkeit. Mir persönlich fällt es jedenfalls schwer, die unglaubliche Ungerechtigkeit und Brutalität und die schroffen Gegensätze ernst zu nehmen. Es ist aber noch schwieriger, zu diesen Fakten Stellung zu nehmen, die Wut, Ohnmacht und Fassungslosigkeit auslösen. So gab es z. B. den Präsidenten Gualberto Villarroel López, der während seiner Amtszeit von 1943 bis 1946 einerseits gewisse Sympathien für den Nazi-Faschismus hegte und andererseits weitreichende Reformen durchführte, wie etwa die staatliche Anerkennung der Gewerkschaften. Im Jahre 1946 wurde er von regierungsfeindlichen Massen, die den Palacio Quemado (»Verbrannter Palast«, die Bezeichnung für das Regierungsgebäude in La Paz) stürmten, ermordet. Seine Leiche wurde von einem Balkon geworfen und an einem Laternenpfahl gegenüber des Palasts aufgehängt. Seitdem wird Villarroel als el presidente colgado (»der aufgehängte Präsident«) von der Mehrheit der bolivianischen Bevölkerung als Märtyrer und Held angesehen.
Eine andere historische Merkwürdigkeit ist die Existenz enormer Latifundien, mit anderen Worten Ländereien unbeschränkter Größe im Besitz einer einzigen Person. Der Großgrundbesitz wurde zwar mit der Agrarreform von 1953 offiziell abgeschafft; inoffiziell gibt es jedoch noch immer Besitztümer mit 50.000 bis 100.000 Hektar Land, vorwiegend im östlichen Tiefland Boliviens. Angesichts der etwa 650.000 Familien mit kleinsten Parzellen, die weniger als einen Dollar pro Tag einbringen,8 ist diese Situation innerhalb ein und desselben Landes kaum vorstellbar.
Die demokratische Staatsordnung ist in Bolivien verhältnismäßig jung. Die Zeit der Militärputsche und Diktaturen ist im Gedächtnis der über 30 Jahre alten Bolivianer noch immer in Form bestimmter Einzelheiten und Bilder anwesend. Die jüngere Generation weiß durch Hörensagen davon. Regelmäßig wird auch wieder der Ruf nach einer solch starken Hand laut. Die Generäle Barrientos, Torres, Bánzer, Natush Busch und García Meza kreierten durch systematische Verfolgungen und Verdächtigungen in den Sechziger- und Siebziger-Jahren des 20. Jahrhunderts ein Klima der Angst. Dabei ist zu bedenken, dass der von ihnen ausgelöste Terror nicht nur die politisch Inhaftierten, Gefolterten, Verschwundenen und Ermordeten selbst, sondern auch ihre Familien, Kumpanen und Nachkommen betraf. Während in Europa ausführlich über das Schicksal der Verschwundenen in Chile und Argentinien berichtet wurde, scheinen die Informationen über die Tragik der von der bolivianischen Diktatur Verfolgten irgendwie untergegangen zu sein.
René Barrientos Ortuño, der von 1964 bis 1969 das Land regierte, paktierte mit den Bauern und legte sich mit den Minenarbeitern an. Mithilfe der CIA wurde unter seinem Oberkommando Ernesto Che Guevara ermordet und der Guerilla eine vernichtende Niederlage zugefügt. Die Zahl der Opfer seiner Diktatur war besonders hoch; nach Amnesty International wurden nur allein zwischen 1966 und 1968 etwa 3.000 bis 8.000 Menschen durch die Todesschwadronen ermordet. Übrigens kam Barrientos selbst im Alter von 50 Jahren unter seltsamen Umständen bei einem Helikopterunfall ums Leben.
Hugo Bánzer Suárez, der einer deutschen Familie entstammte, war von 1971 bis 1978 der militärische Diktator Boliviens und von 1997 bis 2002 dessen (demokratisch gewählter) Präsident. Während der Militärdiktatur unterdrückte er jede Form von Opposition und verbot später sogar alle politischen Aktivitäten. Dieser Diktator scheute sich keineswegs, brutale Gewalt einzusetzen, wobei er vor allem gegen die politischen Parteien – sogar seine eigene – und Gewerkschaften vorging. Er bekam die Unterstützung der USA, und in Einklang mit deren Außenpolitik versuchte er, den Koka-Anbau in Bolivien9 auszumerzen, sodass vielen Kokabauern ihre Existenzgrundlage entzogen wurde.
Luis García Meza Tejada war ein weiterer berüchtigter Diktator der Republik Bolivien. 1980 putschte er sich mit Unterstützung des argentinischen Geheimdienstes an die Macht und errichtete ein grausames Schreckensregime. In den 13 Monaten seiner Herrschaft wurde die Bevölkerung massiv unterdrückt und mehrere Tausende von Menschen wurden von der bolivianischen Armee getötet. Das bekannteste Opfer war der prominente Abgeordnete Marcelo Quiroga Santa Cruz, welcher kurze Zeit nach dem Putsch auf nie geklärte Weise verschwand. Quiroga war Chefankläger und Initiator des Prozesses gegen den ehemaligen Diktator Bánzer wegen Verletzung der Menschenrechte und Misswirtschaft. Das Regime García Mezas war tief in den Drogenhandel verstrickt und wurde von den Drogenkartellen mitfinanziert. Zudem war es korrupt, unterschlug die Tagebücher des Che Guevara und andere Wertsachen, und verkaufte sie gegen einen guten Preis. 1981 trat Präsident García Meza unter starkem internationalem Druck – namentlich der Reagan-Administration – zurück. Nach seinem Rücktritt verließ er das Land und floh nach Brasilien, von wo er aber später ausgeliefert wurde. Wegen ernsthafter Verstöße gegen die Menschenrechte wurde er zu einer 30-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Diese Strafe sitzt er auch tatsächlich ab (eine löbliche Ausnahme im bolivianischen Kontext), obwohl er zurzeit in einem Krankenhaus liegt.
Die seit 1982 schnell wechselnden demokratischen Regierungen konnten die wirtschaftlichen Probleme – einerseits ein Erbe der Militärdiktaturen und andererseits wegen dringlicher Forderungen der internationalen Banken, die Zinsen der Auslandsschuld zu zahlen – nur mühsam meistern. In den ersten Monaten des Jahres 1985 wurde die höchste Inflationsrate weltweit erreicht, nämlich 27.000 Prozent. Für die Bevölkerung war diese Entwertung ihres (Spar-) Geldes ein Schock, den man sich in Europa wohl kaum vorzustellen vermag und die nur mit dem Crash von 1927 zu vergleichen ist. Zudem wurde mithilfe nordamerikanischer Truppen einmal mehr versucht, den Anbau von Koka und den Handel von Pasta Básica (Grundlage für Kokain) zu unterbinden, was auf großen Widerstand stieß und nur teilweise gelang.
1993 kam der Bergbauunternehmer Sánchez de Lozada an die Macht, während ein Aymara-Führer Vize-Präsident wurde. Im Vergleich zu den anderen schwer verschuldeten Ländern wurden in Bolivien die strengsten wirtschaftlichen Reformmaßnahmen überhaupt durchgeführt. Dieser neoliberale Kurs beinhaltete den Verkauf mehrerer Staatsbetriebe, eine rigorose Reduktion der Staatsausgaben im Erziehungswesen und Sozialbereich sowie die Schließung vieler Minen. Obwohl die Inflation auf 6,5 Prozent zurückgebracht werden konnte, musste die Bevölkerung große soziale Opfer bringen. Folglich wurde 1997 der Ex-Diktator General Bánzer zum Präsidenten gewählt. Während seiner Periode gab es verschiedene Regierungskrisen und einen Riesenskandal, weil die Korruption und Ineffizienz der Regierung an die Öffentlichkeit gelangte. Bánzer verhängte den Belagerungszustand, konnte aber den gewalttätigen Aufstand wegen der extremen Armut der indigenen Bauern nicht verhindern. Im Jahr 2000 machte das Land eine schwere soziale Krise durch; Streiks, Straßensperren und Zusammenstöße der Indígenas (Einheimischen), Gewerkschaften und Kokabauern mit den Streitkräften waren an der Tagesordnung.
2002 gewann »Goni«, wie Gonzalo Sánchez de Lozada genannt wird, in einer zweiten Runde gegen Evo Morales die Wahlen und wurde zum zweiten Mal Präsident Boliviens (nach 1993-1997). Folglich hatte Bolivien wiederum eine Figur als Präsidenten, der wegen seines jahrelangen Aufenthaltes in den USA besser Englisch als Spanisch sprach und das größte Privatunternehmen Boliviens zur Förderung und Kommerzialisierung von Mineralien des Altiplano (Andenhochland) errichtet hatte. Im Februar 2003 beschloss seine Regierung, eine Einkommenssteuer zu erheben, um das enorme Fiskaldefizit abzuarbeiten und den Forderungen des Internationalen Währungsfonds nachzukommen. Diese unbeliebte Maßnahme führte zu einem Generalstreik und einer Meuterei der Polizei, worauf die bewaffneten Streitkräfte in La Paz eingriffen, was zu mehr als 20 Toten führte. Im Oktober desselben Jahres gab es Gerüchte bezüglich eines Plans, bolivianisches Erdgas über chilenische Häfen in die USA, nach Mexiko und Chile zu exportieren. Aus Protest mobilisierten sich verschiedene soziale Bewegungen des Altiplano und El Alto. Die Regierung versuchte diesen Aufstand mithilfe des Militärs gewaltsam zu unterdrücken, dabei kamen 65 Menschen ums Leben und Hunderte wurden verwundet. Darauf gingen auch Sektoren der Mittelschicht von La Paz auf die Straße und forderten den Rücktritt von Goni. Dieser floh mit Milliardenbeträgen aus der Staatskasse in die USA, wo er noch immer als anerkannter »Flüchtling« lebt. Bolivien hat zwar ein Gesuch um seine Auslieferung gestellt, dieses wurde aber in mehreren Instanzen abgelehnt.
Sein Nachfolger war der Vize-Präsident Carlos Mesa, der ein Kabinett mit Politikern bildete, die keiner Partei angehörten, und der dem Volk ein Referendum hinsichtlich des Gasexportes und der Verstaatlichung der Erdgas- und Erdölvorkommen versprach. Er bekam aber nahezu keine politische Unterstützung, und unter dem Druck schwerer sozialer Unruhen trat er nach etwa zwei Jahren zurück. Das Präsidentenamt wurde dann völlig unerwartet dem Vorsitzenden des Höheren Gerichtshofes, Eduardo Rodríguez Veltze, übergeben. Dieser bildete lediglich eine Übergangsregierung unter Einberufung allgemeiner Präsidentschaftswahlen im Dezember 2005.
Seit Januar 2006 ist Evo Morales Ayma der erste Präsident indigener Abstammung eines Landes, dessen Bevölkerung zu 62 Prozent aus Indigenas besteht. Zudem ist er der zweite Präsident der Republik Bolivien, der mit einem absoluten Stimmenmehr von 54 Prozent im ersten Wahlgang gewählt wurde. Er ist auf dem Land aufgewachsen, vier seiner sechs Geschwister sind als Kind gestorben, seine Schulbildung ist sehr rudimentär. Er war lange Zeit Gewerkschaftsführer der Kokabauern. Einige volksnahe Maßnahmen während seiner bisherigen Amtszeit bestanden in der Herabsetzung des eigenen Gehaltes und anderer Regierungsfunktionäre, der jährliche Bonus für alle Kinder der Grundschule und ein monatlicher Bonus für schwangere Frauen und solche mit kleinen Kindern sowie eine Grundrente für Betagte. Außerdem gab es mithilfe von Venezuela und Kuba eine Alphabetisierungskampagne. Mit einem Dekret wurden die Erdöl- und Erdgasvorkommen verstaatlicht, während die internationalen Konzerne nun dem bolivianischen Staat etwa dreimal so viel Steuern wie vorher abtreten müssen, wobei diese allerdings in Bolivien nach wie vor ein rentables Geschäft machen.
Mit einem Referendum wurde am 25. Januar 2009 die neue Staatsverfassung, welche die demokratisch gewählte verfassungsgebende Versammlung (Asamblea Constituyente) während neun Monate inmitten großer Spannungen und Krawallen ausgearbeitet hatte, mit 61 Prozent der Stimmen angenommen. Außerdem wurde bei dieser Gelegenheit der maximal erlaubte Grundbesitz pro Person auf 5.000 Hektaren festgelegt. Dieses Gesetz hat jedoch keine rückwirkende Kraft. In der neuen Staatsverfassung sind neben dem Castellano (lateinamerikanisches Spanisch) 36 verschiedene einheimische Sprachen in dem Mehrvölkerstaat (Estado Plurinacional) offiziell anerkannt. Neuerdings gibt es eine autonome Verwaltung auf vier verschiedenen Ebenen: der Departemente, Regionen, Gemeinden und ursprünglichen Gemeinschaften der Indígena. Alle natürlichen Rohstoffvorkommen gehen in die Hände des Staates über; die Erdöl- und Erdgasvorräte sowie deren Gewinne werden vom Staat verwaltet. Die römisch katholische Kirche hat ihren privilegierten Status verloren, da bewusst die Trennung von Staat und Kirche eingeführt wurde (Säkularstaat). Aufgrund dieser neuen Staatsverfassung spricht Evo Morales von einer Refundación del País (Neugründung des Landes). Eine heftige Reaktion der Opposition seitens der Großgrundbesitzer aus Santa Cruz im Osten des Landes, der Unternehmer und anderer konservativer Kräfte, die um ihre Privilegien bangen, konnte wohl nicht ausbleiben. Da sie auch im Besitz der meisten Radio- und Fernsehsender und zudem fast aller Zeitungsverlage sind, ist die öffentlich zugängliche Information stark gefärbt und regierungskritisch. Gemäß der neuen Staatsverfassung hat es in Dezember 2009 (vorgezogene) Präsidentschaftswahlen gegeben, welche die Opposition aus Mangel eines fähigen Kandidaten auf später verschieben wollte. Wiederum hat Evo Morales Ayma mit einem bedeutendem Mehr an Stimmen gewonnen, sodass er als Präsident und der Soziologe und Mathematiker Álvaro García Linera als Vizepräsident nach wie vor mit ihrer Partei MAS (Movimiento al Socialismo) die heutige Regierung bilden und die Geschicke des Landes lenken.
Zurzeit, d. h. Ende 2013, sitzen Staatspräsident Evo Morales Ayma und sein Vize Álvaro García Linera fest im Sattel; sie bereiten sich sogar bereits auf die Neuwahlen im nächsten Jahr vor. Die Frage um Legitimität oder Verfassungswidrigkeit ihrer Kandidatur für eine weitere fünfjährige Amtsperiode hängt von einer – zwiespältigen – Interpretation der neuen Staatsverfassung ab und spaltet im Moment das Volk. Im Laufe der Zeit hat die Regierung es fertig gebracht, den Spieß umzudrehen und jede Kritik in den Medien zu unterdrücken, ganz nach dem Motto: »Wer nicht für uns ist, ist gegen uns«. Die Widersprüche zwischen Theorie und Praxis, zwischen offiziellem Diskurs und konkreten Entscheiden treten immer klarer hervor. Dabei geht es vor allem um die Frage, wo man ansetzen soll, um die Entwicklung eines armen, abhängigen Landes mit vielen Rohstoffen aber ohne Eigenkapital anzukurbeln. So verspricht sich die Regierung sehr viel von dem durch Brasilien finanzierten Bau einer Straße mitten durch den Nationalpark Isiboro Securé (TIPNIS). Sie will das bisher kaum zugängliche Gebiet dem wirtschaftlichen Wachstum erschließen, in Tat und Wahrheit aber dem Anbau von Koka-Plantagen Tür und Tor öffnen. Nationale und internationale Umweltgruppierungen wehren sich heftig und versuchen, die dort vorkommende, vielfältige Pflanzen- und Tierwelt zu schützen. Die ansässige indigene Bevölkerung wird manipuliert und ist schlecht informiert, während die Entscheidungen weit weg in La Paz gefällt werden. Ein anderer Widerspruch betrifft den Diskurs über die Pachamama (Mutter Erde) einerseits und die Erdölbohrungen im Urwald des Madidi-Nationalparks andererseits. Schließlich gibt es noch ein weiteres Phänomen, das zu Beunruhigung Anlass gibt. Die zahlreichen neuen, bis zu 40-stöckigen Bauten in La Paz weisen auf Geldwäsche von Narcodolares (Geld aus dem Drogengeschäft) hin, obwohl niemand genau Bescheid weiß. Anscheinend floriert das Drogengeschäft, das wiederum die allgemeine Kriminalität fördert. Die meisten Menschen haben einmal mehr das Vertrauen verloren, die Regierung könne ihnen eine bessere Zukunft verschaffen, aber die Hoffnung auf ein besseres Leben bleibt lebendig.
1.3 Das Umfeld Boliviens
Nicht nur die Geschichte, sondern auch die Umweltbedingungen üben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Menschen aus. In Bolivien lässt sich eine Parallele zwischen der Landschaft einerseits und dem Klima andererseits ziehen, denn beide Elemente weisen extreme Unterschiede auf. Die Landschaft Boliviens besteht aus über 6.000 Meter hohen Bergen, abgrundtiefen Schluchten, einer äußerst kargen Hochebene, trockener Wüste und enormen Salzseen, grünen Tälern, breiten Flüssen und tropischen Wäldern. Es fehlt dem Land nur das Meer, aber die bemerkenswerte Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren ist geblieben. Es gibt von April bis September eine trockene, kalte oder sogar eiskalte Jahreszeit und von Oktober bis März eine wärmere oder sehr heiße Regenzeit. Die großen Temperaturschwankungen – Unterschiede von bis zu 20 Grad Celsius innerhalb eines Tages – verursachen viele Krankheiten der Atemwege. Die vier Jahreszeiten, auf die man sich in Europa gut vorbereiten kann, durchlebt man hier ohne Zentralheizung an einem einzigen Tag. Jedes Jahr aufs Neue gibt es in bestimmten Landesteilen zu viel Regen, während es in anderen Teilen zu wenig regnet. Sowohl die regelmäßigen Dürreperioden als auch die Überschwemmungen sind fatal, sie fordern jährlich mehrere Menschenleben.10 Wird die Ernte dieser Regionen vernichtet, sterben außerdem Tausende von Kühen, Schafen oder Lamas, und die Preise der Nahrungsmittel schnellen prompt in die Höhe.
Im Grunde genommen hat Bolivien vor allem Eco-Touristen sehr viel zu bieten; dennoch läuft die Touristenindustrie wegen der schlecht ausgebauten Infrastruktur und der allgemeinen sozialen Unsicherheit nicht an. Obwohl dem Land die enormen Gold-, Silber- und Zinnvorräte geraubt worden sind, verfügt es noch immer über reiche Bodenschätze. Erst neulich ist das Interesse am Abbau von Eisenerz und Lithium erwacht. Das Land hat jedoch nicht die nötigen finanziellen Mittel, um zu investieren und diese Bodenschätze selbst zu verarbeiten. Es exportiert seine Rohstoffe für einen niedrigen Preis und muss die industrialisierten Produkte gegen einen hohen Preis importieren, sodass die Bilanz schlussendlich einen negativen Saldo aufweist. Folglich fehlt es der Staatskasse an Geld, um das mangelhafte Gesundheits- und Erziehungswesen zu verbessern, das bestehende Straßennetz auszubauen, die miserablen Gehälter11 zu erhöhen und eine einigermaßen humane Arbeitslosenunterstützung, Alters-12 und Krankenfürsorge einzuführen. Der Umstand, dass die Einkünfte trotz mehrerer Jobs und der Solidarität innerhalb der Großfamilie niedrig sind, die Ausgaben jedoch bei Krankheit oder Bildungsvorhaben unheimlich schnell anwachsen können, erklärt zu einem Teil die Korruption und Vetternwirtschaft sowie die Gefühle ständiger Sorge und Frustration. In diesem Umfeld sind Ferien oder Freizeitaktivitäten ein Luxus, den sich nur wenige Menschen leisten können.
Bolivien ist ein Land, wo einerseits alles kopiert wird – von CDs, DVDs, Markenartikeln, Büchern bis hin zu Abschlussarbeiten –, aber andererseits eine außerordentliche kreative Begabung zum Überleben an den Tag gelegt wird. Es beherbergt zahlreiche Gegensätze und Widersprüche, die kaum miteinander in Einklang zu bringen sind. Dabei scheinen die äußeren Extreme einer inneren Radikalität ausgesprochener Meinungen und angestrebter Ideale zu entsprechen. So führen die bestehenden Feindbilder bzgl. Rasse, sozialer Klasse und regionalen Zugehörigkeit immer wieder zu heftigen Konflikten. Diese heterogene Gesellschaft rollt von der einen Krise in die nächste und bewegt sich ständig am Rand des Abgrundes. Man hat sich daran gewöhnt. Periodisch wird von einem drohenden Bürgerkrieg oder Militärputsch geredet, es hängt eine latente Todesdrohung in der Luft. Dennoch werden die Jahrestage der Heiligen und die Hochzeiten groß gefeiert.
Nach dem CIA World Factbook hatte Bolivien am 31. Dezember 2007 eine Auslandsschuld von 3.800.000.000 US-Dollar. Die Tilgung dieser Auslandsschuld samt deren Zinsen stellt jedes Jahr den größten Ausgabeposten der Staatskasse dar. In einem Zeitungsartikel in El Deber vom 28. Januar 2007 enthüllte Präsident Evo Morales, dass jeder Bolivianer momentan dank des Schuldenerlasses nur noch 250 Dollar schulde. Diese ›Schuld‹ erzeugt ein Ausgeliefert-Sein und eine Abhängigkeit vom Ausland, den Großbanken und transnationalen Unternehmen und bildet damit sowohl ein ökonomisches wie auch psychologisches Problem. In dieser Situation sind es die ausländischen Regierungen, Institutionen und Konzerne, die schlussendlich über ein Projekt oder einen Kredit entscheiden, woran sie ganz bestimmte Bedingungen knüpfen. Obwohl man in der Theorie keinen Paternalismus oder Erpressung betreiben möchte, stößt man in der Praxis immer wieder auf solche Dynamiken. Schließlich wollen die ausländischen Mächte nicht nur ›gut‹ sein, sondern vertreten auch ihre eigenen Interessen und setzen diese durch. Dabei sitzen die Bolivianer am kürzeren Hebel: Sie müssen nehmen, was sie bekommen können und noch dazu »Danke« sagen.
In der bolivianischen Gesellschaft existiert eine starke Tendenz, die jeweilige Zugehörigkeit zu einer ethnischen oder sozialen Gemeinschaft deutlich hervorzuheben und sich somit von den übrigen Gemeinschaften abzugrenzen. Im gleichen Sinne wird an jeder Schule und Universität das Gemeinschafts- und Identitätsgefühl der Studenten geweckt, z. B. mittels eigener Tanzgruppen, die an öffentlichen Anlässen teilnehmen, oder bestimmter Feindbilder in Bezug auf die anderen. Dieses segmentierte Gesellschaftssystem schafft zwar eine gewisse Ordnung im Chaos und somit eine gewisse Sicherheit, leistet aber auch den Vorurteilen und einem latenten Rassismus Vorschub. Diese Segmentierung scheint als Introjektion innerlich verankert zu sein. Wenn man z. B. arm ist, so meint man, lebenslang arm zu bleiben und bleiben zu müssen.
1.4 Interkulturalität
In Europa bekommt das Thema der Interkulturalität neuerdings große Aufmerksamkeit, was wahrscheinlich auf die Reisefreudigkeit und Migration unserer globalisierten Welt zurückzuführen ist. Hoffentlich ist sie jedoch mehr als eine Modeerscheinung. Vergleichsweise redet man in Bolivien, vor allem seit der Errichtung des ›plurinationalen‹ Staates, von dem Reichtum der Mannigfaltigkeit (la riqueza de la diversidad). Da es zahllose unterschiedliche Kulturen gibt, die ich nicht hierarchisch als mächtiger oder wichtiger aufgliedern möchte, ziehe ich den Begriff der ›Inter-Kulturalität‹ vor. Das bedeutet konkret, dass ich mich ›zwischen den Kulturen‹ sehe. Ich identifiziere mich mit meiner holländischen Herkunft, die in der westeuropäischen Kultur verwurzelt ist, und trete in einen respektvollen Dialog mit der lateinamerikanischen – insbesondere der bolivianischen, und noch genauer der andinen13 – Kultur. Wenn wir uns ernsthaft auf diesen horizontalen Dialog einlassen, beeinflussen wir uns gegenseitig und sind nach der Begegnung nicht mehr diejenigen, die wir vorher waren.
Das Führen eines solchen Dialoges ist aber keineswegs problemlos, erzeugt vielfach Missverständnisse, Frustrationen, Irritationen und Ohnmacht. Denn manchmal gelingt es trotz größter Anstrengung nicht, den interkulturellen Graben der Andersartigkeit zu überbrücken. Mir erscheint es wie ein Ausdruck der Arroganz zu meinen, nach einem Aufenthalt von sechs Monaten in dem Land kenne man seine Kultur und verstehe die Menschen. Vor allem in den Supervisionsstunden mit kürzlich eingereisten Fachpersonen aus Europa, die intensiv auf ihre Zeit in Bolivien vorbereitet wurden, sind die Anpassungsschwierigkeiten, die keineswegs unterschätzt werden dürfen, ein Thema. Es kommt mir oft vor, als hätten sie in den Vorbereitungskursen zwar von der Andersartigkeit ›gehört‹, sie aber trotzdem nicht ›verstanden‹, weil ihnen noch die Erfahrung gefehlt hat. Anscheinend muss Interkulturalität erlebt werden, um verstehen zu können, was ich meine. Es braucht ein großes Maß an Flexibilität und Vertrauen, um die verunsichernde Anfangszeit in einem fremden Land auszuhalten. Im Grunde genommen begegnet man in dieser schwierigen Etappe nicht nur den Anderen, sondern auch sich selbst. Anschließend braucht es viele Jahre, um einige Sachen verstehen zu lernen und in anderen Sachen fremd zu bleiben.
Viele interkulturelle Aktivitäten finden allerdings noch immer unter dem Diktat europäischer oder nordamerikanischer Vorstellungen statt, wobei es vorrangig um deren Interessen oder Kriterien geht. Deren weltweite Vorherrschaft ist nicht nur auf wirtschaftlichem, sondern auch auf wissenschaftlichem Gebiet bestimmend, obwohl China diese Machtverhältnisse allmählich ins Wanken bringt. Aufjeden Fall spielt ein sogenanntes Dritte-Welt-Land wie Bolivien keine ernst zu nehmende Rolle auf dem Marktplatz Welt. Bei dem Unterfangen, in Bolivien eine Dissertation zu schreiben, wobei ich selbstverständlich den geltenden wissenschaftlichen Normen genügen sollte, bin ich auf einen rigiden Europa- oder USA-Zentrismus gestoßen. Die Realisierung des Forschungsprojektes wurde von mehreren strukturellen Schwierigkeiten erschwert, die nicht beseitigt werden konnten, aber unentwegt im Auge behalten werden mussten.
So stellt ein Fachbuch oder eine Zeitschrift einen Luxus dar, den sich kaum jemand in La Paz oder El Alto leisten kann. Folglich gibt es in beiden Millionenstädten keine einzige Buchhandlung, die sich auf Fachliteratur spezialisiert hat. Nur zwei Personen der zehnköpfigen Forschungsequipe haben zu Hause einen Computer, aber niemand hat einen privaten Internetanschluss: sie gehen ab und zu in ein Internetcafé. Da sie eine staatliche Schule besucht haben, sind ihre Englischkenntnisse rudimentär, irgendwelche Deutschkenntnisse gar nicht vorhanden, sodass sie sowieso keinen ausländischen Wissenschaftsbericht lesen können. Während die Equipemitglieder die Studenten nach ihren traumatischen Erfahrungen fragten, waren sie selbst auch in einem bestimmten Maß sowohl direkt als indirekt14 von den potenziell traumatisierenden Ereignissen betroffen. Hinzu kam der Mangel an Sicherheit auf allen Ebenen, der eine genaue und detaillierte Planung unmöglich machte, während der Anspruch auf Effizienz und Zeitmanagement bloß heftige Gefühle der Frustration ausgelöst hätte. In der Zeitspanne von 2007 bis 2009 gab es wegen der soziokulturellen und politischen Umwälzungen große Unruhen unter der Bevölkerung und zahllose Konflikte im Land, wobei mehrere zu Tode fielen.
Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass eine wissenschaftliche Arbeit nach dem aristotelischen Prinzip des ›Entweder-Oder‹ im andinen Raum ein Fremdkörper ist. Sie birgt die Gefahr in sich, gewisse Schlüsse am Lebensverständnis der Einheimischen vorbei zu ziehen. Denn die Menschen in La Paz und El Alto leben nach dem Empfinden des ›Sowohl-als-auch‹. Sie sagen selten gerade heraus ›Nein‹, denn dies wäre ein Affront. Sie möchten niemanden vor den Kopf stoßen, schließlich könnte es immer noch anders kommen. Diese Möglichkeit, man könnte irgendwann in der Zukunft aus irgendwelchen Gründen doch noch zustimmen, wird ständig offen gehalten. Dieses Lebensgefühl des ›Sowohl-als-auch‹ schlägt sich auch auf der psychologischen Ebene nieder, indem man dazu neigt, die Grenzen zwischen mir und den Anderen, zwischen Wirklichkeit und Wunschdenken, zwischen Vergangenheit und Aktualität zu verwischen. Die Grenzen des Selbst oder der Realität sind keineswegs fest und klar, sondern äußerst flexibel und durchlässig.
»Zusammenfassend können wir festhalten, dass der bevorzugte Zugang des andinen Menschen zur ›Wirklichkeit‹ nicht der Intellekt ist. Vielmehr sind es eine Reihe von nicht-rationalen (die deshalb nicht etwa ›irrational‹ sind) Fähigkeiten, von den klassischen fünf Sinnen, von Gefühlen und Emotionen bis hin zu ›parapsychologischen‹ gnoseologischen Sinnen (Ahnung, psychosomatische Phänomene, ›telepathische Kommunikation‹). Das ›logische‹ Argument, dass eine Apfelsinen-Verkäuferin einen größeren Gewinn erlangen könnte, wenn sie gleich alles, was sie hat, verkaufen würde, entspricht nicht der ›Logik des Herzens‹, die besagt, dass man für alle Fälle immer etwas zurückbehalten soll.« (Estermann 1999: 116)
Eine interkulturelle Psychotherapie, welche sich der kulturellen Andersartigkeit vom Gegenüber verpflichtet fühlt und Recht tun will, steckt wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen. Diesbezüglich ist die Tatsache, dass das allgemein angewandte Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders15 (DSM) sein Leserpublikum nicht einmal auf die Möglichkeit, geschweige denn Notwendigkeit einer soziokulturellen Kontextualisierung und Relativierung hinweist, vielsagend. Und auch der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)16 fehlt es, trotz ihres Anspruchs auf weltweite Anwendbarkeit, an einer nuancierten interkulturellen Betrachtungsweise. Im Kreis angesehener Psychotherapeuten bemüht man sich anscheinend nach wie vor, die psychischen Störungen und diagnostischen Kriterien zu verallgemeinern, obwohl dieser Anspruch auf Universalität nicht ohne Weiteres geltend gemacht werden kann. Die Psyche des Menschen mag zwar weltweit den gleichen Gesetzen und derselben Dynamik unterliegen, die prägende Wirkung der jeweiligen Geschichte und Umgebung auf die Psyche führt aber zu beachtlichen Unterschieden. Leider wird der interkulturelle Ansatz auch in der Psychologie-Forschung nur selten als Bereicherung gesehen und dementsprechend verfolgt.
Allerdings gibt die Gestalt-Psychotherapie zu verstehen, prinzipiell offen für den interkulturellen Ansatz zu sein. Schließlich bietet ihre Grundhaltung eine dialogische, humanistische, kreative und kontextuelle Perspektive. Zudem weist ihr ›Sitz im Leben‹ auffallend viele Übereinkünfte mit dem ›bolivianischen‹ Lebensgefühl auf. Denn gerade die holistische Betrachtungsweise des Menschen als einer bio-psycho-sozialen Einheit, die Struktur des Organismus-Umwelt-Feld, die Verankerung im Hier-und-Jetzt, den prozesshaften Charakter, den Kontakt im Fluss des Lebens, die Orientierung am einmaligen Erlebnis, das Verständnis des ›Selbst‹17 und den hohen Stellenwert von Gruppenarbeit haben sie gemeinsam. An dieser Stelle möchte ich ebenfalls erwähnen, dass die Mehrheit der Gestalttherapeuten sich selbst mit ihrer Aversion, sich festlegen und folglich auch schriftlich festhalten zu wollen, ein Bein gestellt hat. Es gibt nämlich einen bedauerlichen Mangel an Theoriebildung, Diagnostik und Studien zu anderen wissenschaftlichen Themen, wie z. B. das der Dissoziation.
In einem Land wie Bolivien ist eine kontextualisierte Gestalttherapie gefragt, da die ursprüngliche Form aus dem Norden – namentlich Europa und den USA – stammt. Diese kann nur von den einheimischen Psychotherapeuten vor Ort entwickelt werden. In der Gestaltausbildung in La Paz gebe ich meinen Studenten diese schwierige Aufgabe als Herausforderung mit. So wird man als Gestalttherapeut in Bolivien mit spezifischen kulturellen Introjekten konfrontiert, die vielleicht in einem bestimmten Maß auch in Europa gelten, aber doch nicht (mehr) in dieser gewaltigen Intensität, z. B.: Du sollst deinem Vater ergeben sein, ihm nicht widersprechen oder direkt in die Augen schauen. Als junges Mädchen sollst du warten, bis du gefragt wirst; als Junge sollst du auf jedem Terrain die Initiative ergreifen. Eine andere Akzentuierung der therapeutischen Arbeit betrifft die Leitung einer Selbsterfahrungsgruppe als Paar, als Mann und Frau. Erstens arbeitet und ist man nicht gern allein, und zweitens hat sich diese Zusammensetzung sowohl für die Leitung als auch die Gruppe als außerordentlich fruchtbar herausgestellt. Zudem möchte ich die heilsame, horizontale Gesprächsebene hervorheben, wenn sich die Menschen in Bolivien gesehen und gehört fühlen. Wahrscheinlich hängt dieses Bedürfnis bzw. dessen befreiende Befriedigung mit der jahrhundertelangen kollektiven Unterdrückung während der kolonialen und diktatorischen Geschichte zusammen. Zum Schluss möchte ich ihre Freude an Körperarbeit, Spielsequenzen und Ritualen betonen. Wenn diese Elemente in den gestalttherapeutischen Prozess eingebracht werden, so erzielen sie meist eine äußerst positive Wirkung.