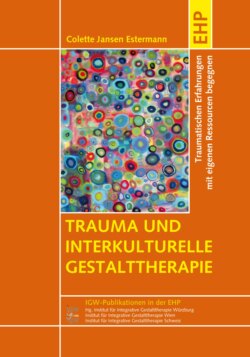Читать книгу Trauma und interkulturelle Gestalttherapie - Colette Jansen Estermann - Страница 9
ОглавлениеGeleitwort
Ist die Gestaltpsychotherapie, die bekanntlich in abendländischen Kulturräumen (Europa, Südafrika, USA) entstanden ist, in der Lage, auch in anderen kulturellen Kontexten Fuß zu fassen und sich auf den Grundlagen der einheimischen Wissenstraditionen und Weisheiten weiterzuentwickeln? Dieser Frage, die in letzter Zeit auch hinsichtlich der ostasiatischen und osteuropäischen kulturellen Kontexte vertieft wird, geht die vorliegende Arbeit am Beispiel Boliviens nach. Die Autorin Colette Jansen Estermann, die selbst über sechzehn Jahre in den Anden gelebt hat und die andinen Weisheitstraditionen und Kulturformen aus nächster Nähe kennt, ist der festen Überzeugung, dass der Gestaltansatz gerade für die andine Kultur und deren philosophischen Hintergrund eine ausgezeichnete Form der Psychotherapie ist, da sie holistisch ausgerichtet und nicht logozentrisch verfasst ist.
In Trauma und interkulturelle Gestalttherapie versucht die Autorin auf der Grundlage eines breit angelegten Forschungsprojekts zu zeigen, dass nicht nur die Erfahrung und Art von Traumata, sondern auch deren Verarbeitung kulturell bedingt sind. Die vor allem im abendländischen Kulturraum der sogenannten »Ersten Welt« erarbeiteten Diagnostikverfahren und Symptomatiken vermögen einem völlig anderen kulturellen und sozialen Kontext, wie es der bolivianische eben ist, nicht gerecht zu werden. Deshalb braucht es der Autorin zufolge eine kreative interkulturelle Theoriebildung, wofür sie im vorliegenden Buch die ersten Grundlagen und Perspektiven aufzeigt.
Unter den wichtigsten Befunden zeigt die Autorin auf, dass in einem sogenannten »Entwicklungsland« nicht nur von individuellen und einmaligen traumatischen Erfahrungen die Rede ist, sondern von kollektiven und transgenerationalen Tiefenschichten, die sich aus der gewaltsamen Unterdrückungsgeschichte des Landes erklären lassen. Deshalb führt sie neben dem in der Standardliteratur anerkannten »Einfachen Psychotraumatischen Belastungssyndrom (PTBS)« das inzwischen auch schon viel diskutierte »Komplexe PTBS«, vor allem aber neu auch das »Strukturelle PTBS« ein, das sich beim Umgang mit traumatischen Erfahrungen in Kontexten von extremer Armut, Ungerechtigkeit und Unsicherheit als sehr hilfreich erwiesen hat.
Es ist zu beachten, dass die Autorin konsequent vom »Psychotraumatischem Belastungssyndrom« und nicht etwa von »Posttraumatischer Belastungsstörung« spricht, weil letzteres ein Werturteil beinhaltet, das in einem bestimmten Kulturraum beheimatet ist, und man zudem davon ausgeht, dass die traumatische Erfahrung selbst zu einem Abschluss gekommen ist. Dies ist aber in einem Kontext wie dem bolivianischen nicht der Fall. Außerdem betont sie – aufgrund der kollektiven Traumatisierung des bolivianischen Volkes – den Wert der Eigendiagnostik.
Als weitere kreative Neuerung gilt der Rückgriff auf den vor allem in den Sozialwissenschaften beheimateten Begriff der »strukturellen Gewalt«, der für den Umgang mit traumatisierten Menschen in Bolivien, wie auch in anderen Ländern der sogenannten »Dritten Welt«, von großem theoretischem und praktischem Nutzen ist. Daraus ergeben sich nicht nur interkulturelle, sondern auch sozio-politische Konsequenzen, da die Armut als Form der »strukturellen Gewalt« für kollektive und Generationen übergreifende Traumatisierung von Menschen verantwortlich ist. Zudem zeigt die Autorin auf, dass es einen Umgang mit den Ressourcen und Coping-Strategien gibt, der kulturspezifisch ist und deshalb in einem nicht-abendländischen Kontext einen anderen Stellenwert hat.
Die vorliegende Publikation, die auf der von Colette Jansen Estermann im Jahre 2009 eingereichten Dissertation basiert, ist ein Anstoß zur interkulturellen Sensibilisierung der Psychotherapie insgesamt, vor allem aber der Gestalttherapie und des Umgangs mit traumatischen Erfahrungen. Zudem gehört sie unbedingt zum Hintergrundwissen von EntwicklungshelferInnen und Einsatzleistenden, um die Menschen und deren Verhalten in einem Kontext von Armut und Mängeln besser verstehen zu können. Schließlich ist zu hoffen, dass mit diesem Buch auch im deutschsprachigen Raum eine Diskussion zur interkulturellen Transformation der Gestalttherapie in Gang kommt.
Prof. Dr. Willi Butollo, Ludwig-Maximilian-Universität München