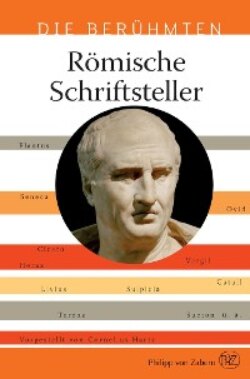Читать книгу Römische Schriftsteller - Cornelius Hartz - Страница 10
Einer gegen Karthago
ОглавлениеCato d. Ä.
Name: Marcus Porcius Cato
Lebensdaten: 234–149 v. Chr.
Literarische Gattung: Rhetorik, Geschichtsschreibung, Fachliteratur
Werke: „Ursprünge“ (Origines), „Über den Ackerbau“ (De agri cultura)
Im Alter von 80 Jahren begann Cato d. Ä., die griechische Sprache zu erlernen. Als man ihn fragte, warum er sich in so hohem Alter noch einer so schwierigen Aufgabe stelle, soll er geantwortet haben: „Dies war das jüngste der Alter, aus denen ich wählen konnte.“ Dass ein einflussreicher römischer Politiker und Schriftsteller nicht bereits in jungen Jahren Griechisch gelernt hatte, wäre 100 Jahre später bereits kaum vorstellbar gewesen. Doch Cato stand allem Nicht-Römischen (und speziell allem Griechischen) äußerst skeptisch gegenüber.
Wer war das?
Marcus Porcius Cato ist eine der wichtigsten Figuren der römischen Geschichte und Literatur. Er ist der älteste (überlieferte) römische Prosa-Schriftsteller. Um Cato von seinem Urenkel Cato zu unterscheiden, der im 1. Jh. v. Chr. eine wichtige Rolle im Bürgerkrieg um Caesar spielen sollte, hat man ihm später verschiedene Beinamen gegeben: „der Weise“ (sapiens), „der Alte“ (priscus), „der Zensor“ (censorius) – und natürlich einfach „der Ältere“ (maior). „Der Weise“ deutet hier schon in die richtige Richtung: Über Jahrhunderte galt der ältere Cato als das Urbild des konservativen Römers und als Vorbild in Lebensführung und Prinzipientreue. Cato war ein Patriot in jeder Hinsicht, Verfechter der Werte, die sich die Römer auf die Fahnen schrieben: Ernsthaftigkeit, Tugendhaftigkeit, Staatstreue und Strenge. Nicht-Römischem verweigerte er sich, er war ein glühender Gegner des zu seiner Zeit noch mächtigen Karthago und lehnte den kulturellen Einfluss der verweichlichten Griechen größtenteils ab – Sokrates war für ihn (dabei ganz im Sinne der Athener Obrigkeit) ein „Verderber der Jugend“.
Numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse quam cum solus esset.
„Nie ist man tätiger, als wenn man nichts tut; nie ist man weniger allein, als wenn man für sich ist.“
Über sein Leben ist einiges bekannt – sowohl vom Griechen Plutarch als auch vom römischen Historiker Cornelius Nepos sind Cato-Biografien überliefert. Marcus Porcius Cato wurde 234 v. Chr. in Tusculum, östlich von Rom, geboren; seine Familie gehörte dem römischen Ritterstand an. Mit etwa 17 Jahren ging Cato zur Armee und wurde bereits drei Jahre später Militärtribun. Mithilfe eines einflussreichen Freundes, den er beim Militär kennenlernte, stieg Cato gleichzeitig in die Politik ein. Er wurde im Jahre 204 v. Chr. zum Quästor gewählt (der niedrigsten Stufe der Ämterlaufbahn) – als Untergebener des Konsuln und berühmten Hannibal-Gegners Scipio Africanus. Fünf Jahre später war er Ädil und machte sich beim Volk dadurch beliebt, dass er die „Plebejischen Spiele“, fast zwei Wochen dauernde Zirkusspiele zur Zerstreuung der Massen, wieder aufleben ließ. Im Jahr darauf wurde er Prätor, dann Statthalter von Sardinien und schließlich Konsul. Nach einem erfolgreichen Feldzug gegen Aufständische in Hispanien besiegte er im Jahre 191 v. Chr. Antiochos III., einen der Nachfolger Alexanders des Großen, und zog sich vom Militär zurück. 184 v. Chr. wurde Cato zum Zensor (daher sein Beiname: Censorius) ernannt – neben dem Konsul das vielleicht einflussreichste politische Amt in Rom. Der Zensor war nicht nur für die Volkszählung und Vermögensschätzungen verantwortlich, er hatte auch das regimen morum inne, sozusagen die „Aufsicht über die Einhaltung der guten Sitten“. Auch nach seiner Zeit als Konsul und Zensor blieb Cato noch lange ein einflussreicher Senator – der Nachwelt ist er vor allem durch seine (angeblich) ständigen Hinweise darauf, man solle doch bitte endlich Karthago zerstören, in Erinnerung geblieben.
„Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.“
„Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss“: Mit diesem Satz soll Cato jede seiner Reden im Senat beendet haben (ganz gleich, was das eigentliche Thema war). Dieser Spruch ist ein ähnliches Phänomen wie Caesars „alea iacta est“ (s. S. 45): Traditionell spricht man Cato diesen Satz zu, aber es gibt keine zeitgenössische Quelle, die uns diesen Wortlaut überliefert. Lediglich eine griechische Übersetzung gibt es, wiederum bei Plutarch, die, wörtlich übersetzt, soviel heißt wie: „Es scheint mir (ratsam), dass auch Karthago nicht existieren soll.“
Nun hat Plutarch diese Worte erst beinahe 250 Jahre nach Cato aufgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die anekdotische Überlieferung natürlich längst verselbstständigt. Viele Forscher bezweifeln heute, dass Cato diese Worte überhaupt gesagt hat – doch hätte man sie in Rom kaum jemand anderem andichten können.
Wie dem auch sei: Der Verlauf der Geschichte gab Cato schließlich doch noch Recht. Im selben Jahr, als er im (für damalige Verhältnisse geradezu „biblischen“) Alter von 85 Jahren starb, begann der letzte und entscheidende Feldzug gegen Karthago, bei dem man es schließlich vollkommen zerstörte und das Römische Reich endgültig seine Stellung als vorherrschende Macht im Mittelmeer einnahm.
Zwei der wichtigsten frühen römischen Schriftsteller: Cato d. Ä. und der Komödiendichter Terenz (s. S. 26 ff.) auf einem Kupferstich von 1764. Berlin, Slg. Archiv für Kunst & Geschichte.
Was schrieb er?
Catos Bedeutung in der Literatur liegt vor allem darin, dass er auf Latein schrieb. Dies ist keineswegs selbstverständlich: Auch vor ihm gab es z. B. schon römische Geschichtswerke, die waren aber traditionell auf Griechisch abgefasst. Bedenkt man Catos Haltung gegenüber allem Nicht-Römischem, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er auch hier bereits sprachlich ein Zeichen setzen wollte.
Die „Ursprünge“ (Origines) beschreiben in sieben Büchern die Geschichte Roms von seiner Gründung bis zur Zeit Catos – ein Konzept, wie wir es auch bei Ennius oder Livius finden. Das Besondere hierbei war der ganz vordergründig pädagogische (und alles andere als objektive) Ansatz: Cato stellt immer wieder einzelne „Beispiele“ vor, die dem Leser vor Augen halten sollen, wer sich in der Geschichte richtig, wer falsch verhalten hat, also Verhaltensrichtlinien nach dem Motto: Was können wir aus der Geschichte lernen?
Das in größerem Umfang (bzw. sogar vollständig) erhaltene und wohl auch berühmteste Werk Catos heißt: „Über die Landwirtschaft“. Cato hat es erst in seinen letzten Lebensjahren verfasst. Es ist ein Lehrwerk und beschreibt, beim Erwerb eines Gutes angefangen, wie man dieses am besten bewirtschaftet. Anders als Varro, der ebenfalls über die Landwirtschaft schreibt, behandelt Cato kleine und mittlere Betriebe. Er orientierte sich dabei offenbar an der tatsächlichen Durchschnittsgröße von Agrarbetrieben im 2. Jh. v. Chr. Cato geht dabei oft auf die „guten alten Sitten“ der Vorväter ein, die (so Cato) gerade in der Landwirtschaft die besten Kenntnisse besaßen, und beschreibt uralte Rituale und Aberglauben. Doch wie so oft in der antiken Literatur erscheinen einige Punkte auch erstaunlich modern – nicht zuletzt, dass hinter jeder Anweisung nur ein Ziel steht: die Maximierung des Profits. Was soll angebaut werden, wie bewirtschaftet man den Boden, wie verhält man sich gegenüber seinen Angestellten und Sklaven, wie sollen diese sich verhalten … Alles folgt dem einen Grundprinzip: Wie kann ich mit meinem Gut den höchsten Ertrag erwirtschaften?
Wie ist das alles überliefert worden?
„Über den Ackerbau“ ist das einzige Werk Catos, das vollständig erhalten ist – und somit zugleich das älteste vollständig überlieferte lateinische Prosawerk. Interessanterweise ist in allen Manuskripten auch Varros Schrift enthalten, die den gleichen Namen trägt. Die älteste erhaltene Handschrift stammt aus dem 12. Jh. Die „Ursprünge“ sowie eine Reihe von Catos Reden haben nur in Fragmenten überlebt. Ein weiteres bekanntes Werk, das Catos Namen trägt, die „Aussprüche Catos“ (Dicta Catonis), ist erst im 3. Jh. n. Chr. zusammengestellt worden und war im Mittelalter sehr populär. Indes haben diese Sprüche mit Cato wenig zu tun – außer dass natürlich nicht auszuschließen ist, dass er den einen oder anderen Spruch selbst verwendet oder geprägt hat. Aber wer kann das wissen …?
Der Gutsverwalter soll dafür sorgen, dass er lernt, alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten selbst zu verrichten, und er soll sie auch oft ausüben – so er nicht allzu müde wird dabei. Wenn er mitarbeitet, wird er nämlich wissen, wie den Sklaven zumute ist, und die Sklaven werden ausgeglichener sein bei der Arbeit. Außerdem wird er dann selbst sich weniger herumtreiben, und er wird besser schlafen. Er soll sich am Morgen als Erster aus dem Bett erheben, und er soll am Abend als Letzter zu Bett gehen. Vorher aber soll er sich versichern, dass Tür und Tor des Hofes verschlossen sind, dass jeder an dem für ihn vorgesehenen Platz schläft und dass die Ställe genügend Futter haben.
Um die Rinder muss er sich besonders sorgfältig kümmern. Er soll ein wenig nachgiebig sein mit den Ochsentreibern, damit sie sich mit mehr Freude um die Rinder kümmern. Er soll sich darum kümmern, dass Pflüge und Pflugscharen in Ordnung sind. Auch soll er sich hüten, auf unbrauchbarem Land zu pflügen oder Wagen oder Vieh darüberzuleiten. Wenn er hier nicht vorsichtig ist, verliert er leicht drei Jahre an Ernteerträgen. Das Vieh muss sorgfältig eingestreut werden, und er muss sich um die Hufpflege kümmern. Er soll dafür sorgen, dass Vieh und Lasttiere nicht die Räude bekommen; sie entsteht, wenn nicht genug gefüttert wird und die Tiere nass werden. Sieh zu, dass du alles zeitig tust; denn so ist es in der Landwirtschaft: Wenn man bei einer Sache zu spät dran ist, dann ist man bei allem zu spät dran.
[Cato, agr. cult. 5.5]
Was bleibt?
Die Werke Catos lebten vielleicht in erster Linie dadurch fort, dass sie seine Weltanschauung transportierten. Hier ein Beispiel aus der Antike: Wer wäre besser geeignet, über Vor- und Nachteile des Alter(n)s zu sprechen als Cato d. Ä. – der „große alte Mann“ der Römischen Republik, Verfechter alter Sitten und Moral, der selbst unvorstellbare 85 Jahre alt wurde? Ganz folgerichtig stellt Cicero ihn in den Mittelpunkt seiner Schrift: „Cato der Ältere über das Alter“. Es ist ein fiktives philosophisches Gespräch zwischen Cato, dem Sohn des Scipio Africanus und dem Politiker und Terenz-Freund Laelius. Cato vertritt hier die Ansicht, dass es nicht am hohen Alter liegt, wenn jemand seine Rolle in der Gesellschaft nicht mehr ausfüllen kann, sondern an mangelnder Gesundheit – wenn man sich gesund ernähre und regelmäßig, aber nicht übermäßig Sport treibe, so Cato, könne man auch im hohen Alter noch leistungsfähig sein. Ein Urteil, dass auch heute noch jeder Personal Trainer oder Mediziner unterschreiben würde.