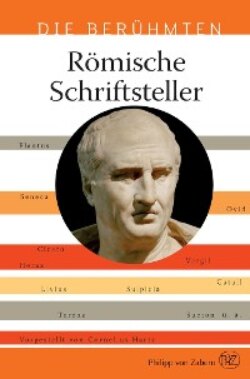Читать книгу Römische Schriftsteller - Cornelius Hartz - Страница 11
Von Schwiegermüttern und Eunuchen
ОглавлениеTerenz
Name: Publius Terentius Afer
Lebensdaten: ca. 195/190–159 v. Chr.
Literarische Gattung: Komödie
Werke: „Die Schwiegermutter“ (Hecyra),
„Die Brüder“ (Adelphoe) u.a.
Ein Schwarzer, der als Sklave aus Afrika nach Rom kommt und zu einem der größten Dichter seiner Zeit wird: Das ist nicht nur für das 2. Jh. v. Chr. eine erstaunliche Karriere. Terenz aber gelang genau das – denn sein Beiname „Afer“ bedeutet nichts anderes als: „Afrikaner“.
„Es giebt keinen lateinischen Schriftsteller, den genau zu kennen und zu studieren mehr Vortheil bringe, als den Terenz. Denn da es der erste Vorzug der Rede ist, zu dem, was man sagen will, den eigentlichen passendsten Ausdruck zu finden, so wird man hierin keinen größeren Meister finden als den Terenz, und er verdient es ganz, dass man ganz besondre Mühe, und den größten Fleiß auf ihn verwende.“
Philipp Melanchthon
Wer war das?
Etwa in den 180er Jahren v. Chr. kam Publius Terentius Afer aus Nordafrika, evtl. aus Karthago (im heutigen Tunesien), nach Rom, als Sklave eines Senators mit Namen Publius Terentius Lucanus, der ihn ausbilden ließ. Sein Geburtsname ist unbekannt, aber nach seiner Freilassung nahm er, wie es der Konvention entsprach, den Namen seines Herrn an (s. S. 27). Er muss sich mit Lucanus gut verstanden haben, denn abgesehen von seiner Freilassung scheint es, als habe dieser ihn mit den prominentesten Römern seiner Zeit bekannt gemacht, und so freundete er sich u. a. mit Scipio und Laelius an. Bald war Terenz’ Name in aller Munde, und seine Komödien wurden immer populärer; hier mag auch die Exotik des Afrikaners eine Rolle gespielt haben. Im Jahre 159 v. Chr. brach Terenz dann zu einer Reise nach Griechenland auf, von der er nicht mehr lebend zurückkehren sollte.
Bürger zweiter Klasse – Freigelassene
Die Sklavenhaltung war ein wichtiger Grundpfeiler der Wirtschaft antiker Gesellschaften. Rein rechtlich war ein Sklave Eigentum seines Herrn. Doch gab es verschiedene Möglichkeiten, aus der Sklaverei entlassen zu werden: Viele Sklaven erhielten für ihre Arbeit einen (wenn auch meist geringen) Verdienst; sparte man genug, konnte man sich unter Umständen von seinem Besitzer freikaufen. Andererseits wurden viele Sklaven, besonders wenn sie sich gut führten, von ihren Herren auch ohne weitere Gegenleistung freigelassen. Häufig nach dem Tod ihres Herrn, wenn dieser im Testament verfügt hatte, dass diesem Sklaven oder jener Sklavin die Freiheit geschenkt werden sollte.
Diese sog. „Freigelassenen“(liberti), wie eben auch Terenz, hatten einen besonderen Rechtsstatus. Sie wurden mit der Freilassung zwar offiziell zu römischen Bürgern, genossen aber weniger Rechte, v. a. in politischer Hinsicht; dies traf dann sogar noch auf die Kinder der Freigelassenen zu (wie z. B. Horaz). Lebte ihr ehemaliger Besitzer noch, waren sie ihm außerdem weiterhin in gewisser Weise unterworfen – in der Frühzeit der Römischen Republik sogar noch „auf Leben und Tod“ (das sog. ius vitae necisque), im Laufe der Zeit wurde diese Abhängigkeit ein wenig abgemildert.
Wurde ein Sklave freigelassen, so erhielt er den römischen Namen (Vor- und Familiennamen) seines ehemaligen Herrn – wie bei einer Adoption; ihren ursprünglichen Namen führten viele Sklaven dann als Beinamen weiter.
Was schrieb er?
Terenz ist neben Plautus der zweite große Name der römischen Komödie. Doch gibt es drei große Unterschiede zwischen den beiden Dichtern: Terenz hat nur sechs Komödien verfasst (Plautus mindestens 20), die griechischen Vorlagen zu allen sechs Komödien sind bekannt (wenn auch nicht erhalten), und Terenz’ Komödien selbst sind alle vollständig überliefert – damit ist Terenz der älteste römische Schriftsteller, dessen Gesamtwerk erhalten ist. Die sechs Komödien, die er geschrieben hat, tragen (wiederum im Gegensatz zu Plautus) alle die Namen der griechischen Originale, nur in lateinischer Umschrift: Andria, Hecyra („Die Schwiegermutter“), Heautontimorumenos („Der Masochist“), Eunuchus („Der Eunuch“), Phormio und Adelphoe („Die Brüder“).
Ziemlich sicher ist, dass Terenz sich mehr an seine griechischen Vorlagen gehalten hat als Plautus. Dazu gehört, dass er noch einige andere Eigenheiten des Plautus über Bord warf: Der Anteil der gesungenen Partien ist sehr gering, kaum noch nachzuweisen, Wortspiele und vulgäre Witze kommen auch weniger vor. Terenz scheint es dabei vor allem um eine größere Wirklichkeitsnähe gegangen zu sein. Außerdem schaffte er sich so Platz für literarische Polemik und satirische Anklänge.
||Duo cum faciunt idem, non est idem.
„Wenn zwei das Gleiche tun, dann ist es nicht das Gleiche.“
„Theophrast, Plautus und Terenz waren meine Welt, die ich in dem engen Bezirk einer klostermäßigen Schule mit aller Bequemlichkeit studierte.“
Gotthold Ephraim Lessing
Wie ist das alles überliefert worden?
Dass die Komödien des Terenz so gut erhalten sind, liegt vor allem daran, dass er in der Spätantike und im Mittelalter zu den kanonischen lateinischen Schulautoren gehörte. So geht die moderne Überlieferung auch auf eine ganz alte Handschrift zurück: Sie stammt aus dem 4. oder 5. Jh., ist oft abgeschrieben worden, und es sind zudem Exemplare mit reichhaltigen Kommentaren erhalten. Darunter gibt es sogar ganz alte, wie die Kommentare des Philologen Donat (4. Jh.), der in seinen Randnotizen vermerkt hat, wo Terenz vom griechischen Original abweicht.
Philotis: Beim Pollux, wie wenige treue Liebhaber hat ein Freudenmädchen doch, oh Syra. Wie oft hat dieser Pamphilus nicht der Bacchis geschworen, in einer Weise, dass jede ihm wohl geglaubt hätte, sie nie zu betrüben, ihr Leben lang keine andere zur Frau zu nehmen. Tja, nun hat er geheiratet.
Syra: Genau deshalb ermahne ich dich und rate ich dir, hab mit keinem Mann Mitleid, den du in die Finger bekommst, nimm ihn aus, leer ihm die Taschen! Philotis: Wirklich, ganz ohne Ausnahme?
Syra: Ohne Ausnahme. Denn wisse: Keiner kommt zu dir, der dich nicht mit Schmeicheleien herumkriegen will, damit er möglichst viel erhält für geringe Gegenleistung. Willst du ihn dann nicht im Gegenzug über den Tisch ziehen?
Philotis: Und dennoch meine ich, wär’s Unrecht, alle gleich zu behandeln. Syra: Ist es denn Unrecht, sich am Gegner zu rächen, oder ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen? Ach, ich Arme! Warum habe ich nicht dein Alter und deine Figur – oder du meine Ansichten?
[Ter., Hec. 1–18]
Was bleibt?
Die wohl älteste deutsche Dramatikerin, Hrotsvith von Gandersheim, verfasste Mitte des 10. Jhs. ein Dramenbuch, das sich als Alternative zu den Komödien des Terenz verstand: Für den damaligen Geschmack waren diese nämlich immer noch äußerst frivol. Das Dramenbuch zeigt ganz folgerichtig Szenen, in denen sich vor allem keusche Jungfrauen unterhalten.
Erst in der Neuzeit, so scheint es, hat man mit Terenz auch inhaltlich wieder mehr anfangen können. Die größte Bedeutung hatte er dann natürlich im Bereich der Komödie. So bei Molière: L’école des maris („Die Schule der Ehemänner“, 1661) ist eine Adaption von Terenz’ Adelphoe, und auch Les Fourberies de Scapin („Die Schelmereien des Scapin“, 1671) ist nach Terenz-Motiven gestaltet. Lessing beruft sich in der Vorrede des 3. Teils seiner Schriften auf Terenz (und Plautus, s. o.), Friedrich Hildebrand Freiherr von Einsiedel-Scharfenstein übersetzte Terenz’ Stücke um 1800 am Weimarer Hof, Miguel de Cervantes bearbeitete die Hecyra, und Thornton Wilders Stück The Woman of Andros (1930) basiert auf der Andria.