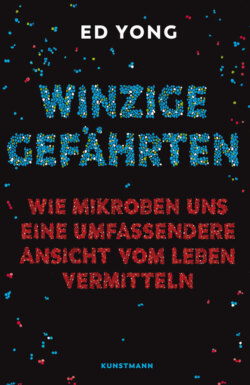Читать книгу Winzige Gefährten - Эд Йонг - Страница 6
PROLOG EIN BESUCH IM ZOO
ОглавлениеBABA SCHRECKT NICHT ZURÜCK. Die Horde aufgeregter Kinder, die sich um ihn versammelt hat, lässt ihn vollkommen unbeeindruckt. Ebenso wenig stört ihn die kalifornische Sommerhitze. Und auch um die Wattestäbchen, die über sein Gesicht, seinen Körper und seine Pfoten gestrichen werden, kümmert er sich nicht. Die Lässigkeit kann er sich leisten, denn er führt ein sicheres, gemütliches Leben. Sein Zuhause ist der Zoo von San Diego. Er trägt einen undurchdringlichen Panzeranzug, und derzeit hat er sich um den Bauch eines Zoowärters geschlungen. Baba ist ein Weißbauchschuppentier – ein überaus liebenswerter Zeitgenosse, der wie eine Kreuzung zwischen einem Ameisenbär und einem Kiefernzapfen aussieht. Er ist ungefähr so groß wie eine kleine Katze. Seine schwarzen Augen blicken traurig drein, und die Haare, die seine Wangen rahmen, sehen aus wie widerspenstige Koteletten. Sein rosafarbenes Gesicht läuft in einer spitzen, zahnlosen Schnauze aus, die sich gut dafür eignet, Ameisen und Termiten zu schlürfen. Die langen, gebogenen Klauen an den Enden seiner stämmigen Vorderbeine sind dazu gebaut, sich an Bäumen festzuklammern und Insektennester auseinanderzureißen. Und mit dem langen Schwanz kann er sich von Ästen (oder freundlichen Zoowärtern) herunterhängen lassen.
Aber sein mit Abstand auffälligstes Merkmal sind die Schuppen, die Kopf, Rumpf, Gliedmaßen und Schwanz bedecken. Diese hellorangefarbenen, sich überlappenden Platten bilden einen äußerst widerstandsfähigen Abwehrpanzer. Sie bestehen aus dem gleichen Material wie unsere Fingernägel: Keratin. Sie sehen auch tatsächlich fast aus wie Fingernägel und fühlen sich so an – allerdings wie große, lackierte und übel abgekaute. Die Schuppen sind flexibel, aber fest am Körper verankert; deshalb geben sie nach, wenn ich mit der Hand über Babas Rücken streiche, und richten sich anschließend wieder auf. Würde ich ihn in der umgekehrten Richtung streicheln, ich würde mich vermutlich schneiden – viele der Schuppen haben scharfe Kanten. Nur Babas Gesicht, Bauch und Pfoten sind ungeschützt, aber bei Bedarf kann er sie leicht verteidigen, indem er sich zu einer Kugel zusammenrollt. Dieser Fähigkeit verdankt das Tier seinen englischen Namen pangolin: Er kommt von dem malaiischen Wort pengguling, und das bedeutet so viel wie »etwas, das sich einrollt«.
Baba gehört zu den Botschaftern des Zoos – das sind besonders gefügige, gut ausgebildete Tiere, die an öffentlichen Vorführungen mitwirken. Die Zoowärter nehmen sie häufig mit in Pflegeheime oder Kinderkrankenhäuser, damit kranke Menschen sich an ihnen erfreuen und gleichzeitig etwas über ungewöhnliche Tiere lernen können. Aber heute hat er frei. Er hat sich um die Körpermitte des Wärters geschlungen wie die seltsamste Bauchbinde der Welt, und Rob Knight tupft eine Seite seines Gesichts vorsichtig mit einem Wattestäbchen ab. »Das ist eine der Tierarten, von denen ich schon als Kind gefesselt war – dass es so etwas überhaupt gibt«, sagt er.
Knight, ein großer, schlaksiger Neuseeländer mit kurz geschorenen Haaren, ist Fachmann für mikroskopisch kleine Lebensformen – ein Connaisseur des Unsichtbaren. Er erforscht Mikroben, das heißt Bakterien und andere Lebewesen, die nur mit dem Mikroskop zu sehen sind. Insbesondere begeistert er sich für solche, die im oder auf dem Körper von Tieren leben. Um sie zu studieren, muss er sie erst einmal sammeln. Schmetterlingssammler benutzen Netze und Glasgefäße; Knights Lieblingswerkzeug ist das Wattestäbchen. Er rollt die kleine Verdickung ein paar Sekunden lang über Babas Nase – lang genug, um das Ende des Stäbchens mit einer Menge Gürteltierbakterien zu versehen. Tausende, wenn nicht Millionen Zellen haben sich jetzt in dem weißen Gewebe verfangen. Knight bewegt sich vorsichtig, er will das Schuppentier nicht stören. Baba könnte nicht ungestörter aussehen. Ich bekomme den Eindruck, er würde, selbst wenn neben ihm eine Bombe hochginge, nur mit einem leichten Zappeln reagieren.
Baba ist nicht nur ein Schuppentier. Er ist auch eine wimmelnde Masse von Mikroben. Manche davon leben in seinem Inneren, vor allem im Darm. Andere sind auf seiner Oberfläche zu Hause: auf Gesicht, Bauch, Pfoten, Klauen und Schuppen. Knight wischt nacheinander über all diese Stellen. Auch von seinen eigenen Körperteilen hat er mehr als einmal Wischproben genommen, denn auch er ist Gastgeber einer Mikrobengemeinschaft. Das Gleiche gilt für mich und für jedes Tier im Zoo. Und auch für jedes andere Lebewesen auf der Erde mit Ausnahme einiger Labortiere, die von Wissenschaftlern absichtlich keimfrei gezüchtet wurden.
Jeder von uns verfügt über ein üppiges, mikroskopisches Sammelsurium, das zusammenfassend als Mikroflora oder Mikrobiom bezeichnet wird.1 Die Mikroben leben auf unserer Oberfläche, in unserem Körper und manchmal sogar innerhalb unserer eigenen Zellen. In ihrer großen Mehrzahl sind es Bakterien, aber es gibt auch andere winzig kleine Organismen, darunter Pilze (beispielsweise die Hefen) und Archaea, eine rätselhafte Gruppe, die uns später wieder begegnen wird. Außerdem Viren in unvorstellbarer Zahl – sie bilden ein Virom, das alle anderen Mikroorganismen und gelegentlich auch die Zellen des Wirtsorganismus infiziert. Von all diesen winzigen Dingern sehen wir nichts. Würden unsere eigenen Zellen allerdings auf rätselhafte Weise verschwinden, könnten wir vielleicht einen gespenstischen Mikrobenschimmer wahrnehmen, der die Umrisse des verschwundenen Tieres nachzeichnet.2
In manchen Fällen würde man das Fehlen der Zellen kaum bemerken. Zu den einfachsten Tieren gehören die Schwämme: Ihr unbeweglicher Körper ist niemals dicker als ein paar Zellen, und auch sie beherbergen ein gedeihendes Mikrobiom.3 Wenn man Schwämme unter dem Mikroskop betrachtet, sieht man das Tier manchmal kaum, weil es vollständig von Mikroben bedeckt ist. Die noch einfacheren Plattentiere oder Placozoa sind eigentlich nicht mehr als feuchte Matten aus Zellen; sie sehen aus wie Amöben, sind aber Tiere wie wir und besitzen ebenfalls Mikroben als Partner. Ameisen leben manchmal zu Millionen in Kolonien zusammen, aber auch jede einzelne Ameise ist wiederum eine Kolonie. Ein Eisbär, der allein durch die Arktis schlendert und in alle Richtungen nichts sieht als Eis, ist in Wirklichkeit vollständig eingehüllt. Streifengänse tragen Mikroben über den Himalaja, und Elefantenrobben nehmen sie mit in die Tiefen der Ozeane. Als Neil Armstrong und Buzz Aldrin zum ersten Mal einen Fuß auf den Mond setzten, war das auch ein Riesenschritt für die Gemeinschaft der Mikroben.
Als Orson Welles sagte: »Wir werden allein geboren, wir leben allein, wir sterben allein«, hatte er unrecht. Selbst wenn wir allein sind, sind wir nie allein. Unser Dasein ist eine Symbiose – dieser wunderbare Begriff bezeichnet das Zusammenleben verschiedenartiger Organismen. Manche Tiere werden von Mikroben besiedelt, wenn sie noch unbefruchtete Eizellen sind; andere nehmen im Augenblick der Geburt ihre ersten Partner auf. Anschließend gehen wir in ihrer Gegenwart durch unser ganzes Leben. Wenn wir essen, essen sie auch, wenn wir reisen, kommen sie mit. Wenn wir sterben, fressen sie uns auf. Jeder von uns ist sein eigener Zoo – eine Kolonie, die in einem einzigen Körper eingeschlossen ist. Ein Kollektiv zahlreicher Arten. Eine ganze Welt.
Diese Vorstellungen sind mitunter schwer zu fassen, nicht zuletzt weil wir Menschen eine weltweit verbreitete Spezies sind. Unsere Reichweite ist grenzenlos. Wir haben uns bis in die hintersten Winkel unserer blauen Murmel ausgebreitet, und manche von uns haben sie sogar verlassen. Da mag es ein seltsamer Gedanke sein, dass so manches Dasein sich in einem Darm oder in einer einzelnen Zelle abspielt, und ebenso mag es merkwürdig erscheinen, sich unsere Körperteile als hügelige Landschaften vorzustellen. Und doch sind sie es. Die Erde beherbergt eine Fülle verschiedener Ökosysteme: Regenwälder, Graslandschaften, Korallenriffe, Wüsten, Salzmarschen, und jedes davon hat seine eigene Artengemeinschaft. Aber auch ein einzelnes Tier ist voller Ökosysteme. Haut, Mund, Darm, Genitalien – jedes Organ, das in einer Verbindung mit der Außenwelt steht, besitzt seine eigene, charakteristische Mikrobengemeinschaft.4 Alle Prinzipien, mit denen Ökologen die kontinentweiten, via Satellit sichtbaren Ökosysteme beschreiben, gelten auch für die Ökosysteme in unserem Körper, die wir mit dem Mikroskop betrachten. Wir können über die Vielfalt der Mikrobenarten sprechen. Wir können Nahrungsnetze zeichnen, in denen verschiedene Lebewesen sich gegenseitig fressen und gefressen werden. Wir können einzelne wichtige Mikroben herausgreifen, die in ihrer Umwelt einen überproportional großen Einfluss ausüben – ähnlich wie Seeotter oder Wölfe. Wir können Mikroorganismen, die Krankheiten auslösen – Krankheitserreger –, als invasive Arten betrachten wie Aga-Kröten oder Feuerameisen. Den Darm eines Menschen, der an einer entzündlichen Darmkrankheit leidet, können wir mit einem sterbenden Korallenriff oder einem brach liegenden Acker vergleichen: Er ist ein misshandeltes Ökosystem, in dem das Gleichgewicht der Organismen verloren gegangen ist.
Was solche Ähnlichkeiten bedeuten, ist klar: Wenn wir eine Termite, einen Schwamm oder eine Maus betrachten, werfen wir auch einen Blick auf uns selbst. Diese Tiere beherbergen vielleicht andere Mikroben als wir, aber die Bündnisse unterliegen den gleichen Prinzipien. Ein Tintenfisch, dessen Leuchtbakterien nur nachts glimmen, liefert uns Aufschlüsse über das tägliche Auf und Ab der Bakterien in unserem Darm. Ein Korallenriff, in dem die Mikroben wegen Wasserverschmutzung oder Überfischung Amok laufen, gibt einen Hinweis darauf, welches Chaos in unserem Darm ausbricht, wenn wir ungesunde Lebensmittel oder Antibiotika zu uns nehmen. Eine Maus, deren Verhalten sich unter dem Einfluss ihrer Darmmikroben ändert, sagt uns etwas über die weitreichenden Einflüsse, die unsere eigenen Gefährten in unserem Geist ausüben. Über die Mikroben finden wir trotz unseres unglaublich unterschiedlichen Lebens die Einheit mit unseren Mitgeschöpfen. Keines von ihnen lebt isoliert; ihr Dasein bewegt sich immer in einem mikrobiologischen Zusammenhang und umfasst den ständigen Austausch zwischen großen und kleinen Arten. Mikroben – auch Mikroorganismen genannt – wechseln nicht nur zwischen verschiedenen Tieren hin und her, sondern auch zwischen unserem Körper und dem Boden, dem Wasser, der Luft, Gebäuden und anderen Elementen unserer Umwelt. Sie verbinden uns miteinander und mit der Welt.
Alle Zoologie ist eigentlich Ökologie. Ohne etwas über unsere Mikroben und unsere Symbiose mit ihnen zu wissen, können wir das Leben der Tiere nicht vollständig verstehen. Und wir können unser eigenes Mikrobiom nicht umfassend einschätzen, wenn wir nicht wissen, wie das Mikrobiom anderer Arten deren Leben bereichert und beeinflusst. Wir müssen das Panorama des gesamten Tierreichs betrachten und gleichzeitig die verborgenen Ökosysteme, die in jedem Lebewesen stecken, aus der Nähe betrachten. Wenn wir uns Käfer und Elefanten ansehen, Seeigel und Regenwürmer, Eltern und Freunde, dann sehen wir Individuen, die als Haufen von Zellen in einem einzigen Körper ihren Weg durchs Leben gehen, angetrieben von einem einzigen Gehirn und gelenkt von einem einzigen Genom. Aber das ist nur angenehme Fiktion. In Wirklichkeit sind wir, jeder und jede Einzelne von uns, ganz viele. Sind immer ein »Wir« und niemals nur ein »Ich«. Vergessen wir Orson Welles, und hören wir auf Walt Whitman: »Ich bin groß, ich enthalte Vielheiten.«5