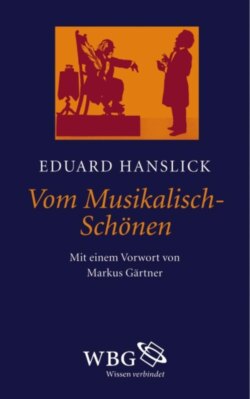Читать книгу Vom Musikalisch-Schönen - Eduard Hanslick - Страница 13
b) Die Gefühle sind nicht Zweck der Musik
ОглавлениеDie Musik – so wird uns gelehrt – kann nicht durch Begriffe den Verstand unterhalten, wie die Dichtkunst, ebensowenig durch sichtbare Formen das Auge, wie die bildenden Künste, also muß sie den Beruf haben, auf die Gefühle des Menschen zu wirken. »Die Musik hat es mit den Gefühlen zu thun.« Dieses »zu Thun haben« ist einer der charakteristischen Ausdrücke der bisherigen musikalischen Aesthetik. Worin der Zusammenhang der Musik mit den Gefühlen, bestimmter Musikstücke mit bestimmten Gefühlen bestehe, nach welchen Naturgesetzen er wirke, nach welchen Kunstgesetzen er zu gestalten sei, darüber ließen uns diejenigen vollkommen im Dunkeln, die eben damit »zu thun hatten.« Gewöhnt man sein Auge ein wenig an dieses Dunkel, so gelangt man dahin, zu entdecken, daß in der herrschenden musikalischen Anschauung die Gefühle eine doppelte Rolle spielen.
Fürs Erste wird als Zweck und Bestimmung der Musik aufgestellt, sie solle Gefühle oder »schöne Gefühle« erwecken. Fürs Zweite bezeichnet man die Gefühle als den Inhalt, welchen die Tonkunst in ihren Werken darstellt.
Beide Sätze haben das Aehnliche, daß der eine genau so falsch ist, wie der andere.
Der erstere darf uns nicht lange beschäftigen, da die neuere Philosophie den Irrthum längst widerlegt hat, als liege der Zweck eines Schönen überhaupt in einer gewissen Tendenz auf das Fühlen der Menschen. Das Schöne hat seine Bedeutung in sich selbst, es ist zwar schön nur für das Wohlgefallen eines anschauenden Subjects, aber nicht durch dasselbe. Wie die Schlange in Goethe’s Märchen vollendet es seinen Kreis in sich allein, unbekümmert um die magische Kraft, mit der es sogar das Todte wiederbelebt. Das |4| Schöne hat nichts Anderes zu thun als schön zu sein, mag es gleich immerhin leiden, daß wir außer dem Anschauen – der eigentlich ästhetischen Thätigkeit – auch im Fühlen und Empfinden ein Uebriges thun.
|26|»Gefühl« und »Empfindung«, diese beiden unaufhörlich verwechselten Begriffe, müssen wir, ehe unsre Untersuchung beginnen kann, streng unterscheiden.
Empfindung ist das Wahrnehmen einer bestimmten Sinnesqualität: eines Tons, einer Farbe. Gefühl das Bewußtwerden einer Förderung oder Hemmung unsres Seelenzustandes, also eines Wohlseins oder Mißbehagens. Wenn ich den Geruch oder Geschmack eines Dinges, dessen Form, Farbe oder Ton mit meinen Sinnen einfach wahrnehme (percipire), so empfinde ich diese Qualitäten; wenn Wehmuth, Hoffnung, Frohsinn oder Haß mich merkbar über den gewöhnlichen Seelenzustand emporheben oder unter denselben herabdrücken, so fühle ich. (In dieser Begriffsbezeichnung stimmen die älteren Philosophen mit den neueren Physiologen überein, und wir mußten sie unbedingt den Benennungen der Hegel’schen Schule vorziehen, welche bekanntlich innere und äußere Empfindungen unterscheidet.)
Das Schöne trifft zuerst unsere Sinne. Dieser Weg ist ihm nicht eigenthümlich, es theilt ihn mit allem überhaupt Erscheinenden. Die Empfindung ist Anfang und Bedingung des ästhetischen Gefallens und bildet erst die Basis des Gefühls, welches stets ein Verhältniß und oft die complicirtesten Verhältnisse voraussetzt. Empfindungen zu erregen bedarf es nicht der Kunst, ein einzelner Ton, eine einzelne Farbe kann das. Wie gesagt werden beide Ausdrücke willkürlich vertauscht, meistens aber in älteren Werken »Empfindung« genannt, was wir als »Gefühl« bezeichnen. Unsre Gefühle also, meinen jene Schriftsteller, solle die Musik erregen und uns abwechselnd mit Andacht, Liebe, Jubel, Wehmuth erfüllen.
Solche Bestimmung hat aber in Wahrheit weder diese noch eine andere Kunst. Das Organ, womit das Schöne aufgenommen wird, ist nicht das Gefühl, sondern die Phantasie, als die Thätigkeit des reinen Schauens. (Vischer’s Aesth. §. 384.)
Nahezu merkwürdig ist es, wie die Musiker und älteren Aesthetiker |5| sich nur in dem Contrast von »Gefühl« und »Verstand« bewegen, als läge nicht die Hauptsache gerade inmitten dieses angeblichen Dilemmas. Aus der Phantasie des Künstlers entsteigt das Tonstück für die Phantasie des Hörers. Freilich ist die Phantasie gegenüber dem Schönen nicht blos ein Schauen, sondern ein Schauen mit Verstand, d. i. Vorstellen und Urtheilen, letzteres natürlich mit solcher Schnelligkeit, daß die einzelnen Vorgänge uns gar nicht zum |27|Bewußtsein kommen, und die Täuschung entsteht, es geschehe unmittelbar, was doch in Wahrheit von vielfach vermittelnden Geistesprocessen abhängt. Das Wort »Anschauung,« längst von den Gesichtsvorstellungen auf alle Sinneserscheinungen übertragen, entspricht überdies trefflich dem Acte des aufmerksamen Hörens, welches ja in einem successiven Betrachten der Tonformen besteht. Die Phantasie ist natürlich kein abgeschlossenes Gebiet: so wie sie ihren Lebensfunken aus den Sinnesempfindungen zog, sendet sie wiederum ihre Radien schnell an die Thätigkeit des Verstandes und des Gefühls aus. Dies sind für die echte Auffassung des Schönen jedoch nur Grenzgebiete.
In reiner Anschauung genießt der Hörer das erklingende Tonstück, jedes stoffliche Interesse muß ihm fern liegen. Ein solches ist aber die Tendenz, Affecte in sich erregen zu lassen. Ausschließliche Bethätigung des Verstandes durch das Schöne verhält sich logisch anstatt ästhetisch, eine vorherrschende Wirkung auf das Gefühl ist noch bedenklicher, nämlich geradezu pathologisch.
Alles das, von der allgemeinen Aesthetik längst entwickelt, gilt gleichmäßig für das Schöne aller Künste. Behandelt man also die Musik als Kunst, so muß man die Phantasie und nicht das Gefühl für die ästhetische Instanz derselben erkennen. Der bescheidene Vordersatz scheint aber darum sehr räthlich, weil bei dem wichtigen Nachdruck, welcher unermüdlich auf die durch Musik zu erzielende Sänftigung der menschlichen Leidenschaften gelegt wird, man in der That oft nicht weiß, ob von der Tonkunst als von einer polizeilichen, einer pädagogischen oder einer medicinischen Maßregel die Rede ist.
Die Musiker sind aber weniger in dem Irrthume befangen, alle Künste gleichmäßig den Gefühlen vindiciren zu wollen, als sie darin vielmehr etwas specifisch der Tonkunst Eigenthümliches sehen. Die |6| Kraft und Tendenz, auf die Gefühle des Hörers zu wirken, sei es eben, was die Musik vor den übrigen Künsten charakterisire. Wo »Gefühl« nicht einmal von »Empfindung« getrennt wurde, da kann von einem tieferen Eingehen in die Unterschiede des Ersteren umsoweniger die Rede sein: sinnliche und intellectuelle Gefühle, die chronische Form der Stimmung, die acute des Affectes, Neigung und Leidenschaft sowie die eigenthümlichen Färbungen dieser als »pathos« der Griechen und »passio« der neueren Lateiner, wurden in bunter Mischung nivellirt, und von der Musik lediglich ausgesagt, sie sei speciell die Kunst, Gefühle zu erregen.
|28|Allein ebensowenig wie wir diese Wirkung als die Aufgabe der Künste überhaupt anerkannten, können wir in ihr eine specifische Bestimmtheit der Musik erblicken. Einmal festgehalten, daß die Phantasie das eigentliche Organ des Schönen ist, wird eine secundäre Wirkung dieser auf das Gefühl in jeder Kunst vorkommen. Bewegt uns nicht mächtig ein bedeutendes Historiengemälde? Welche Andacht erwecken Raphael’s Madonnen, welch’ sehnsüchtige und frohe Stimmungen die Landschaften eines Poussin? Wird der Anblick des Straßburger Münsters oder der griechischen Marmorgestalten ohne Wirkung auf unser Fühlen bleiben? Dasselbe gilt von der Poesie, ja von mancher außerästhetischen Thätigkeit, z. B. religiöser Erbauung, Eloquenz u. a. Wir sehen, daß die übrigen Künste ebenfalls stark genug auf das Gefühl einwirken. Den angeblich principiellen Unterschied derselben von der Musik müßte man daher auf ein Mehr oder Weniger dieser Wirkung basiren. Ganz unwissenschaftlich an sich, hätte dieser Ausweg obendrein die Entscheidung: ob man stärker und tiefer fühle bei einer Mozart’schen Symphonie oder bei einem Trauerspiel Shakespeare’s, bei einem Gedicht von Uhland oder einem Hummel’schen Rondo, füglich jedermann selbst zu überlassen. Meint man aber, die Musik wirke »unmittelbar« auf das Gefühl, die andern Künste erst durch die Vermittlung von Begriffen, so fehlt man nur mit andern Worten, weil, wie wir gesehen, die Gefühle auch von dem Musikalisch-Schönen nur in zweiter Linie beschäftigt werden sollen, unmittelbar nur die Phantasie. Unzählige Mal wird in musikalischen Abhandlungen die Analogie herbeigerufen, die zweifellos zwischen der Musik und der Baukunst besteht. |7| Ist aber je einem vernünftigen Architekten hergefallen, die Baukunst habe den Zweck, Gefühle zu erregen, oder es seien diese der Inhalt derselben?
Jedes wahre Kunstwerk wird sich in irgend eine Beziehung zu unserm Fühlen setzen, keines in eine ausschließliche. Man sagt also gar nichts für das ästhetische Princip der Musik Entscheidendes, wenn man sie durch ihre Wirkung auf das Gefühl charakterisirt.
Dennoch will man dem Wesen der Musik immer von diesem Punkte aus beikommen. Dennoch wird stets die Besprechung eines Tonwerks mit der »Empfindung« angehoben, die es hervorruft, und Lob oder Tadel nach dem Maß der eigenen subjectiven Affection bestimmt. Als wenn man das Wesen des Weines ergründete, indem man sich betrinkt! Die Erkenntniß eines Gegenstandes und dessen unmittelbare Wirkung auf unsre Subjectivität sind himmelweit verschiedene |29|Dinge, ja man muß der letzteren in eben dem Maße sich zu entwinden wissen, als man der ersteren nahe kommen will. Das Verhalten unsrer Gefühlszustände zu irgend einem Schönen ist vielmehr Gegenstand der Psychologie als der Aesthetik. Sei die Wirkung der Musik so groß oder so klein als sie wolle – von ihr darf man nicht ausgehen, wenn man das Wesen dieser Kunst zu erforschen unternimmt. Hegel hat erschöpfend gezeigt, wie die Untersuchung der »Empfindungen«, welche eine Kunst erweckt, ganz im Unbestimmten stehen bleibt und gerade vom eigentlichen, concreten Inhalt absieht. »Was empfunden wird,« sagt er, »bleibt eingehüllt in der Form abstractester, einzelner Subjectivität und deshalb sind auch die Unterschiede der Empfindung ganz abstracte, keine Unterschiede der Sache selbst.« (Aesthetik 1, 42).
Eignet der Tonkunst wirklich eine specifische Kraft des Eindruckes (wie wir sie bald näher betrachten werden), so muß man von diesem Zauber um so vorsichtiger abstrahiren, um an das Wesen seiner Ursache zu gelangen. Unterdessen vermengt man unablässig Gefühlsaffection und musikalische Schönheit, anstatt sie in wissenschaftlicher Methode getrennt darzustellen. Man klebt an der unsichern Wirkung musikalischer Erscheinungen anstatt in das Innere der Werke zu dringen und aus den Gesetzen ihres eigenen Organismus zu erklären, was ihr Inhalt ist, worin ihr Schönes besteht. Man beginnt |8| vom subjectiven Eindruck und folgert auf das Wesen der Kunst. Das sind Rückschlüsse vom Unselbstständigen auf das Selbstständige, vom Bedingten auf das Bedingende.
Ueberdies ist der Zusammenhang eines Tonstücks mit der dadurch hervorgerufenen Gefühlsbewegung kein nothwendig causaler. Unter verschiedenen Nationalitäten, Temperamenten, Altersstufen und Verhältnissen, ja selbst unter Gleichheit aller dieser Bedingungen bei verschiedenen Individuen, wird dieselbe Musik sehr ungleich wirken. Wir brauchen gar nicht die Indianer und Karaiben zu incommodiren, die gewöhnlich beliebten Hilfstruppen, wenn es sich um die »Verschiedenheit des Geschmacks« handelt, – es genügt Ein europäisches Concertpublikum, dessen eine Hälfte in Beethoven’s Symphonien seine stärksten, höchsten Regungen geweckt fühlt, während die andere darin nur »schwerfällige Verstandesmusik« und »gar kein Gefühl« findet. In manchem Augenblick regt uns ein Musikstück zu Thränen auf, ein andermal läßt es kalt, und tausend äußere Verschiedenheiten können hinreichen, dessen Wirkung tausendfach zu verändern |30|oder zu annulliren. Der Zusammenhang musikalischer Werke mit gewissen Stimmungen besteht nicht immer, überall, nothwendig, als ein absolut Zwingendes.
Selbst dort, wo wir den wirklich vorhandenen Eindruck betrachten, entdecken wir in ihm oft statt des Nothwendigen Conventionelles. Nicht blos in Form und Sitte, auch am Denken und Fühlen bildet sich im Lauf der Zeiten vieles Uebereinstimmende, Ueberkommene, das uns im Wesen der Dinge selbst zu stecken scheint, welche dennoch kaum mehr davon wissen, als die Buchstabenzeichen von der Bedeutung, die sie eben nur für uns haben. Dies ist besonders bei Musikgattungen der Fall, welche bestimmten äußeren Zwecken dienen, als Kirchen-, Kriegs-, Theatercompositionen. In den letzteren findet man eine wahre Terminologie für die verschiedensten Gefühle, eine Terminologie, die den Componisten und Hörern eines Zeitalters so geläufig wird, daß sie im einzelnen Falle nicht den mindesten Zweifel darüber haben. Spätere Zeiten bekommen ihn aber. Ja, wir begreifen oft kaum, wie unsre Großeltern diese Tonreihe für einen adäquaten Ausdruck gerade dieses Affectes ansehen konnten.
|9| Jede Zeit und Gesittung bringt ein verschiedenes Hören, ein verschiedenes Fühlen mit sich. Die Musik bleibt dieselbe, allein es wechselt ihre Wirkung mit dem wechselnden Standpunkt conventioneller Befangenheit. Wie leicht und gern sich unser Fühlen überdies von den kleinlichsten Kunstgriffen überlisten läßt, davon erzählen unter Anderm die Instrumentalstücke mit besondern Mottos oder Ueberschriften. In den äußerlichsten Claviersächelchen, worin nichts steckt, »eitel Nichts, wohin mein Aug’ sich wendet,« ist man alsbald geneigt, »Sehnsucht nach dem Meere,« »Abend vor der Schlacht,« »Sommertag in Norwegen« und was des Unsinns mehr ist, zu erkennen, wenn nur das Titelblatt die Kühnheit besitzt, seinen Inhalt dafür auszugeben. Die Ueberschriften geben unserm Vorstellen und Fühlen eine Richtung, welche wir nur zu oft dem Charakter der Musik zuschreiben, eine Leichtgläubigkeit, gegen welche der Scherz einer Titelverwechselung nicht genug empfohlen werden kann.
So besitzt denn die Wirkung der Musik auf das Gefühl weder die Nothwendigkeit, noch die Stetigkeit, noch endlich die Ausschließlichkeit, welche eine Erscheinung aufweisen müßte, um ein ästhetisches Princip begründen zu können.
Die starken Gefühle selbst, welche Musik aus ihrem Schlummer wachsingt, und all’ die süßen, wie schmerzlichen Stimmungen, in die |31|sie uns Halbträumende einlullt, wir möchten sie nicht um Alles unterschätzen. Zu den schönsten, heilsamsten Mysterien gehört es ja, daß die Kunst solche Bewegungen ohne irdischen Anlaß, recht von Gottes Gnaden hervorzurufen vermag. Nur gegen die unwissenschaftliche Verwerthung dieser Thatsachen für ästhetische Principien legen wir Verwahrung ein. Lust und Trauer können durch Musik in hohem Grade erweckt werden; das ist richtig. Nicht in noch höherem vielleicht durch den Gewinnst des großen Treffers oder die Todeskrankheit eines Freundes? So lange man Anstand nimmt, deshalb ein Lotterieloos den Symphonien, oder ein ärztliches Bülletin den Ouvertüren beizuzählen, so lange darf man auch factisch erzeugte Affecte nicht als eine ästhetische Specialität der Tonkunst oder eines bestimmten Tonstücks behandeln. Es wird einzigauf die specifische Art ankommen, wie solche Affecte durch Musik hervorgerufen werden. Wir werden im IV. und V. Kapitel den Einwirkungen |10| der Musik auf das Gefühl die aufmerksamste Betrachtung widmen, und die positiven Seiten dieses merkwürdigen Verhältnisses untersuchen. Hier, am Eingang unsrer Schrift, konnte die negative Seite, als Protest gegen ein unwissenschaftliches Princip, nicht zu scharf hervorgekehrt werden.
Anmerkung
Es dünkt uns für den vorliegenden Zweck kaum nothwendig, den Ansichten, deren Bekämpfung uns beschäftigt, die Namen ihrer Autoren beizusetzen, da diese Ansichten keineswegs die Blüthe eigenthümlicher Ueberzeugungen, sondern vielmehr der Ausdruck einer allgemein gewordenen traditionellen Denkweise sind. Nur um einen Einblick in die ausgebreitete Herrschaft dieser Grundsätze zu gewähren, mögen einige Citate älterer und neuerer Musikschriftsteller hier Platz finden:
Mattheson: »Wir müssen bei jeder Melodie uns eine Gemüthsbewegung (wo nicht mehr als Eine) zum Hauptzweck setzen.« (Vollkomm. Capellmeister S. 143.)
Neidhardt: »Der Musik Endzweck ist, alle Affecte durch die bloßen Töne und deren Rhythmum, trotz dem besten Redner, rege zu machen.« (Vorrede zur »Temperatur.«)
|32|J.N. Forkel versteht unter den »Figuren in der Musik« dasselbe, was sie in der Dichtkunst und Redekunst sind, nämlich der Ausdruck der unterschiedenen Arten, nach welchen sich Empfindungen und Leidenschaften äußern.« (»Ueber die Theorie der Musik,« Göttingen 1777. S. 26.)
J. Mosel definirt die Musik als »die Kunst, bestimmte Empfindungen durch geregelte Töne auszudrücken.
C. F. Michaelis: »Musik ist die Kunst des Ausdrucks von Empfindungen durch Modulation der Töne. Sie ist die Sprache der Affecte« etc. (»Ueber den Geist der Tonkunst,« 2. Versuch. 1800. S. 29.)
Marpurg: »Der Zweck, den der Componist sich in seiner Arbeit vorsetzen soll, ist die Natur nachzuahmen . . . die Leidenschaften nach seinem Willen zu regen . . . die Bewegungen der Seele, die Neigungen des Herzens nach dem Leben zu schildern.« (Krit. Musikus, 1. Band 1750. 40. Stück.)
W. Heinse: »Der Hauptendzweck der Musik ist die Nachahmung oder vielmehr Erregung der Leidenschaften.« (Musik. Dialoge. 1805. S. 30.)
J. J. Engel: Eine Sinfonie, eine Sonate u. s. w. muß die Ausführung einer Leidenschaft, die aber in mannigfaltige Empfindungen ausbeugt, enthalten.« (»Ueber mus. Malerei.« 1780. S. 29).
|11| J. Ph. Kirnberger: »Ein melodischer Satz (Thema) ist ein verständlicher Satz aus der Sprache der Empfindung, der einen empfindsamen Zuhörer die Gemüthslage, die ihn hervorgebracht hat, fühlen läßt.« (Kunst des reinen Satzes. II. Theil S. 152.)
Pierer’s Universallexikon (2. Auflage): »Musik ist die Kunst, durch schöne Töne Empfindungen und Seelenzustände auszudrücken. Sie steht höher als die Dichtkunst, welche nur (!) mit dem Verstande erkennbare Stimmungen darzustellen vermag, da die Musik ganz unerklärliche Empfindungen und Ahnungen ausdrückt.«
G. Schilling’s Universallexikon der Tonkunst bringt unter dem Artikel »Musik« die gleiche Erklärung.
Koch definirt die Musik als die »Kunst ein angenehmes Spiel der Empfindungen durch Töne auszudrücken.« (Mus. Lexikon. »Musik.«)
A. André: »Musik ist die Kunst, Töne hervorzubringen, welche Empfindungen und Leidenschaften schildern, erregen und unterhalten.« (Lehrbuch der Tonkunst 1.)
|33|Sulzer: »Musik ist die Kunst, durch Töne unsre Leidenschaften auszudrücken, wie in der Sprache durch Worte.« (Theorie der schönen Künste.)
J. W. Böhm: »Nicht den Verstand, nicht die Vernunft, sondern nur das Gefühlsvermögen beschäftigen der Saiten harmonische Töne.« (Analyse des Schönen der Musik. Wien 1830. S. 62.)
Gottfried Weber: »Die Tonkunst ist die Kunst, durch Töne Empfindungen auszudrücken.« (Theorie der Tonsetzkunst, 2. Aufl. 1. Bd. S. 15.)
F. Hand: »Die Musik stellt Gefühle dar. Jedes Gefühl und jeder Gemüthszustand hat an sich und so auch in der Musik seinen besonderen Ton und Rhythmus.« »Man kann der Musik eine weit größere Bestimmheit (!) der Darstellung zuschreiben, als irgend eine Kunst besitzt; denn Gefühle vermag weder der malende Künstler so bestimmt zu zeichnen, . . . noch glückt es dem mimischen Darsteller.« etc. (Aesthetik der Tonkunst, 1. Band §§. 24.27.)
Amadeus Autodidaktus: »Die Tonkunst entquillt und wurzelt nur in der Welt der geistigen Gefühle und Empfindungen. Musikalisch melodische Töne (!) erklingen nicht dem Verstande, welcher Empfindungen ja nur beschreibt und zergliedert, . . . sie sprechen zu dem Gemüth »etc. (Aphorismen über Musik. Leipzig 1847. S. 329.)
Fermo Bellini: »Musica è l’arte, che esprime i sentimenti e le passione col mezzo di suoni.« (Manuale alla Musica. Milano, Riccardi [Ricordi] 1853.)
|12| Friedrich Thiersch, Allgemeine Aesthetik (Berlin 1846) § 18, S. 101: »Die Musik ist die Kunst, durch Wahl und Verbindung der Töne Gefühle und Stirnmungen des Gemüthes auszudrücken oder zu erregen.«