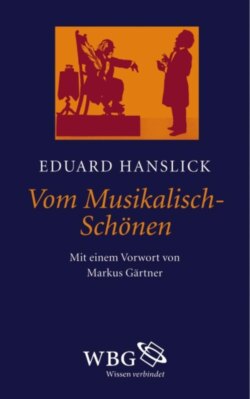Читать книгу Vom Musikalisch-Schönen - Eduard Hanslick - Страница 7
|7|Vorwort
ОглавлениеEs ist heute nur noch schwer vorstellbar, dass eine musikphilosophische Veröffentlichung derartige Wellen schlägt wie im Jahr 1854 Eduard Hanslicks »Vom Musikalisch-Schönen« (VMS). Wie eine Sense fuhr die Schrift in das Musikleben des 19. Jahrhunderts, teilte es in der Mitte, trennte in heute unüblicher Offenheit messerscharf das »Richtige« vom »Falschen« und geriet dabei selbst zum Gegenstand jahrzehntelanger Diskussionen. Dieses Buch bewegte die Gemüter, und es ist sicherlich nicht zu viel gesagt, wenn man vermutet, es habe zur Lagerbildung in »Neudeutsche« und »Konservative« oder, wie es oft verkürzend heißt, in »Wagnerianer« und »Brahminen« einen wesentlichen Teil beigetragen. Dadurch, dass die Publikation leidenschaftlich diskutiert wurde, blieb sie nicht nur in Erinnerung; vielmehr stieg auch die Nachfrage, und der Autor betreute bis zu seinem Tod im Jahr 1904 immerhin 10 Auflagen. Mit jeder Neuausgabe konnte die Kontroverse um VMS also noch einmal anheben. Dass Hanslick als scharfzüngiger Wiener Musikkritiker seine Thesen via Konzert- und Opern-Rezensionen popularisierte, trug zweifellos einen erheblichen Teil zur spannungsvollen Situation bei. Intendiert war diese indes zunächst nicht; sie muss als ein sich über die Jahre verschärfender Prozess gefasst werden, mithin als ein Rezeptionsphänomen. Im Veröffentlichungsjahr von VMS machte Johannes Brahms, von Robert Schumann enthusiastisch angekündigt, gerade seine ersten, noch unsicheren Schritte im öffentlichen Licht, und Richard Wagner fing eben erst an, seine Musikdramen zu entwickeln. Besonders an der vorliegenden ersten Version des Textes würde der Vorwurf einer präzise platzierten und adressierten Kampfschrift sowieso abprallen, denn Erweiterungen in Richtung des Problemkreises »Neudeutsche Schule« erscheinen erst ab der zweiten Auflage mit |8|kleinen Spitzen im Vorwort und ab der vierten im unmittelbaren Vergleich mit Hector Berlioz. So heißt es 1858: »Nun, da ich die 2. Auflage zu veranstalten habe, sind zu Wagners Schriften noch Liszt’s Programm-Symphonien hinzugekommen, welche vollständiger, als es bisher gelungen ist, die selbstständige Bedeutung der Musik abdanken, und diese dem Hörer nur mehr als gestaltentreibendes Mittel eingeben.«1 Und dann 1874 mit Blick auf Berlioz: »Ihm ist Liszt mit seinen weit schwächeren symphonischen Dichtungen‹ nachgefolgt.«2 Zwar wird Wagners Opernstil von Anfang an heftig kritisiert, seine Schrift »Das Kunstwerk der Zukunft« (1849) aber erst ab der sechsten Auflage von 1881 in die große Fußnote am Ende des ersten Kapitels (S. 10–12) aufgenommen und damit der Gefühlsästhetik subsumiert. Der Prozess einer schleichenden Frontmachung gegen die Neudeutschen als Fraktion kann vom Traktat aus gesehen nur im Detail nachverfolgt werden. Konträr dazu steht in Hanslicks Autobiographie allerdings zu lesen: »Gleichzeitig erhoben sich lärmend die ersten enthusiastischen Stimmen für Wagners Opern und Liszts Programm-Sinfonien. Ich ließ meine eigenen Ideen über die Sache in mir arbeiten und reifen, bis sie sich zu der bekannten Abhandlung ›Vom Musikalisch-Schönen‹ gestalteten.«3 Aus der Retrospektive heraus kommt der Autor hier der eigenen Rezeption entgegen und stilisiert sich selbst als Gegner der neuen musikalischen Strömung – und das von allem Anfang an.
Die Ansichten über Musik, wie sie Hanslick vertrat, mussten allerdings den Bestrebungen Wagners und Liszts zutiefst zuwiderlaufen. Während jene eine durchaus noch in der Romantik wurzelnde, aber anwendungspraktisch wie politisch erweiterte Musikanschauung vertraten, argumentiert Hanslicks »Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst«, wie der vielsagende Untertitel lautet, zumindest vorderhand aus dem Geist der aufstrebenden Naturwissenschaften. In diesem Sinne mutet VMS als verlängerter Arm der Modernisierung an, welcher die Metaphysik vergangener Jahrzehnte mit dem Schlagwort der »verrotteten Gefühlsästhetik« (S. V) als veraltet zurückweist. Hanslick geht es um Objektivität, um den Kern eines Kunstwerks, welcher übrigbleibt, zieht man allen Ballast des subjektiven Zugriffs bei Komposition und Rezeption ab. Dabei sucht er nach eigener Aussage Anschluss an die »induktiv[e], naturwissenschaftlich[e] Methode« (S. 1), mit der er den subjektiven Eindruck wie Ausdruck zu umgehen gedachte. Ob ein solches antisubjektives wie antimetaphysisches Konzept |9|tatsächlich den Stempel »naturwissenschaftlich« verdient, darf man zu Recht bezweifeln. VMS zeigt sich, wie so viele Abhandlungen des 19. Jahrhunderts, als ein Produkt spekulativer Ästhetik. »Naturwissenschaftlich« könnte tatsächlich nur heißen: durch Experimente empirisch gesichert. Zutreffend ist lediglich, so Christoph Landerer, eine »spezifisch empirische Gesinnung [. . .], die materiell am Objekt orientiert bleibt«4.
Hanslicks Ideen einer objektbezogenen Kunstanschauung entstanden vor dem Hintergrund und als Gegenentwurf vor allem zur Hegel’schen Systemästhetik (welche die verschiedenen Kunstzweige aufeinander bezieht und in eine wertende Reihenfolge bringt) und favorisieren das Konzept der »Spezialästhetiken«. Das bedeutet, jede Einzelkunst solle aus ihren eigenen Gesetzen heraus und nicht als Teilmoment der übergreifenden Idee »Kunst« erklärt werden. Solche Überlegungen entstanden jedoch keineswegs aus dem Nichts heraus. An der Universität Prag hatte Hanslick die Denksysteme Johann Friedrich Herbarts5 und Bernhard Bolzanos6 kennen gelernt. Ihren Schriften entnahm er wesentliche Forderungen, deren sinn-, manchmal wortgetreue Übereinstimmung überraschen. Es erscheint nicht unerheblich zu erwähnen, dass jüngere Forschungen die Verbindung Herbart – Hanslick erst kürzlich wiederentdeckten. Seit Felix Printz’ Dissertation7 von 1918 galt der Fall Herbart als abgewiesen, obwohl sich bis dahin ältere Literatur stets auf den österreichischen Nationalphilosophen norddeutscher Herkunft bezogen hatte. Erst nachdem Dietmar Strauß 1990 unbekannte Materialien, nämlich Hanslicks Habilitationsgesuch8 vorlegte, gewann der Bezug wieder an Bedeutung.
Die Idee der »Spezialästhetiken« übernimmt Hanslick direkt von Herbart. Wer sich die Grundsätze der Musikästhetik begreiflich machen möchte, so Herbart, der sollte »sich zuvor bey irgend einem Capellmeister oder Organisten in die Lehre [begeben], um hier an dem Beyspiele der Musik zu erfahren, wie sich die allgemeine Ästhetik und Kunst zueinander verhalten«9. Und wenn er weiterhin bestimmt, worum es in der Musikästhetik eigentlich gehe, hört der Kundige bereits Hanslick reden: »Um das Schöne und Hässliche in der Musik zu erkennen, müssten Unterschiede solcher und anderer Töne nachgewiesen werden; es müsste also von Tönen die Rede sein.«10 Hanslicks Diktum, die Musik bestehe allein aus »tönend bewegten Formen«, erscheint hier in dem Sinne vorformuliert, als dass von allen anderen Bezügen der Musik zu Handlung, Historie, Assoziation und |10|Emotion abzusehen sei und die Beziehungen der Töne untereinander in den Mittelpunkt gestellt werden sollten. Herbart wendet sich dabei vor allem gegen den Gefühlsausdruck und geißelt den Usus seiner Zeit, Musik als ausgedrückte Emotion zum Zweck der Übertragung auf den Hörer anzusehen, »als ob das Gefühl, was durch sie etwa erregt wird, und zu dessen Ausdruck sie eben deshalb, wenn man will, sich gebrauchen lässt, den allgemeinen Regeln des einfachen und doppelten Kontrapunkts zum Grunde läge, auf denen ihr wahres Wesen beruht«11. Es ist das musikalische Denken, worauf Herbart als Psychologe hinauswill: »Die Musik hat ihren Verstand in sich selbst; und eben dadurch lehrt sie uns, dass wir nicht in irgend welchen Kategorien, sondern in dem Zusammenhange der Vorstellungen unter einander (von welcher Art auch immer) den Verstand zu suchen haben«, und eben nicht in außermusikalischen Vorstellungen, wie Hanslick sie dann an der Praxis der Neudeutschen Schule tadelt. Ins Extrem getrieben bedeutet dies, dass Musik völlig frei von den Produktions- und Darbietungsbedingungen ihrer Zeit entsteht und erklingt, das Schöne ewig schön bleibt und Entwicklungsprozesse z. B. in der Aufführungshistorie nicht stattfinden.
Zu bedenken bleibt, dass Hanslick in seinem schon erwähnten Habilitationsgesuch – »Vom Musikalisch-Schönen« wurde 1861 von der Wiener Universität als, wie man heute sagen würde, »habilitationsadäquate« Leistung angenommen – zwar explizit auf Herbart hinwies; die Erwähnung hatte womöglich allerdings mehr taktische Gründe, da der Herbartianismus (mit führenden Gelehrten wie Hanslicks Freund Robert Zimmermann) seinerzeit so etwas wie eine »Staatsdoktrin« (Boisits) der Donaumonarchie darstellte und Karrierechancen durchaus förderlich sein konnte. Dem krisengeschüttelten Vielvölkerstaat mussten solche Theorien verlockend erscheinen, »die erstens von eindeutigen, unwiderlegbaren Verhältnissen ausgehen (Wahrheit, Schönheit), zweitens als formale notwendigerweise apolitisch sind und damit drittens prinzipiell von jedem voraussetzungslos als übernational angenommen werden können«12. Konservative Politik förderte somit antirevolutionäre Ästhetik. Hanslicks Bekenntnis zu Herbart zahlte sich tatsächlich aus und ebnete ihm, der bis dato beim Wiener Unterrichtsministerium angestellt war, den Weg auf den ersten Lehrstuhl für Musikwissenschaft.
Man griffe jedoch zu kurz, wollte man Hanslick auf den Part des musikästhetischen Vollzugsorgans des Herbart’schen Formalismus |11|beschränken. Zu sehr scheinen bei Hanslick Theorien des Theologen und Mathematikers Bernard Bolzano durch, deren Bekanntschaft der spätere Starkritiker über seinen Vater Josef Adolf Hanslik sowie Robert Zimmermann gemacht haben könnte. Auch bei Bolzano findet man wieder eine Grundhaltung, der es vor allem auf Objektivität ankommt. In Bezug auf das Schöne dürfe das Vergnügen daran »auf keine andere Weise, als aus der bloßen Betrachtung des Gegenstandes hervorgehen«. Besonders Empfindungen, die der Kunstgegenstand bei seiner Rezeption erregen könnte, »müssen wir, wenn wir die reine Schönheit desselben beurtheilen wollen, völlig beiseite setzen, und nur die Frage allein untersuchen, ob er [der Kunstgegenstand] imstande sei, durch bloße Betrachtung [. . .] uns zu vergnügen. Vermag er dies nicht, so können wir ihn für alles andere, nur nicht für schön erklären.«13 Neben anderen Überschneidungspunkten, wie z. B. der Historisierung des musikalischen Materials, ist es besonders eine Übereinstimmung, die zurück auf Bolzano weist: die Beschreibung des künstlerischen Erlebens als das Erraten optionaler Weiterführungsmöglichkeiten. »Allein ich verlange in meiner Erklärung vom schönen Gegenstande, dass das Vergnügen, welches uns seine Betrachtung gewährt, nur eben daraus hervorgehe, weil wir nach Gewahrung einiger seiner Einrichtungen nicht solche, die aus ihnen schon folgen, sondern gewisse andere, die von den wahrgenommenen noch immer unabhängig sind, aber mit ihnen verbunden zur Bestimmung des ganzen Gegenstandes dienen, erraten haben.«14 Und auch bei Hanslick geht es um die geistvolle Variation, die rekursive Abwandlung und Fortführung bereits bestehender Modelle – nicht nur beim Produzieren, sondern auch beim Rezipieren von Musik. Er beschreibt den Hörprozess als »geistige Befriedigung, die der Hörer darin findet, den Absichten des Componisten fortwährend zu folgen und voran zu eilen, sich in seinen Vermuthungen hier bestätigt, dort angenehm getäuscht zu finden« (S. 78). Zudem fordert er unermüdliche Aufmerksamkeit, ein »Begleiten« der Komposition, quasi ein inneres Mitkomponieren: »Diese Begleitung kann sich bei verwickelten Compositionen bis zur geistigen Arbeit steigern« (S. 78f.). Im Gegensatz zu Wagners Wünschen nach einer halbsomnambulen, emotionalen Hörweise favorisiert Hanslick einen glasklaren, intellektuellen Zugriff.
Bereits unmittelbar nach Erscheinen der Erstauflage setzte die Rezeption von »Vom Musikalisch-Schönen« ein. Positive wie negative |12|Rezensionen gaben sich den Federkiel in die Hand und machten das kleine Büchlein zu einer Mediensensation. In die Hunderte geht die Anzahl der Bücher und Artikel, die sich bis Ende des 19. Jahrhunderts mit Hanslicks Prinzipienschrift in ihren verschiedenen Auflagen beschäftigten. Die gewichtigsten Beiträge zur Diskussion lieferten zunächst Robert Zimmermann15, Hermann Lotze16, Franz Brendel17 und August Wilhelm Ambros18, dann Ferdinand Peter Graf Laurencin19, später Friedrich von Hausegger20 und Arthur Seidl21. Die ersten vier Autoren bezogen sich dabei direkt auf die hier vorliegende Erstauflage. Eingedenk der sich anbahnenden Frontstellung zwischen Hanslick und den Vertretern der Neudeutschen Schule soll Brendels Rezension, obwohl musikhistorisch wichtig, in diesem Falle als notwendig entgegengesetzt außen vor gelassen und an eher abwägenden Besprechungen nachgezeichnet werden, wo – auch außerhalb der sogenannten musikalischen »Fortschrittspartei« – Einsprüche erhoben wurden, und welche Standpunkte die jeweiligen Autoren, die Hanslick später allesamt als Befürworter seiner Schrift darstellte, gleichzeitig als Vertreter bestimmter Denkrichtungen ausweisen.
Den Auftakt der Beschäftigung mit Hanslick machte 1854 der Philosoph Robert Zimmermann, mit dem der Rezensierte seit den gemeinsamen Studienjahren in Prag befreundet war. Bei Franz Exner hatten beide Herbarts Philosophie kennen gelernt, und so wurde Zimmermann selbst zum Herbartianer. Es überrascht daher kaum, dass er in seiner Rezension insbesondere Aspekte hervorhebt, die mit Herbart konform gehen, und im Gegenzug Ideen tadelt, die von Herbart abweichende Aussagen enthalten. Entsprechend formuliert er, Hanslick dabei verschärfend: »Das Schöne ist schön und bleibt schön, auch wenn es keine Gefühle erzeugt, ja auch wenn es weder geschaut noch betrachtet wird. Denn das Schöne beruht auf sich gleich bleibenden Verhältnissen. Wo gewisse Verhältnisse stattfinden, ist Schönheit, wo die entgegengesetzten, Häßlichkeit, wo disparate, weder jene noch diese vorhanden. Diese Verhältnisse sind unter allen Umständen dieselben« (Zimmermann, S. 313). Hanslicks »tönend bewegte Formen«, für die er immer wieder betonte, diese seien nicht »leer«, sondern »geisterfüllt« zu verstehen, werden hier zu herbartschen Vorstellungen umgemünzt und zeigen Zimmermann als Formalisten. Hanslick hingegen beschließt die erste Auflage, möglicherweise mit Blick auf den musikphilosophischen Common Sense, abschwächend-konzidierend damit, die Musik wirke, wohlgemerkt im Hörer, »nicht blos und |13|absolut durch ihre eigene Schönheit, sondern zugleich als tönendes Abbild der großen Bewegungen im Weltall. Durch tiefe und geheime Naturbeziehungen steigert sich die Bedeutung der Töne hoch über sie hinaus und lässt uns in dem Werke menschlichen Talents immer zugleich das Unendliche fühlen« (S. 104). Durch die Hintertür und quasi in letzter Sekunde wird hier die überkommene idealistische Musikanschauung wieder ins Wertesystem eingeführt, und Zimmermann kritisiert folgerichtig genau diesen Schluss als unnötigen Appendix: »Ueberflüssig erscheint uns, dass, wie der Verfasser fortfährt, diese reinen Tonverhältnisse noch etwas anderes als sich selbst zur Erscheinung bringen, z. B. ›bis zur Ahnung des Absoluten steigen‹. Das Absolute ist kein Tonverhältnis und also dünkt uns, auch nicht musikalisch. [. . .] Die musikalische Idee braucht keine ›Weltgesetze widerzuspiegeln‹ um schön zu sein, mit der Metaphysik hat sie nichts zu schaffen. Die sogenannte ›Gedankenmusik‹ ist ein musikalisches Unding; die stete Forderung, die Musik solle noch andere als musikalische ›Gedanken‹ ausdrücken, baarste Nichtästhetik« (Zimmermann, S. 314). Folgerichtig wirft Zimmermann Hanslick insgesamt eine gewisse Inkonsequenz vor: »Mich dünkt, [. . .] der Verfasser [hat] sich unwillkürlich durch Reminiscenzen derselben Ästhetik überraschen lassen, die er sonst so schlagend und siegreich bekämpft« (Zimmermann, S. 315). Die Kritik wirkte. In der zweiten Auflage von 1858 strich Hanslick die letzten Formulierungen seiner Abhandlung ersatzlos.22
Was Zimmermann ein »zu wenig«, das war dem Göttinger Religionswissenschaftler Hermann Lotze bereits ein »zu viel«. Und was Zimmermann besonders positiv herausstellte, den Ausschluss der Gefühle aus der Musikästhetik, das kritisiert Lotze in seiner Rezension, zuerst erschienen 1855 in den »Göttingischen Gelehrten Anzeigen« und wieder abgedruckt in seinen »Kleinen Schriften«, besonders nachdrücklich: »So lange wir unter dem Schönen etwas verstehen, was wir schätzen, bewundern und verehren, und dem wir nicht bloss die gleichgültige Betrachtung eines theoretischen Erkennens zuwenden, so lange werden wir auch zugestehn müssen, dass uns sein Werth im Gefühl gegenwärtig ist« (Lotze, S. 204). Er glaube nicht, dass wir, wie bei Hanslick, »in einem Gebilde, das aus reinem Schauen entstanden und durch reines Schauen wahrgenommen wird, das wiedererkennen, was uns als Kunstwerk begeistern und erheben soll« (Lotze, S. 205). Damit spricht sich der Religionswissenschaftler, |14|ganz wie er es aus liturgischen Zusammenhängen gewohnt war, für eine Nutzanwendung der Musik aus, wenn auch nur für den Menschen selbst (statt z. B. für die Institution Kirche). Obgleich man nicht – und da geht er mit Hanslick konform – genaue Äquivalenzen zwischen bestimmten, exakt benennbaren Gefühlen (Liebe, Hass, Zorn) und bestimmten Musiken aufzeigen kann, »warum können nicht an die Figuren der Tonkunst sich andere Gefühle knüpfen, die darum nicht unbestimmter sind, weil sie wegen des Mangels kenntlicher Objecte, auf die sie sich beziehen, grossentheils namenlos bleiben müssen?« (Lotze, S. 210). Auch der Inhaltslosigkeit der Musik (Hanslick meint natürlich Instrumentalmusik) widerspricht der Rezensent: »Gewiss also kann die Musik weder ein bestimmtes Element der Sittlichkeit, noch ein concretes Ereignis oder einen besonderen Gegenstand darstellen; sie gibt statt ihrer aller nur Figuren von Tönen, aber sie trägt auf diese Figuren den Gefühlswerth über, den für uns der Inhalt hat, an welchen sie erinnern, und nur durch diese Symbolik erscheint sie schön« (Lotze, S. 213). Die Aufgabe der Tonkunst ist für Lotze deshalb klar definiert: sie soll »das tiefe Glück [ausdrücken], das in diesem Baue der Welt liegt, und von welchem die Lust jedes einzelnen Gefühls nur ein besonderer Widerschein ist« (Lotze, S. 211) – und paraphrasiert damit, durch die gefühlsästhetische Brille hindurch, beinahe Hanslicks später gestrichenen Schluss. Was Zimmermann das Inkonsequenteste an »Vom Musikalisch-Schönen« war, das war Lotze das Wertvollste.
August Wilhelm Ambros unterscheidet sich von oben genannten Rezensenten dadurch, dass er eine ganze Buchpublikation gegen den ehemaligen Kollegen des Prager Davidsbundes wendet, obwohl er im Vorwort Hanslick zunächst dankt, »durch dessen geistreiche Abhandlung ›vom musikalischen Schönen‹ ich die reichsten Anregungen erhalten habe. Ich spreche dieses hier um so lieber mit der lebhaftesten Anerkennung aus, als ich im Buche selbst insbesondere gegen D[r]. Hansliks [Ambros benutzt die alte Prager Schreibweise] Ansichten von meinem Standpunkt aus oft bestreitend auftreten muß« (Ambros, S. IX). Gerade das Konzept der Spezialästhetiken läuft ihm dabei zuwider. Man kann das plastisch daran nachvollziehen, wie eine Bemerkung Hanslicks einen Gegenentwurf Ambros’ provoziert. In VMS heißt es im Vorwort, dass »letztere [die Spezialästhetiken] freilich in ganz anderer Weise zu begründen [sind], als durch ein bloßes Anpassen des allgemeinen Schönheitsbegriffs, weil dieser in jeder Kunst |15|eine Reihe neuer Unterschiede eingeht. Es will jede Kunst in ihren technischen Bestimmungen gekannt, will aus sich selbst begriffen und beurtheilt werden« (S. 2). Ambros reagiert darauf durch Festhalten des überkommenen Standpunktes: »Daß die einzelnen Künste nur prismatische Brechungen eines und desselben Lichtstrahles sind, hat heutzutage glücklicherweise jedermann einsehen gelernt« (Ambros, S. VIII). Doch Hanslick legt nach. In der sechsten Auflage von 1881 fügt er eine Fußnote ein, die Ambros’ Bezugspunkt, Robert Schumann, diskreditiert: »R. Schumann hat viel Unheil angestiftet mit seinem Satz (I, 43 der Gesammelten Schriften): ›Die Aesthetik der einen Kunst ist die der andern, nur das Material ist verschieden.‹«23 Hanslick und seine Gegner führen demnach einen Diskurs, der sich auch in den verschiedenen Auflagen von VMS widerspiegelt.
Ambros’ größtes Problem zeigt sich allerdings in Hanslicks analytischem Zugriff auf die Musik. So positioniert er sich in diesem Punkt bereits vorab: »Daß ich von manchem großen Werke nicht mit der Kälte des Anatomen, sondern mit der Wärme des Liebenden gesprochen habe, möge mir verziehen werden – ich hatte eben nicht die Leiche auf dem Sektionstisch, sondern die blühende, lebende Göttin vor mir« (Ambros, S. VII). Nicht nur wird hier Schumanns Rezension von Berlioz’ »Symphonie fantastique« aus dem Jahr 1834 aufgegriffen (Schumann spricht von einer Mörderkopf-Sektion als Analogon der musikalischen Analyse), sondern zudem wieder auf VMS reagiert. Auch Hanslick behält eine gewisse Scheu vor der »Section«, ohne ihr aber auszuweichen. Die Ergebnisse ließen die Schmerzen am »Operationstisch« schnell vergessen: »Solche Zergliederung macht ein Gerippe aus blühendem Körper, geeignet, alle Schönheit, aber auch« – und das ist für ihn das Ausschlaggebende – »alle falsche Deutelei zu zerstören« (S. 19). In der geforderten Exaktheit von Aussagen über Musik sieht Ambros allerdings nur seichten Formalismus, wenn er mit Bezug auf das Andante von Beethovens Fünfter Symphonie eine Persiflage auf das Prinzip der technischen Analyse verfasst: »Andante con moto, 3/8 Takt, As-dur. Singbares Thema, im Einklange von Viola und Violoncell gespielt, Bässe in einzelnen Pizzicatoschlägen – der letzte Takt des Themas von den Bläsern aufgenommen und zu einer neuen Phrase benützt – und so weiter. Statt im Apoll von Belvedere den schreitenden, zürnenden Gott zu sehen, der da kömmt [. . .] werden wir wohl thun, seine Muskeln gut zu zählen und seine Beine zu messen, die bekanntlich etwas zu lang sind« |16|(Ambros, S. 42). Für ihn besitzt die Musik sowohl »Stimmung«, d. h. Gefühl, als auch »Seele« (Ambros, S. 107). Dabei geht er wie Bolzano von einem Übertragungssystem aus, wenn er formuliert: »Der Künstler legt in das Kunstwerk seine Ideen deshalb nieder, damit sie durch dessen Vermittlung zu Ideen auch anderer Menschen werden. [. . .] Das leitende, sinnenfällige Medium bildet dabei das Kunstwerk« (Ambros, S. 184). In letzter Instanz bedeutet dies auch eine Ethik der Musik, denn die »Läugner des Inhaltes der Musik«, so Ambros, »die Aesthetiker des absoluten Formenspiels sind auf kunstphilosophischem Gebiet die Materialisten [. . .]. Siegt aber einmal die Materie, fällt die Menschheit ganz und gar der dunklen, schweren Hyle anheim [. . .]. Es wird eine Nacht der Barbarei einbrechen [. . .]« (Ambros, S. 186f.).
Um divergierende musikästhetische Standpunkte auszumachen braucht man demnach nicht erst in das Lager der expliziten Hanslick-Gegner zu schauen. Die oben näher beleuchteten Einwände belegen die Neuartigkeit des Hanslick’schen Ansatzes zwischen Idealismus, deren Restbestände Zimmermann kritisiert, und analytischem Zugriff, den Lotze und Ambros als inadäquat ablehnen. Doch bei aller Gegenwehr machte das Prinzip der Spezialästhetiken und des »Musikalisch-Schönen« auch Karriere, sowohl im theoretischen Diskurs als auch in der musikalischen Praxis. Verdutzt vermerkt der konservative Kritiker Alfred Heuß ein Überdauern des Prinzips »tönend bewegter Formen« gerade bei den jungen Komponisten der Weimarer Avantgarde. Aus Anlass des 100. Geburtstages Eduard Hanslicks im Jahr 1925 konstatiert er, niemand hätte vermutet, »dass Grundelemente der Schrift Vom Musikalisch-Schönen zu besonderer Bedeutung gelangen würden, und zwar nicht nur etwa in der Musikästhetik, sondern [. . .] auch in der Praxis der modernen Musik«24. Und Paul Bekker, in seiner ästhetischen Ausrichtung als Förderer der Avantgarde seinem Kritikerkollegen Heuß konträr entgegengesetzt, bemerkt in Bezug auf die Erste Symphonie Ernst Kreneks: »Hanslicks intuitiv aufhellendes Wort von der Musik als dem Spiel tönend bewegter Formen kommt in dieser jungen Kunst unserer Zeit wieder zu neuer, ungeahnter Geltung. Die Leidenschaft als Quelle der künstlerischen Gestaltung ist abgestopft, die Freude am Spiel des Klanges, an der verschiedenartigen Gesetzlichkeit seiner Bewegung, der Verschlingung und Entwirrung der Linien beherrscht das Schaffen.«25 Bolzanos »Vorausahnungen«, Hanslicks Freude darüber, sich hier |17|getäuscht, dort bestätigt zu sehen, geraten einmal mehr zum ästhetischen Tagesthema.
Im weiteren 20. Jahrhundert haben sich besonders sogenannte »Neoklassizisten« wie Igor Strawinsky und Paul Hindemith den Prinzipien Hanslicks angenähert. Zwar geht es ihnen vor allem um Musik als Handwerk, doch dies inkludiert notgedrungen Formulierungen, die auf den Konstruktcharakter von Musik rekurrieren und, wie folgende aus Strawinskys Text, an VMS denken lassen: »Die Elemente, auf die notwendigerweise diese spekulative Tätigkeit [das Komponieren] zielt, sind die Elemente des Tones und der Zeit. Die Musik ist jenseits dieser zwei Elemente nicht denkbar. [. . .] Im reinen Zustand ist die Musik ein freies Forschen des Geistes [. . .].«26 Und Paul Hindemith geht sogar so weit, in einem satirischen Brief an den oben genannten Alfred Heuß eine Kurzästhetik der absoluten Musik zu entwerfen, indem er, Hanslick überspitzend, Gefühle als kunstrelevanten Faktor aus der Musik kategorisch ausschließt: »Haben Sie jemals in Ihrem Leben gehört, dass es Musiker gibt, die ohne an ihren ganzen Saudreck von Perversitäten, Sadismen, Erotik und Frivolitäten zu denken, einfach Musik schreiben? Denen die Musik lediglich das ist, was sie in Wirklichkeit ist: eine schöne Kunst, ein wunderbares Spiel von Tönen, Rhythmen, Formen etc.? Und nicht das, was Sie und Ihre ganze Truppe als Musik anstieren: Darstellung von Gefühlen, Zeichnung von Charakteren und sonstiger Unfug. Musik ist Musik, sie kann höchstens Gefühle auslösen. Was sie darüber tut, ist Kitsch und Geschmier.«27
Wie die Hanslick-Rezeption und -Forschung im 21. Jahrhundert aussehen wird, kann zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht bestimmt werden. Immerhin fanden in der ersten Dekade bereits zwei internationale Hanslick-Kongresse statt (2004 in Wien und 2009 in Dublin), die auf ein verstärktes wissenschaftliches Interesse an dieser kantigen Figur der europäischen Musikgeschichte hinweisen. Dass Eduard Hanslick als Autor einer der grundlegenden musikästhetischen Schriften des 19. Jahrhunderts nicht in Vergessenheit gerät, dazu möchte nun auch vorliegende Neuausgabe von »Vom Musikalisch-Schönen« ihren bescheidenen Teil beitragen.
Oldenburg, im November 2009
Markus Gärtner
|18| Dietmar Strauß, Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen, 2 Bde., Bd. 1: Historisch-kritische Ausgabe, Mainz, London u. a. 1990, S. 10.
Ebd., S. 86.
Eduard Hanslick, Aus meinem Leben, hrsg. von Peter Wapnewski, ND Kassel 1987, S. 150.
Christoph Landerer, »Ästhetik von oben? Ästhetik von unten? Objektivität und ›naturwissenschaftliche‹ Methode in Eduard Hanslicks Musikästhetik«, in: Archiv für Musikwissenschaft 61 (2004), S. 38–53, hier S. 46.
Nadia Moro, Der musikalische Herbart. Harmonie und Kontrapunkt als Gegenstände der Psychologie und Ästhetik, Würzburg 2006.
Christoph Landerer, Eduard Hanslick und Bernard Bolzano. Ästhetisches Denken in Österreich in der Mitte des 19. Jahrhunderts (= Beiträge zur Bolzano-Forschung 17), Sankt Augustin 2004.
Felix Printz, Zur Würdigung des musikalischen Formalismus Eduard Hanslicks, München 1918.
Strauß, Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen, Bd. 2: Eduard Hanslicks Schrift in textkritischer Sicht, Mainz, London u. a. 1990, S. 143–145.
Johann Friedrich Herbart, Sämtliche Werke. In chronologischer Reihenfolge, hrsg. von K. Kehrbach und O. Flügel, 19 Bde., ND Aalen 1964, Bd. III, S. 330.
Ebd., Bd. IV, S. 112.
Ebd., Bd. IX, S. 110. Hervorhebung im Original.
Barbara Boisits, »Formalismus als österreichische Staatsdoktrin? Zum Kontext musikalischer Formalästhetik innerhalb der Wissenschaft Zentraleuropas«, in: Muzikološki Zbornik/Musicological Annual 40 (2004), S. 129–136, hier S. 136.
Bernard Bolzano, »Über den Begriff des Schönen«, in: ders., Untersuchungen zur Grundlegung der Ästhetik, hrsg. von Dietfried Gerhardus, Frankfurt 1972, S. 13f. Hervorhebungen im Original.
Ebd., S. 43.
Robert Zimmermann, »Zur Ästhetik der Tonkunst«, in: Oesterreichische Blätter für Literatur und Kunst. Beilage zur Oesterreichisch-kaiserlichen Wiener Zeitung, No. 47 vom 20. November 1854, S. 313–315. Seitenverweise im Folgenden im Haupttext.
Hermann Lotze, »Rezension von Eduard Hanslick. Vom Musikalisch-Schönen«, in: ders, Kleine Schriften, Bd. 3, Leipzig 1891, S. 200–214. Seitenverweise im Folgenden im Haupttext.
Franz Brendel, »Dr. Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen«, in: Neue Zeitschrift für Musik 42 (1855), S. 77–82, S. 89–91, S. 97–100.
August Wilhelm Ambros, Die Grenzen der Musik und Poesie. Eine Studie zur Ästhetik der Tonkunst, Leipzig 1855, Reprint Hildesheim und New York 1976. Seitenverweise im Folgenden im Haupttext.
Ferdinand Peter Graf Laurencin, Dr. Eduard Hanslicks Lehre vom Musikalisch-Schönen. Eine Abwehr, Leipzig 1859.
Friedrich von Hausegger, Die Musik als Ausdruck, Wien 1887.
Arthur Seidl, Vom Musikalisch-Erhabenen, Regensburg 2 1887.
S. 104: »Ihm wirkt [. . .]« bis »[. . .] das ganze Universum –«.
Strauß, Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen, Bd. 1, S. 23.
|19| Alfred Heuß, »Eduard Hanslick und die Gegenwart. Aus Anlass von Hanslicks 100. Geburtstag am 11. September«, in: Zeitschrift für Musik 92 (1925), S. 501– 505, hier S. 502.
Paul Bekker, »Ernst Kreneks Erste Symphonie. Erstaufführung im Frankfurter Museumskonzert«, in: Musikblätter des Anbruch 5 (1923), S. 16–18, hier S. 17f.
Igor Strawinsky, Musikalische Poetik, Mainz 1960, S. 20 und S. 33. Hervorhebungen im Original.
Zit. nach Oliver Hilmes, Der Streit ums Deutsche. Alfred Heuß und die Zeitschrift für Musik, Hamburg 2003, S. 130f. Kursivsatz im Original unterstrichen.