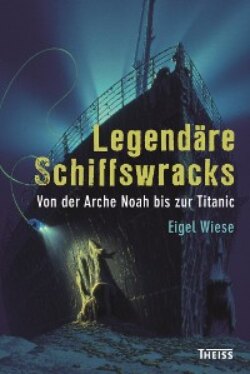Читать книгу Legendäre Schiffswracks - Eigel Wiese - Страница 10
Galeeren: Rudern für die Wissenschaft
ОглавлениеRuderboote erregen auf Hamburgs Außenalster eigentlich keine große Aufmerksamkeit mehr. Der älteste Ruderclub an der Alster wurde bereits 1836 gegründet. Dennoch zog eben dort ein gerudertes Schiff mit dem stolzen Namen „Victoria“ alle Blicke auf sich, stammte es doch aus einer wesentlich weiter zurückliegenden Epoche. Vorbild der Rekonstruktion war eine Römergaleere aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. Ein solches Schiff wurde vom Jahr 2007 an zum ersten Mal in Originalgröße nachgebaut und mitten in der Hansestadt auf der Alster getestet.
Eigentlich begann die Geschichte bereits 1984, als Bauarbeiter auf einem Grundstück in Oberstimm in der Nähe von Ingolstadt Reste von zwei hölzernen Schiffen entdeckten. Beim Einsatz ihrer schweren Baumaschinen hatten sie die Wracks allerdings schwer beschädigt. Das erste Wrack war komplett durchschlagen worden, das zweite am Schiffsboden in Mitleidenschaft gezogen.
Die geborgenen hölzernen Wrackteile wurden 1986 im Römisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM) nass gelagert, einem weltweit tätigen Forschungsinstitut für Archäologie, das von Bund und Ländern getragen wird und zur Leibniz-Gemeinschaft deutscher Forschungseinrichtungen gehört. Der dortige Konservator Olaf Höckmann ordnete die beiden Schiffe vom Typ her als Truppentransporter ein, die auch Passagiere mitnehmen konnten. Die mediterrane Bauweise war deutlich zu erkennen. Zwar waren Funde solcher antiken Schiffe im Mittelmeerraum keine Seltenheit, aber in diesem Fall handelte es sich um Binnenschiffe. Die hatte man bislang weitaus seltener entdeckt.
Noch immer waren die Wracks nicht vollständig geborgen, doch drängte bereits die Zeit: Denn als Folge einer Absenkung des Grundwasserspiegels war der Zustand der Hölzer gefährdet. So überlegte man 1993, die Wracks im Ganzen freizulegen. Nach den nun möglichen eingehenden Untersuchung gingen die Archäologen davon aus, dass die Wracks um das Jahr 107/108 n. Chr. herum sanken. Der Erdboden hatte sie 1900 Jahre lang so gut konserviert, dass sie mit nur geringen Restunsicherheiten rekonstruiert werden konnten, um Aufschluss über ihre Eigenschaften und die einstige Verwendung zu erhalten. Zur Ausstellung „Imperium Konflikt Mythos – 2000 Jahre Varusschlacht“ sollten sie fertig sein.
Gebaut haben dieses 16 Meter lange rekonstruierte Schiff Jugendliche der Einrichtung „Jugend in Arbeit“ in Hamburg-Harburg; mit Projekten wie diesem qualifizieren sie sich für einen Einstieg in das Berufsleben. Wissenschaftlicher Leiter des Projektes war Prof. Christoph Schäfer von der Universität Hamburg. Der Althistoriker ist in seiner Freizeit passionierter Segler. Derart sachkundig nahm er zunächst auf dem Ratzeburger See und dann auf der Hamburger Außenalster die Ruder- und Segeleigenschaften des Schiffes unter die Lupe. Bei der Beurteilung der antiken Technik half ihm die moderne Elektronik: Ein schwedischer Hersteller von Kompassen und Navigationsinstrumenten stellte Messgeräte zur Verfügung, die genau anzeigten, wie hoch man mit der Galeere an den Wind gehen konnte, also in die Richtung fahren konnte, aus der der Wind wehte, und dennoch optimale Fahrt machte. „Dabei konnten wir die Versetzung durch Wind und Strom herausrechnen. So haben wir exakte Daten bekommen und Polardiagramme erstellt.“
Christoph Schäfer zu seinen Erwartungen: „Wir haben bei dieser Galeere ein Rahsegel, das weit vorn im Bugbereich steht. Wir hatten also damit gerechnet, lediglich auf Raumschotkurs segeln zu können. So werden die Segeleigenschaften dieser Schiffe auch immer wieder in der Literatur beschrieben. Damit aber wäre der Einsatzbereich sehr eingeschränkt. Nach den wochenlangen Tests auf dem Ratzeburger See bei Windstärken von drei bis vier können wir sagen, das Schiff geht bis zu 85 Grad an den Wind. Das ist deutlich mehr als halber Wind. Dieser Wert ist auch schon versetzungsbereinigt. Das ist ein erstaunlich gutes Ergebnis.“ Gut ist auch die Geschwindigkeit, die das Schiff unter Segel bei den Tests erreichte: Sie betrug sechs Knoten.
Zu den guten Segeleigenschaften trägt auch der ausgeklügelte Lateralplan der Galeere bei. Christoph Schäfer: „Wir haben einen sehr schönen Kielsprung. So ist der Lateralplan deutlich kürzer als die Länge über alles. Zum Steuern nutzen wir eine Doppelruderanlage, die typisch ist für antike Schiffe. So etwas ist schon auf der Trajanssäule in Rom und anderen Darstellungen abgebildet.“
Begeistert ist der Historiker aber nicht nur von den Segeleigenschaften. Auch gerudert erwies sich die Galeere als schnelles und wendiges Schiff: „Das Schiff springt schnell an, es erreicht mit einer geübten Mannschaft in 20 Sekunden eine Geschwindigkeit von drei bis vier Knoten. Wir haben es also mit einem antiken Schnellboot zu tun.“
Für den Kampfeinsatz auf den Flüssen und Seen Germaniens musste es aber nicht nur schnell sein, sondern auch wendig: „Nach einer Woche Übung war die Besatzung in der Lage, das Schiff aus einer Marschfahrt von drei bis vier Knoten innerhalb von 30 Sekunden auf Gegenkurs zu bringen. Der Rekord lag sogar bei 21 Sekunden.“
Damit ist der Einsatzbereich eines solchen Schiffe eindeutig. Mit dem Seitenverhältnis des Rumpfes von 1:6 war es ein schlankes Schiff, das sich kaum dazu eignete, Waren zu transportieren und Handel zu treiben. Es war also ein reines Militärschiff, das dazu beitrug, als überlegenes Waffensystem die Gewässer Germaniens zu beherrschen. Es konnte schnell bis zu 22 Soldaten an ihre Einsatzorte bringen, Botschaften übermitteln, die Lage aufklären und war wegen seiner Wendigkeit und Geschwindigkeit nur schwer anzugreifen. Oder wie Christoph Schäfer es ausdrückt: „Mit einem Boot wie diesem waren die Flüsse Germaniens zu beherrschen.“ Dazu gehörten auch flache Gewässer, denn trotz seines Gewichtes von vier Tonnen hatte es einen Tiefgang von gerade einmal 50 Zentimetern.
Auf der Hamburger Außenalster testeten Studenten um Christoph Schäfer die Ruder- und Segeleigenschaften des nachgebauten Bootes. Es erwies sich als überraschend schnell.
Ein militärischer Vorteil für die römischen Feldherren war auch, dass ihre Legionäre solche Schiffe bei Bedarf schnell bauen konnten, aus dem Material, das die Wälder Germaniens lieferten. Christoph Schäfer: „Soldaten der damaligen Zeit waren es gewohnt, mit den Werkzeugen der Antike umzugehen. So konnte man hundert und mehr Leute für den Schiffbau abstellen und in kurzer Zeit eine starke Flotte aufbauen.“
Nach den ausführlichen und aufschlussreichen Tests unternahm das Schiff eine Tournee durch 20 Städte an Donau, Rhein, Lippe, Ems und Weser, um für die erwähnte Ausstellung zum 2000-jährigen Jubiläum der Varusschlacht zu werben, die im Jahr 2009 in den Museen von Haltern, Kalkriese und Detmold an eine entscheidende Schlacht zwischen Römern und Germanen bei Kalkriese nahe Osnabrück erinnerte. Dabei erlitten die Römer unter Feldherr Publius Quinctilius Varus trotz ihrer überlegenen Technik eine vernichtende Niederlage und verloren drei Legionen.
Mittlerweile gehört die in Hamburg gebaute „Victoria“ zum Römermuseum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in Haltern am See. Dort kann sie aber nur gelegentlich gefahren werden, daher wird das Schiff mitunter auch woanders eingesetzt, beispielsweise im Jahr 2012 auf dem Chiemsee. Im Herbst jenes Jahres wurde die „Victoria“ gemeinsam mit der „Lusoria Rhenana“ auf dem Halterner See getestet. Letztere ist der modifizierte Nachbau eines spätantiken römischen Militärschiffs, das nach Funden aus Mainz rekonstruiert wurde. Die in Mainz entdeckten Reste von Schiffen dieses Typs deuten darauf hin, dass es sich dabei um die Standard-Binnenkriegsschiffe auf Rhein und Donau handelte.