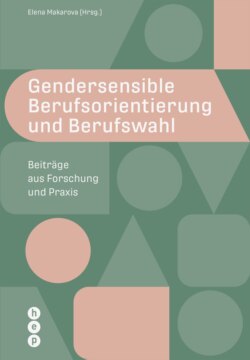Читать книгу Gendersensible Berufsorientierung und Berufswahl (E-Book) - Елена Макарова - Страница 46
2 Die Fachmittelschule als «Mädchenschule»
ОглавлениеDie Sekundarstufe II in der Schweiz zeichnet sich seit 2004 durch drei formal anerkannte Bildungswege aus – die berufliche Grundbildung, das Gymnasium und die Fachmittelschule. Alle drei Bildungswege können mit einer Maturität abgeschlossen werden, welche – je nach Weg spezifisch – den formalen Zugang zu drei Typen von Hochschulen (Fachhochschule, Pädagogische Hochschule, Universität), teilweise auch zu Höheren Fachschulen eröffnet. Rund 5 Prozent der Schulabgängerinnen und -abgänger wählen innerhalb von zwei Jahren eine Ausbildung an einer FMS[2] (Laganà & Gaillard, 2016, S. 18). Als allgemeinbildende Schule ist sie nicht berufsbefähigend, bereitet jedoch auf Berufsausbildungen auf Tertiärstufe insbesondere im Bereich Gesundheit, Soziale Arbeit und Erziehung vor. Die Schülerinnen und Schüler wechseln nach Abschluss der Schule mit der Fachmaturität beispielsweise an eine pädagogische Hochschule für das Studium zur Primarlehrkraft, an eine Fachhochschule für Gesundheit für das Studium zur Pflegefachperson oder an eine Fachhochschule für Soziale Arbeit. Bezüglich der Steuerung und Aufsicht handelt es sich um eine kantonale Schule. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK regelt und akkreditiert jedoch den Rahmenlehrplan und die Anerkennung der Abschlüsse.
Die Wurzeln der Schule liegen in den sogenannten Höheren Töchterschulen, welche im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in größeren Städten entstanden sind (Joris & Witzig, 1987, S. 338). Sie boten damals für junge Frauen die fast einzige Möglichkeit, zu höherer Bildung zu gelangen (EKFF, 2009). In diesen Schulen wurden die weiblichen Jugendlichen des oberen Mittelstandes auf ihre zukünftige standesgemäße Rolle als Hausfrau und Mutter hin sozialisiert. Im ausgehenden 19. Jahrhundert übernahmen die Schulen zunehmend eine Brückenfunktion, um die jungen Frauen für Berufsausbildungen im Bereich von Erziehung, Pflege und Sozialer Arbeit vorzubereiten, die erst mit 18 bis 20 Jahren begonnen werden konnten (Joris & Witzig, 1987, S. 335 ff.). Die Schulen boten jedoch keine formal gesicherten Anschlussmöglichkeiten für diese weiteren Bildungswege und wurden auch als Sackgasse empfunden. Ab den 1970er-Jahren hat sich die Schule in einem drei Jahrzehnte laufenden Prozess (Criblez, 2002; Leemann & Imdorf, 2019) von diesen sehr heterogenen städtischen Schulen für junge Frauen zu einem auch den jungen Männern zugänglichen Bildungsweg auf Sekundarstufe II mit Hochschulzugang transformiert. Dabei hat sie auch den Namen gewechselt, in einem ersten Schritt zur Diplommittelschule (DMS), später zur Fachmittelschule (FMS). Neu wurden Berufsfelder eingeführt, die meist zu Beginn des zweiten Ausbildungsjahrs gewählt werden. Die Kantone haben die Möglichkeit, Gesundheit, Soziales, Pädagogik, Information/Kommunikation, Gestaltung/Kunst, Musik/Theater sowie ab 2019 Gesundheit in Kombination mit Naturwissenschaften anzubieten.
Das Geschlechterverhältnis beim Schulbesuch betrug im Schuljahr 2016/17 72 Prozent Frauen und 28 Prozent Männer.[3] In Abbildung 1 ist der Frauenanteil beim Abschluss der Schule mit der Fachmaturität abgebildet. Gegenüber 83 Prozent im Jahre 2012 ist er im Jahre 2017 leicht gesunken und beträgt 80 Prozent. Dargestellt ist auch der Frauenanteil in den einzelnen Berufsfeldern. In Pädagogik und Soziale Arbeit liegt er über dem Durchschnitt, in Gesundheit entspricht er in etwa dem Durchschnitt. In den Berufsfeldern Information/Kommunikation, Gestaltung/Kunst und Musik/Theater (zusammengefasst) sowie Naturwissenschaften und Gesundheit/Naturwissenschaften (zusammengefasst) ist er dagegen – mit einer Ausnahme im Jahre 2017 für die letztgenannte Fachrichtung – geringer.[4] Diese Berufsfelder scheinen für junge Männer attraktiver zu sein und führen dazu, dass sie vermehrt eine Ausbildung an der Schule besuchen.
Abbildung 1: Frauenanteil in verschiedenen Berufsfeldern der Fachmaturität, Entwicklung 2012–2017 (Daten: Bundesamt für Statistik. Eigene Darstellung)