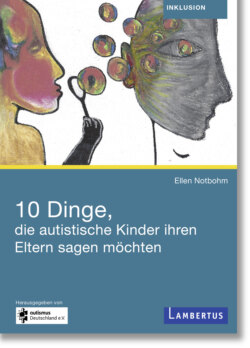Читать книгу 10 Dinge, die autistische Kinder ihren Eltern sagen möchten - Ellen Notbohm - Страница 8
Vorwort zur deutschsprachigen Ausgabe
ОглавлениеVor etwa zwei Jahren ist im Lambertus-Verlag unter dem Titel „1001 Ideen für den Alltag mit autistischen Kindern und Jugendlichen“ die deutschsprachige Übersetzung des US-amerikanischen Buches „1001 Great Ideas for Teaching & Raising Children with Autism or Asperger’s“ erschienen. Diese Schrift stammt von Ellen Notbohm und Veronica Zysk und zählt im angloamerikanischen Sprachraum zu den Bestsellern und Lieblingsbüchern in Bezug auf Autismus. Auch hierzulande wird es bei einer stetig wachsenden Zahl an Eltern und pädagogischen Fachkräften als eine Fundgrube an leicht zugänglichen Praxistipps sehr geschätzt, die genutzt werden können, wenn ein autistisches Kind angemessen unterstützt werden soll. Die ausgesprochen positive Resonanz signalisiert, dass dieses Buch hält, was es verspricht.
In dieser Bahn bewegen sich gleichfalls das Echo und die Stimmen, die die US-amerikanische Ausgabe des vorliegenden Buches betreffen. Sie wurde 2019 unter dem Titel „Ten Things Every Child with Autism Wishes Yo Knew“ in der 3. aktualisierten Auflage veröffentlicht und mittlerweile in 20 Sprachen übersetzt und vielen Ländern zugänglich gemacht. Was bislang fehlte, war eine deutschsprachige Übersetzung und Zugänglichkeit. Diese Lücke wird nunmehr mit der vorliegenden Schrift geschlossen. Ausschlaggebend dafür war vor allem die international verbreitete hohe Wertschätzung beider Schriften von Ellen Notbohm, deren Veröffentlichungen mehrfach preisgekrönt wurden.
Ellen Notbohm ist Mutter eines autistischen Sohnes und eines Sohnes mit ADHS, arbeitet als Kommunikationsberaterin und hat sich als Journalistin auf Autismus spezialisiert. Ihre Stärke besteht insbesondere darin, drei Sichtweisen zu reflektieren und miteinander zu verschränken: ihre Sicht als betroffene Mutter, die Sicht ihres autistischen Sohnes und Außensichten auf Autismus. Auf diese Weise ist es ihr gelungen, eine subjektiv geprägte, zugleich fachlich profunde Schrift zu verfassen, die in erster Linie an Eltern und pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulen adressiert ist, wenn es darum geht, autistische Kinder zu verstehen, zu unterstützen und zu fördern.
Das vorliegende Buch ist systematisch angelegt, klar gegliedert und leicht zugänglich. Es beginnt mit Erfahrungen als Mutter eines Sohnes, der in den ersten Lebensjahren Verhaltensbesonderheiten zeigt, die zunächst den Verdacht auf Autismus aufkommen lassen, der dann später in Kindesalter diagnostisch bestätigt wird. Ein wichtiges Thema ist für Ellen Notbohm der Umgang mit solchen Botschaften. Unmissverständlich wendet sie sich gegen Vorurteile und pessimistische Prognosen, zum Beispiel gegen die Vorstellung, Autismus sei eine „unheilbare Störung“ oder „ein ‚therapieresistentes Phänomen‘, bei dem Betroffene kein sinnerfülltes Leben führen und ihren Alltag nicht produktiv gestalten können“. Anstatt Autismus als ein „Unglück“ zu betrachten, ist es ihr um eine positive und optimistische Grundhaltung zu tun, die zum Verständnis betroffener Personen unverzichtbar ist, ja eine fundamentale Bedeutung hat. Das Sich-Leiten-Lassen von klinischen oder allgemeinen (Vor-)Urteilen im Umgang mit Autismus ist nach Ansicht der Autorin ein pädagogischer oder therapeutischer Kunstfehler, der unbedingt vermieden werden sollte. Entscheidend für gelingende Entwicklungsprozesse autistischer Kinder sind die Bereitschaft und der Wille, sich unvoreingenommen, empathisch-verstehend auf den betreffenden Menschen einzulassen, seine Situation und Sicht subjektzentriert zu erschließen, mit ihm zu kooperieren und ihn auf ein Leben im Erwachsenenalter vorzubereiten, welches ihm ein Höchstmaß an Selbstvertretung und Selbstbestimmung ermöglichen kann. Dass bei diesem pädagogischen Bemühen fachwissenschaftliche Kenntnisse (im Unterschied zu statischen Urteilen oder Prognosen) einfließen sollten, steht nicht im Widerspruch zu der grundsätzlichen Haltung, das autistische Kind als „ganze“ Person, „mit seinen menschlichen Schwächen genauso wie mit seinen Fähigkeiten und Tugenden“ anzuerkennen und „bedingungslos zu lieben“.
Mit dieser Position werden von Ellen Notbohm zwei Aspekte tangiert, zum einen die Warnung autistischer Menschen, dass das, „was Ärzte oder Psychologen sagen, (…) nicht immer wahr zu sein“ braucht (O‘Neill 2001, 12f.)1; zum anderen die bereits von H. Asperger (1944, 135)2 herausgestellte Erkenntnis in Bezug auf autistische Personen, „dass in jedem Charakter Vorzüge und Mängel Ausfluß derselben Wesenszüge sind, daß Positives und Negatives zwei Seiten sind, die man nicht ohne weiteres voneinander trennen kann.“
Zu diesem ‚Doppelcharakter‘ von Autismus haben in den letzten Jahren viele autistische Persönlichkeiten wertvolle Beiträge geleistet, die zum besseren Verstehen von Autismus sowie zu Veränderungen der Sichtweisen geführt haben. Die vorliegende Schrift passt in diesen Kontext – wendet sie sich kompromisslos gegen die zum Teil noch weit verbreitete Defizitsicht auf Autismus und versteht sie sich als Plädoyer für die Würdigung von Stärken autistischer Menschen: Erschließen Sie die Potenziale, konzentrieren Sie sich auf die Stärken autistischer Kinder und nicht auf ihre Schwächen. Bauen Sie auf dem auf, was sie können – so lautet Ellen Notbohms Botschaft an alle Eltern autistischer Kinder und Fachkräfte im Bereich des Autismus.
Im Prinzip zählt heute eine solche Botschaft zum guten Ton, ließe sich nicht feststellen, dass sie nach wie vor zu wenig beachtet wird. Daher haben wir es noch eher mit einer Rhetorik denn Realität zu tun. Zudem gibt es mit den soeben veröffentlichten S3-Leitlinien „Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter“3 Praxisempfehlungen und darüber hinaus nicht wenige Berichte aus der Praxis der Behindertenhilfe, denen die Stärkenperspektive nahezu fremd zu sein scheint (kritisch dazu Theunissen 2021, 93ff.).4
Dass in Verbindung mit eigenen Erfahrungen die Stimme autistischer Menschen beachtet wird, zeigt sich auch an der Stelle, wo Ellen Notbohm das Verständnis in Bezug auf Autismus diskutiert und die Bedeutung der sensorischen Besonderheiten herausstellt. Was den Begriff des Autismus betrifft, so signalisiert sie Verständnis für die aktuellen Diskussionen, ist jedoch davon überzeugt, dass durch bloße Begriffswechsel noch keine soziale und gesellschaftliche Inklusion (unbedingte Zugehörigkeit) autistischer Menschen garantiert werden kann und dass es letztlich auf die Einstellungen, Bewertungen und Entscheidungen ankommt, um Diskriminierungen und Ausgrenzungen zu vermeiden. „Etikettierungen“ – schreibt sie – „sind selten harmlos, auch wenn sie nicht böse gemeint sind.“ Daher wurde in der deutschsprachigen Übersetzung darauf geachtet, im Sinne der Autorin und der Selbstvertretung Betroffener den Autismusbegriff nicht per se durch ‚Autismus-Spektrum-Störung‘ zu pathologisieren und die Formulierung ‚autistisches Kind‘ durchgängig zu benutzen.
Aus der Betroffenensicht kann das Thema der sensorischen Besonderheiten als ein zentrales Merkmal im Autismus-Spektrum nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese gleichfalls von international renommierten Autismusforscher*innen gestützte Auffassung wird von Ellen Notbohm aufgrund ihrer Erfahrungen uneingeschränkt geteilt, weshalb sie diesem Thema durch die Berücksichtigung vieler Beispiele im Hinblick auf unterschiedliche Wahrnehmungsbereiche (visuell, auditiv, taktil …) breiten Raum gibt. Zugleich werden wertvolle pädagogische Anregungen zur Prävention und Intervention sensorischer Schwierigkeiten gegeben.
Weitere Kapitel, die typische Aspekte im Rahmen von Autismus alltagsbezogen und praxisnah aufgreifen, beziehen sich auf das konkrete Denken vieler autistischer Personen, auf ihre kommunikativen und kognitiven Besonderheiten wie zum Beispiel das Wörtlichnehmen von Sprache, auf die bei Betroffenen stark verbreitete visuelle Orientierung sowie auf die Herausforderungen, sich auf soziale Situationen und Interaktionen einzulassen und einzustellen.
Einen exponierten Stellenwert hat die Diskussion über Meltdowns und andere Verhaltensbesonderheiten, deren Umgang eine verstehende (funktionale) Problembetrachtung nahelegt. Auch in dem Fall legt die Autorin auf die positive Grundhaltung gegenüber autistischen Kindern großen Wert, die ihrer Ansicht nach in Verbindung mit der Herstellung und Sicherung einer Vertrauensbasis stets den fühlbaren Hintergrund aller Interventionen bilden muss. Das wird gleichfalls an den Stellen spürbar, wo Ellen Notbohm mit Beispielen aus dem alltäglichen Leben auf den wichtigen Unterschied zwischen dem ‚Nicht-Wollen‘ (wissen, aber nicht machen) und dem ‚Nicht-Können‘ (nicht wissen, wie es gemacht wird) aufmerksam macht. Wie bei den anderen Themen gelingt es ihr ebenso in diesem Kapitel, Leser*innen bei der Frage mitzunehmen, welche spezifischen Herausforderungen bestehen und wie pädagogische Maßnahmen an die Voraussetzungen und Bedürfnisse eines autistischen Kindes sinnvoll angepasst werden können. Hierzu ist ein umfassendes Verständnis seiner Situation, Sicht-, Verhaltens- und Erlebensweisen erforderlich. Ein solches Verständnis lässt sich am besten erreichen, indem ihm eine Stimme verliehen, ihm zugehört und seine Erfahrungen pädagogisch und therapeutisch berücksichtigt werden.
Mit dieser Sicht hat Ellen Notbohm als betroffene Mutter, als genaue Beobachterin und Analytikerin des Verhaltens autistischer Kinder sowie als Expertin in eigener Sache, vor allem für Autismus, ein wichtiges Buch geschrieben, welches Eltern autistischer Kinder und pädagogischen Fachkräften wie Erzieher*innen und Lehrer*innen zahlreiche Impulse zum Nachdenken, insbesondere zum Überdenken bisheriger Einstellungen und Umgangsformen sowie eine Fülle an hilfreichen Ideen und umsetzbaren Strategien bietet, die auf einem modernden Verständnis und Wissen in Bezug auf Autismus basieren. Fragen zur Vertiefung und Reflexion der genannten Themen runden die Schrift ab und sind zugleich wegbereitend für eine verstehende Sicht und einfühlsame Praxis.
Freiburg, im Herbst 2021
Georg Theunissen
1O‘Neill, J.: Autismus von innen. Nachrichten aus einer verborgenen Welt, Bern.
2Asperger, H.: Die „Autistischen Psychopathen“ im Kindesalter, in: Archiv für Psychiatrische Nervenkrankheiten, H. 117, 73–136.
3Interdisziplinäre S3-Leitlinie der DGKJP und der DGPPN sowie der beteiligten Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenorganisationen S3-Leitlinie AWMF-Registernummer: 028–018, Langversion vom 2. Mai 2021 online zugänglich.
4Theunissen, G.: Behindertenarbeit vom Menschen aus. Unterstützungssysteme und Assistenzleistungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten und komplexer Behinderung, Freiburg i. B. 2021.