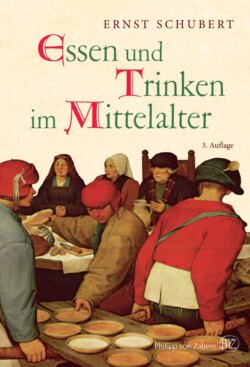Читать книгу Essen und Trinken im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 10
|22|Ernährungsgeschichte und Gesellschaftsentwicklung. Methodische Fragen
ОглавлениеDie historiographische Tradition der Ernährungsgeschichte – Kulturgeschichte und Alltagsgeschichte – Inhaltswandel von Sachbegriffen als Problem der Alltagsgeschichte, als Gefahr des Anachronismus – Institutionen, Alltagsgeschichte und Gesellschafisgeschichte – Alltagsgeschichte und Realienkunde – Sozialgeschichte und Realienkunde: das Beispiel der Konservierung von Nahrungsmitteln
Der Versuch, über die Geschichte der Ernährung Aufschlüsse über das Werden der Gesellschaft im Mittelalter gewinnen zu wollen, steht in einer ehrwürdigen historiographischen Tradition. Um 1800 hatten meine Göttinger Kollegen der traditionellen Regentengeschichte die Geschichte der im umfassenden Sinne verstandenen Kultur entgegengestellt. Die unsinnige Konstruktion eines Gegensatzes von Kultur und Zivilisation, die um 1900 populär wurde, hatte ihre Auffassungen noch nicht getrübt, wenn etwa August Ludwig Schlözer die Frage aufwarf, ob die Geschichte des Tabaks nicht wichtiger sei als die des assyrischen Reiches.81
Die um 1800 aufgeworfenen Fragen stellten kein Programm, sondern Anregungen dar. Diese wurden einfach beiseite geschoben, als mit den handfesten, erst im 19. Jahrhundert entwickelten Methoden auch eine neue Form der Kulturgeschichtsschreibung entstand.82 Gefesselt durch die Regeln der wissenschaftlichen Disziplin – selbst Viktor von Scheffel zitierte in seinem historischen Erfolgsroman „Ekkehard“ in den Fußnoten aus den MGH –, gelangte die Kulturgeschichte doch nie zum Selbstbewußtsein einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin wie etwa (am erfolgreichsten) die Rechtsgeschichte oder die Wirtschaftsgeschichte.
Selbst als um 1900 unter der Ägide Georg Steinhausens die Kulturgeschichte die Einseitigkeit der Herrschaftsgeschichte in Frage stellte, gelangte sie – von ihrer deutschnationalen Prägung ganz abgesehen83 – bei allen Fortschritten im einzelnen doch nicht zu einer Klärung dessen, was bei den oft mühsam aufgespürten Details Allgemeingültigkeit beanspruchen könnte.84 Diese Forschungen standen der damals noch als Außenseiterfach geltenden Volkskunde näher als der Wirtschaftsgeschichte; denn neben dem Guten und Schönen der Kultur ging es auch stets um das Deutsche. Dennoch ist die so wortreich beschriebene kulturwissenschaftliche Wende der Gegenwart, weil sie ihre Vorgänger zumeist vergessen hat,85 bei aller sorgfältigen Zitierung möglichst ausländischer Kollegen in der Frage der Repräsentativität der ermittelten Ergebnisse keinen Schritt weiter gekommen als die Wissenschaft zur Zeit Georg Steinhausens. Nachteile hatte es gewiß, daß die Kulturgeschichtsschreibung sich nicht zur eigenen wissenschaftlichen Disziplin entwickelte, aber auch Vorteile. Sie blieb ein relativ offenes Forschungsprogramm, wovon die Themenvielfalt der Artikel im Archiv für Kulturgeschichte ein beredtes Zeugnis ablegt. So können manche Traditionen der Kulturgeschichte problemlos in die Alltagsgeschichte integriert werden wie etwa auch die Geschichte |23|der Ernährung. Die Alltagsgeschichte aber darf nicht wie die Kulturgeschichte älterer Observanz die Frage der Allgemeingültigkeit des Details ausklammern.
Die Alltagsgeschichte komprimiert ein methodisches Grundproblem jedweder Historiographie: Inhalte gleicher Begriffe bleiben sich nicht über die Zeiten gleich. Ob das mittelalterliche Königtum oder die Welt der Vaganten erforscht wird: die Forschungsobjekte müssen erst von den Assoziationen gereinigt werden, die im Verlauf der neuzeitlichen Geschichte ihre Oberflächengestalt überwachsen haben. Ein König, der 1024 inmitten freier Natur, wo sich viel Volk versammeln kann, in der Rheinebene bei Oppenheim, bei Kamba, gewählt wird, hat eine andere Herrschaft inne als ein Reichsoberhaupt des 17./18. Jahrhunderts, bei dessen Wahl bereits die Sitzordnung der kurfürstlichen Gesandten im geschlossenen Saal des Frankfurter Römers zu heftigen diplomatischen Verwicklungen führen kann.86 Wie sich 1024 die Herren in ihren Zelten oder das auf dem Boden schlafende Gesinde ernährten, war dem Chronisten keine Erwähnung wert. Wie aber und von wem bei einer Kaiserwahl des 18. Jahrhunderts die Schüsseln aufgetragen wurden, war eine – deswegen vom Ritter von Lang verspottete – hochpolitische Frage.87
Vom Hohen zum Niedrigen – der gleiche Befund. Der Vagant noch des späten Mittelalters, der den Bauern für eine Gegengabe von Brot und Speck wahlweise fromme Lieder oder deftige Scherze vorträgt, steht noch nicht unter dem Verdacht der Landstreicherei wie in der frühen Neuzeit. Der Vagant ist über die Zeiten hinweg eine mißtrauisch beäugte Gestalt. Im Mittelalter aber ist er, der keine Heimat und deswegen keine Nahrung hat, des Almosens würdig, Brot, bisweilen sogar Speck, Käse oder Hering werden ihm gereicht, in der frühen Neuzeit jedoch wird er obrigkeitlich verfolgt und um 1800 als „fahrender Gesell“ romantisiert.
Als die Gesellschaftsbildung um 1500 konturiert in Erscheinung trat, als die ersten sozialen Typisierungen in Gestalt des „starken Bettlers“ allgemeine soziale Pflichten zu definieren versuchten,88 waren inzwischen für die Lebensordnungen auch Institutionen wichtig geworden. Am Beispiel der Stadt und des von ihr verantworteten gemeinen Nutzens wird sich erweisen, daß die Institutionen des späten Mittelalters tief in der Geschichte der Ernährung verankert sind. Denn bei „Institutionen“ denken wir nicht nur an das Königtum, sondern an den für den Marktverkehr unerläßlichen Unterkäufel, der die Verkaufsverhandlungen von Getreide, Fleisch und Wein überwacht.
Aus unseren beiden, einander so gegensätzlichen Beispielen des Königs und des Bettlers müssen nicht unbedingt wegen der geschichtlichen Überlagerungen scheinbar eindeutiger Wörter weitschweifige Schlüsse mit Erörterungen zur historiographischen Semantik gezogen werden. Es geht viel einfacher über die Alltagsgeschichte. Die Zusammenhänge von Wörter- und Sachentwicklung waren schon der Kulturgeschichtsschreibung um 1900 bewußt geworden89 und hatten das bedeutende Werk Moriz Heynes bestimmt.90 Wer weiß, daß das mittelalterliche Schwein viel mit dem Wildschwein und noch wenig mit dem modernen Kotelettproduzenten gemein hat, wird sich bequemen müssen, seine Begrifflichkeit durch das Sieb des geschichtlichen Wandels zu pressen.
|24|Ebenso wie bei allen Grundbegriffen der Geschichte gilt es auch für den der Gesellschaft, daß er nicht definierbar, sondern in seiner geschichtlichen Wandelbarkeit nur beschreibbar ist. Meinen Studenten habe ich das an einem einfachen Beispiel zu erklären versucht, das sicherlich geschmacklos angesichts so vieler tiefer philosophischer und geschichtstheoretischer Anstrengungen ist und das ich trotz aller Bedenken deshalb erwähne, weil ein Professor den Mut haben sollte, das, was er seinen Studenten sagt, auch zu veröffentlichen. Also: Was eine Oma ist, weiß jeder. Dieser Begriff ist auch biologisch eindeutig zu definieren. Welten aber unterscheiden die Großmutter um 1900 von der um 2000. Das betrifft nicht nur die Kleidung, den Verzicht auf die lange vorgeschriebene Dezenz der schwarzen oder zumindest dunklen Gewänder, das betrifft die Rolle im Familienverband: von der Ahne zur Babysitterin. Und Omas männliches Pendant macht die gleiche Wandlung durch, wobei nicht nur auf Udo Jürgens’ Lobpreis des „zweiten Frühlings“ „Mit 66 Jahren“ verwiesen werden muß. Kein Enkel umspielt heute mehr die Knie eines milde lächelnden Greises.
Wie mit Oma und Opa verhält es sich auch mit dem Begriff Gesellschaft. Wer wissen will, was darunter im Mittelalter zu verstehen ist, tut nach meiner festen Überzeugung gut daran, nicht nach abstrakten Formulierungen oder bildhaften Deutungen zu suchen, sondern jene Lebensbedingungen zu ermitteln, die überhaupt erst das Überleben von Menschen ermöglichten, also dem Thema des Essens und Trinkens nachzugehen. Die Einbeziehung der Alltagsgeschichte ist unerläßlich für eine Gesellschaftsgeschichte.
Die Alltagsgeschichte muß sich wie ein spät kommender Fahrgast in einen überfüllten Bus in die vorhandenen methodischen Ansätze einzwängen, sie muß dabei Ellenbogen gebrauchen, um meine Freude an wissenschaftlicher Polemik einigermaßen zu rechtfertigen, und sie sollte dabei auf verständnisvolle Mitmenschen hoffen. Das sind für den Alltagshistoriker vor allem die Kollegen aus dem Museum. Ohne ihre Konservierung und Katalogisierung der Sachgüter kann er nicht auskommen, und er weiß sich mit ihnen in dem Wissen einig, wie zufällig die Überlieferung – sei es die literarischer, sei es die materieller – Zeugnisse der Vergangenheit ist.
Die Frage nach dem Verhältnis von Alltagsgeschichte und Realienkunde wird noch mehrfach, etwa am Beispiel der Eßgeräte, der Teller, Schüssel und Becher, der Löffel, Messer und Gabeln zu konkretisieren sein. Vorerst genüge die Aussage: Alltagsgeschichte ist keine Realienkunde, aber sie kann ohne diese nicht geschrieben werden.91 Umgekehrt kann die Realienkunde ohne die alltagsgeschichtlichen Perspektiven nicht auskommen, will sie nicht der Gefahr erliegen, Sachgüter unverbunden nebeneinander zu katalogisieren. Die Alltagsgeschichte ordnet die Realien in den geschichtlichen Wandel ein. Jeder kennt die museale Inszenierung repräsentativen Tischgeschirrs – Silber in Renaissance und Barock, Fayencen und Porzellan im Rokoko –, aber mittelalterliche Ursprünge sind hier nicht auszumachen. Solch ein Geschirr paßt nicht in eine Welt, in der Haferbrei gelöffelt wird. Umfassend hat sich in der frühen Neuzeit die Tischkultur gewandelt. Aber diese Wandlung muß doch tiefere Ursachen gehabt haben. Wir teilen die Ansicht Ulrich Müllers, daß die „Qualitätssteigerung des Mahles“ seit dem ausgehenden |25|Mittelalter „durch die zunehmende Differenzierung der Objekte“, gemeint ist das Geschirr, sichtbar gemacht wird.92
Der mittelalterliche Wein ist ausgetrunken, der mittelalterliche Brei ausgelöffelt.93 Die Inszenierung von Realien in den Museen ist in ihrer Dramaturgie thematisch begrenzt, denn im allgemeinen sind nur wertvolle Realien überliefert, das Alltägliche, das immer auch die Geschichte des gemeinen und des armen Mannes ist, hingegen nicht. Hier hilft der so oft übersehene Zusammenhang von Sozialgeschichte und Realienkunde. Das sei im Hinblick auf unser Thema an einem Beispiel illustriert. Das entscheidende Problem der Ernährung, das der Konservierung, wird immer wieder bei der Geschichte der einzelnen Nahrungsmittel, zugleich die Frage von deren Verfügbarkeit beleuchtend, auftreten.94 Ob es sich um gesalzenen Hering, um eingepökeltes Fleisch oder um haltbares Roggenbrot handelt: Vorratswirtschaft hätte eigentlich die Ökonomie des gemeinen Mannes bestimmen müssen.95 Die umfassendste Definition von Armut im Mittelalter aber liegt in der Redewendung „von der Hand in den Mund leben“; arm sind alle Menschen, die sich eine Vorratshaltung gar nicht leisten können.96 Damit sind wir bei der Frage nach der Gesellschaft des Mittelalters angelangt.