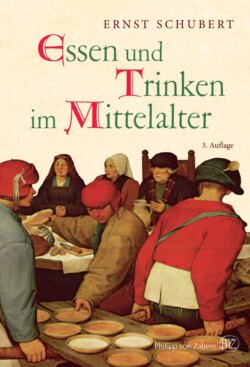Читать книгу Essen und Trinken im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 23
Der Salzhandel, die Schwierigkeiten des Salztransports und die stadtgeschichtlichen Wirkungen des Salzes
ОглавлениеDie im Spätmittelalter überwundene Salznot – Das Geflecht der Fernhandelswege – Die Schwierigkeiten des Transports und die Salzfässer – Fracht und Rückfracht, Wein- und Salzfaß – Die Salzsäumer – Vom Salztransport erzwungene Innovationen: Kanal und Tunnel – Stadt und Salz: die unterschiedlichen Beispiele von Lüneburg und München – Salzmärkte und das schwere Amt des Salzmessers – Blocksalz
Kochrezepte des späten Mittelalters mahnen „versaltz nit“.232 Es ist charakteristisch für die mittelalterliche Medizin, daß sie das Salz bei ihren diätetischen Ratschlägen berücksichtigte und zum Maßhalten aufforderte.233 Das Weiße Gold war geschmacklich hoch geschätzt: „Saltz ist die beste würtz.“ Und dieses Sprichwort kommentierte Johannes Agricola: „Das lernt erfarung, daß keyn speise wol schmeckt, sie sey denn gesaltzen, es sey fleysch oder fisch.“234 Die Sentenzen bezeugen, daß im späteren Mittelalter Salz in ausreichendem Maße zur Verfügung stand – aber gewiß nicht im Überfluß. Sonst hätte der Nürnberger Rat nicht im 15. Jahrhundert seinen Bürgern bei drohender Kriegsgefahr befohlen, Salzscheiben, Salzvorräte, gestaffelt nach Vermögen, anzulegen. Die ausreichende Verfügbarkeit des Salzes im ausgehenden Mittelalter weist auf ein weitgespanntes |64|Handelsnetz, das schon geholfen hatte, die schlimmsten Folgen früh- und hochmittelalterlicher Hungersnöte abzuwenden.
Der Salzhandel war unverzichtbar. Schon allein deswegen waren die früheren Theorien von einer autarken antiken Stadtwirtschaft weltfremd, und auch die mittelalterlichen Städte konnten nur innerhalb eines Geflechts von Fernhandelsbeziehungen entstehen und wachsen.235 Wie allgemein in der Handelsgeschichte sind auch in diesem Fall die frühmittelalterlichen Quellen rar. Nur Schlaglichter wie etwa in der Raffelstetter Zollordnung von 903/06236 fallen auf einen schon damals unverzichtbaren und weitgespannten Handel. Erst im Hochmittelalter tritt das zuvor schon vorhandene Fernhandelsnetz an der Oberfläche der Überlieferung zutage. Zum Beispiel ist das lothringische Salz schon vor dem „Speierer Zollweistum“ von 1265 ein wichtiges Fernhandelsgut.237
Nicht der Markt, sondern der Transport war die eigentliche Herausforderung für den Salzhandel.238 Neben den Straßenverhältnissen bildeten für den Handel die unterschiedlichen Eignungen der jeweiligen Güter für den Transport die größten Schwierigkeiten, in unserem Fall also die schnelle Wasserlöslichkeit des Salzes. Was beim heutigen Kochen so bequem ist, mußte dem mittelalterlichen Fuhrmann Kopfzerbrechen bereiten. Das Weiße Gold muß vor Regen und Nässe geschützt werden. Deswegen sind geflochtene Körbe selten benutzt worden.239 Es gab noch keine wasserabweisenden Bezugsstoffe für die sowieso im Mittelalter vergleichsweise seltenen Planwagen, sondern nur Textilien, die schnell durchweichten.
Das gegebene Transportmittel für ein Produkt, das vor Nässe unbedingt geschützt werden mußte, war das Faß. Teuer in seiner Herstellung, muß es mehreren Zwecken dienen können. Damit kann es die Grundlagen für Wohlstand legen, wenn es gleichermaßen für Hin- und Rückfracht einsetzbar ist.240 Schwäbisch Hall wurde nicht nur durch den Salz-, sondern auch durch den Weinhandel reich. Fässer mit Neckar- und Rheinweinen sind die gegebene Rückfracht der Salzfuhrleute.241 Der enge Zusammenhang von Salz- und Weinhandel begegnet auch im Donauraum.242 Das teure Faß muß möglichst für Hin- und Rücktransport genutzt werden, und weiterhin bleiben, nachdem es gereinigt ist, immer noch Salzreste mit ihrer hochgeschätzten desinfizierenden Wirkung erhalten.243 Und auch das zeigt die Geschichte des Fasses: Das Salz gibt vielen Menschen Arbeit, den Böttchern,244 den Faßbindern, aber auch den Schmieden und Wagnern. Die Salzfässer, die mit groben Spänen abgedeckt waren,245 bestimmen auch das Aussehen des Produktes beim Verkauf: Salzscheiben.246 Als Ende des 16. Jahrhunderts die Holzknappheit vielerorts die Umstellung von den teueren Fässern auf Leinensäcke erzwang,247 war dies nur möglich, weil inzwischen die lederüberspannten Planwagen gebräuchlicher geworden waren.
Die geeignetsten Transportwege für die schweren Salzfässer waren die Flüsse.248 Nicht immer bot die Natur so günstige Voraussetzungen wie auf der Wasserstraße von Salzach, Inn und Donau.249 Für kleinere Flüsse mußten eigene Salzkähne gebaut werden.250 Und sodann konnte nicht nur die bequeme Talfahrt genutzt, es mußte auch die |65|schwierige Bergfahrt bewältigt werden. Die Knochenarbeit des Treidelns („Treibens“ im Alpenraum) wurde in Kauf genommen, um das Weiße Gold flußaufwärts zu transportieren.251
Der Handel mit einem Grundnahrungsmittel konnte sich nicht auf die Wasserwege beschränken. Einachsige Karren, die schon bis zu 800 kg transportieren konnten, gehörten bis ins hohe Mittelalter zu diesem Handel.252 Im 15. Jahrhundert mußte ein Drittel der Produktion von Hallstatt und Hallein auf dem Landweg verfrachtet werden.253 Hierbei ergaben sich erhebliche Schwierigkeiten.254 Die schweren Salzwagen, auf die mehr als eine Tonne geladen werden konnte,255 benötigten ausgebaute Straßen.256 Über Bergzüge hingegen mußte Salz auf den Saumpfaden – „Saum“ bezeichnete ursprünglich die Salzfracht257 – in Lederbütten transportiert werden.258 Schon Ottokars „Österreichische Reimchronik“ erwähnt um 1278 die Salzsäumer.259 Bauern und Bauernsöhne aus der Steiermark, aus Kärnten und dem Salzburger Land betrieben den Saumhandel über die Tauern, indem sie nach Süden Salz und nach Norden italienischen Wein, „Welschwein“ einführten.260 Fracht und Rückfracht, wie bei den Fässern, so auch bei den Lederbütten, ermöglichten den Salzsäumern einen bescheidenen Wohlstand. Als im 16. Jahrhundert in den Städten ein Konkurrenzgedanke gegen den „Gäuhandel“ erwachte,261 stieß er auf verfestigte Traditionen. Die Salzsäumer verteidigten ihre vererbbaren Rechte.
Der Salzhandel erzwingt die Verbesserung der Transportwege. Das eindrücklichste Beispiel bildet dafür der älteste europäische Kanal, der 1398 fertiggestellte Elbe-Stecknitz-Kanal, der für den Salztransport von Lüneburg nach Lübeck gegraben worden war.262 Auch der erste Alpentunnel, der zwischen 1478 und 1480 unter dem Monte Viso gebohrt wurde, diente der Erleichterung des Salztransports.263
Saline und Stadt – das hatte nicht allein Auswirkungen auf die urbane Topographie;264 das Weiße Gold bildet im Haushalt einer Salzstadt stets den größten Einnahmeposten.265 Aber das Beispiel der Salzsäumer warnt davor, die Geschichte des Handels einseitig auf den Siedlungstyp Stadt zu konzentrieren. Das Weiße Gold kann auf verschiedene Weise eine städtebildende Kraft entweder über eine Saline oder aber über den Salzhandel entfalten. Zwei Städte, Lüneburg und München, mögen diese unterschiedliche Abhängigkeit einer Stadt vom Salz repräsentieren.
„De sulte, dat is Luneborch“, sollte 1461 der Bürgermeister Hinrik Lange formulieren. Ohne Lüneburger Salz hätte es keinen Schonenschen Hering als Massengut geben können.266 Im Spätmittelalter erzeugte die größte Saline Nordeuropas bis zu 20.000 Tonnen jährlich.267 Die Salzproduktion steht hier im Mittelpunkt der städtischen Wirtschaft. Wenn es aber heißt, daß München auf dem Salz gegründet sei, dann meint das den Salzhandel. Insbesondere Kaiser Ludwig der Bayer hat seiner Hauptstadt das entsprechende Stapelrecht und mehrere einschlägige Privilegien besorgt,268 Privilegien, von denen Lüneburg, im konfliktreichen Verhältnis mit den welfischen Herzögen lebend, nur träumen konnte. Der Fernhandel mit Salz lag nicht in der Hand Lüneburger Kaufleute und der Sülfmeister. Nur die ersten Etappen konnten sie noch einigermaßen |66|kontrollieren. Deshalb firmierte Lüneburger Salz im Baltikum als Travesalz, als ein Produkt, das von Lübecker Kaufleuten verkauft wurde.269 Am Sand, dem Mittelpunkt Lüneburgs, und an der Ilmenau lagen zwei „Weißladereien“, die ihren Namen von „with“, dem frischen, noch nicht abgelagerten Salz trugen. Hierher kamen zum Beispiel die Bauern aus der Altmark, um ihren Bedarf zu decken.270 Nicht den lukrativen Fernhandel, sondern nur den zwar einigermaßen einträglichen, aber keine großen Gewinnspannen verheißenden Nahhandel behielten die Lüneburger in ihrer Hand.271 Und darin, in dem Fehlen eines kapitalstarken Eigeninteresses, dürfte einer der Gründe liegen, warum im 16. Jahrhundert die großen Investitionen ausblieben, welche den Niedergang der Saline, die erst Ende des 18. Jahrhunderts einer grundlegenden Reform unterzogen wurde,272 hätten aufhalten können.
Das Salz hatte die Individualität einzelner Städte begründen können. Das galt im frühen und hohen Mittelalter für die „Hall“- und „Salz“-Städte ebenso wie im Spätmittelalter für Lüneburg und München. Über alle Unterschiede hinweg hatte aber dieses Grundnahrungsmittel in jeder Stadt die Ratsobrigkeit vor eine Regelungsaufgabe gestellt. Salzmärkte gehörten zur mittleren und größeren Stadt.273 In Nürnberg wurde 1408 ein eigenes Salzhaus errichtet.274 In vielen Städten begegnet beim Salzhandel eine Person, die wir noch mehrfach in unserer Darstellung antreffen werden, eine Hintergrundfigur, die aber gleichwohl für das mittelalterliche Marktgeschehen von kaum zu unterschätzender Bedeutung ist: der in diesem Falle „Salzmesser“ genannte, vom Rat vereidigte Unterkäufel.275 Er garantiert die Einhaltung der vom Rat gesetzten Regeln und Qualitätsgebote, die den gemeinen Mann vor Übervorteilung schützen sollen. Beim Salzhandel ist der „heimlich kauf“, worunter das private Geschäft verstanden wird, verboten, Öffentlichkeit und damit Kontrolle vorgeschrieben. Deshalb sollen nach einer Konstanzer Ordnung des Jahres 1383 die Salzmesser die schwierige Mengenfeststellung „gerecht“ vornehmen. Was bildet den sachlichen Hintergrund dieser Mahnung? Abgesehen von den unterschiedlichen Qualitäten, die Betrugsmöglichkeiten eröffneten,276 galt es, das genaue Gewicht von feuchtem und trockenem Salz bei erheblichen Preisschwankungen277 zu bestimmen. Bei der Unterschiedlichkeit des Salzes waren vereidigte Schätzer unverzichtbar. Ihnen, so die Konstanzer Ordnung, soll niemand in ihr Expertenwissen hineinreden, aber dieses sollen sie auch nicht mißbrauchen, sondern Arme und Reiche gleich behandeln. Sie sollen „messen als von alter her gemessen ist … und sont nieman darumb ansehent won das si jederman daz reht geben sont, dem armen ald dem richen“.278 Das Salzmessen war schwierig.279 Weniger normanzeigende Waagen als Erfahrungen gaben dabei den Ausschlag – eine grundsätzliche Aussage über eine Welt, die dem Mitmenschen mehr als der errechneten Regel vertrauen mußte; denn das Weiße Gold veränderte wegen seiner hygroskopischen Beschaffenheit (weniger gelehrt ausgedrückt: als unterirdisches Geschenk der Natur, das an die Sonne gebracht wird) sein Gewicht bei großer Trockenheit oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.280
Weitgehend entfielen die Schwierigkeiten des Salzmessens dort, wo die „Salzschneider“ |67|tätig geworden waren. Ihr Produkt gelangte in Blockform in den Handel.281 König Siegmund von Ungarn gebot 1397 geradezu diese Vermarktungsform. Von den Forderungen des Handels nach berechenbaren Produkten ging der König mit der Begründung aus, daß das ungarische Salz wie inzwischen in Europa üblich nach Gewicht verkauft werden solle.282 Das Detail erweist: Die Entwicklung allgemein verbindlicher alltagsprägender Normen beruht auf dem Zusammenwirken von Herrschaft und Fernhandel.