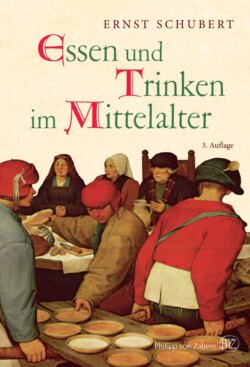Читать книгу Essen und Trinken im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 29
„Gut Brot und gut Rat sind teuer“
ОглавлениеMittelalterliches Brot als Herausforderung für die Zähne – Brötchen im Mittelalter? – Vom Fladenbrot zum Brotlaib – Die Bedeutung frühmittelalterlichen Teigknetens im Spiegel der Wortgeschichte von Lady und Lord – Die Anfänge der Lebensmittelhygiene – Von der grundherrlichen Backstube zur selbständigen Bäckerei – Die Entstehung der Bäckerzunft aus einem „Kammerhandwerk“ – Bäckerzunft: Verdrängung einer Frauenarbeit, der Handel der Meister und die Lage der Gesellen – Der historische Hintergrund des Wortes „hausbacken“ – Die Professionalisierung des Backens und die innerzünftischen Strukturen
|84|Die Überschrift, ein spätmittelalterliches Sprichwort zitierend,121 hält den trivialen Sachverhalt, daß Brot nicht gleich Brot ist, ebenso fest wie eine bereits mittelalterliche Erfahrung, daß Expertenwissen seinen Preis hat. Wie bei vielen mittelalterlichen Sprichwörtern lohnt sich auch hier das Grübeln darüber, welch komplexe Zusammenhänge in wenigen Worten verborgen sind.
Heute ergeben 100 kg Weizen 80 kg Brot. Im Mittelalter erbrachte die gleiche Menge an Weizen lediglich 30–50 % des Mehlgewichtes.122 Die geringe Backausbeute erklärt sich erstens daraus, daß der mittelalterliche Teig eine wesentlich niedrigere Quellfähigkeit besaß als der heutige. Zweitens wurden die mittelalterlichen Brote schärfer ausgebacken, denn sie mußten, ohne schimmelig zu werden, viel länger haltbar sein als heute,123 der Grund, warum die relativ seltenen Brotscheiben124 als Tellerersatz dienen konnten, warum alle mittelalterlichen Tischzuchten vorschreiben, das Brot beim Schneiden nicht gegen die Brust zu drücken,125 warum diese Brote, eine Herausforderung für die Zähne, am liebsten zunächst in eine Flüssigkeit gestippt oder – „wînbrôt“ – in Würzwein eingeweicht wurden, warum in der frühen Neuzeit eigene Gerätschaften für das schwere Brotschneiden aufkamen.126
Mittelalterliches Brot als Herausforderung für die Zähne. Unsere beliebten Brötchen haben keinen mittelalterlichen Ursprung. Dafür fehlten die technischen Voraussetzungen. Die damaligen Semmeln oder „Mutscheln“ sind einfach kleine Brote.127 Semmel, entstanden aus dem lateinischen „simila“, ist im Mittelalter ein feines Gebäck aus Weizenmehl für den Tisch der Herren.128 Vor allem ist das moderne Brötchen im Gegensatz zum mittelalterlichen Brot zum alsbaldigen Verzehr bestimmt.
„Backen“ ist ein gemeingermanisches Wort, das sich im Laufe der Zeiten nicht nennenswert veränderte, obwohl die damit bezeichnete Tätigkeit erheblichen Wandlungen unterlag. Das frühmittelalterliche Brot war – einer universalgeschichtlich nachweisbaren Erscheinung entsprechend129 – ein Fladenbrot,130 ähnelte dem heutigen Knäckebrot. Es wurde auf offenem Herd, bestenfalls unter einer Backglocke ohne Treibmittel zubereitet. Weil zudem der pappige Teig schlecht durchbuk, konnte kein Brotlaib, sondern nur ein flaches Gebäck entstehen. Erst um 1300 wird das Fladenbrot allmählich durch das Sauerteigbrot verdrängt.131 Der Brotlaib, für dessen Herstellung im Spätmittelalter auch die Hefe verwendet wird, wölbt sich.
Die Entwicklung vom Fladenbrot zum Brotlaib, die in den Quellen nur schemenhaft abgebildet ist, umschließt einen für die Gesellschafts- und Geschlechtergeschichte gleichermaßen relevanten Sachverhalt: Das Teigkneten des frühen Mittelalters war, wie in vielen anderen, etwa afrikanischen Kulturen nachgewiesen,132 eine Frauenarbeit.133 Im Englischen entwickelt sich aus dem Begriff der „Brotkneterin“, „hloefdige“, das Wort „Lady“. Dahinter steht folgender Sachverhalt: Das Teigkneten war, obgleich von Unfreien ausgeübt, hoch angesehen, weil es eine Arbeit in Herrschaftsnähe sein mußte. Wer für das Brot des Hausherrn und dessen „Brotlinge“ sorgte, hatte eine Vertrauensstellung inne; denn alle Nahrungsmittel wurden mit den Händen zubereitet; die Sauberkeit war in dem zwar nicht besonders grausamen, aber dreckigen Mittelalter ein großes |85|Problem.134 Aus solchem Ansehen, basierend auf Herrschaftsnähe, konnte sich eine neue Oberschicht unabhängig von den bestehenden geburtsständischen Ordnungen entwickeln.
An das Backen innerhalb der Fronhofsorganisation erinnert, daß der Bäcker im deutschen Süden, Familiennamen bildend, „Pfister“ heißen konnte.135 Die normalerweise in den Quellen kaum zu erfassende Kommunikation zwischen lateinisch sprechenden Mönchen und volkssprachlichen Laien ist in diesem Namen, der von dem lateinischen „pistor“ abgeleitet ist, sedimentiert. Der „Pfister“ ist der Feinbäcker, der den kirchlichen Herren nahesteht. Von seinen Kunden übernimmt er mit Stolz die Bezeichnung seiner Tätigkeit. Das Althochdeutsche kennt auch eine andere Bezeichnung für Bäcker, den „brotbecko“. Er ist der Grobbäcker, der für den alltäglichen Bedarf arbeitet. Dabei ist zu bedenken: Das Brot für das Abendmahl werden die Mönche kaum von dem Grobbäcker herstellen lassen, und dieses Brot wird auch nicht den gewohnten Anteil von Wickensamen enthalten haben. Der Unterschied von „Pfister“ und „Bäcker“ weist nicht allein auf Unterschiede des Backens. Die Anfänge der Lebensmittelhygiene sind wahrscheinlich von der Liturgie gegen die Zwänge des Alltags gesichert worden.
Im Gegensatz zum Müller löst sich die grundherrliche Bindung des Bäckers mit der Fronhofsorganisation auf. Die Backstube bildet anders als die Mühle keine Konstante in den Wandlungen der Agrarverfassung.136 Auch deswegen ist Müller ein wesentlich häufigerer Familienname als Bäcker; ein weiterer Grund dafür liegt in der Trennung der Wege von Stadt und Land bei der Herstellung des Brotes137: Das Backen als Nachnamen bildender Beruf gehört zur spätmittelalterlichen Stadt.138 Auf dem Lande dominierte bis tief in die frühe Neuzeit hinein jedoch die Hausbäckerei; und deswegen unterliegt die Bildung von Familiennamen den spezifisch dörflichen Bedingungen.139 Damit berühren wir einen Seitenzweig des deutschen Kaisergedankens. Der Beckenbauer ist derjenige, der sich von seinen Nachbarn dadurch abhebt, daß er als Zusatzerwerb Brot backt. Er bleibt aber, wie sein Name besagt, Bauer. Deshalb werden die Landbäcker erst allmählich zur Konkurrenz für das urbane Gewerbe, weil sie keine städtischen Auflagen zu tragen haben und billiger produzieren können.140
Weil ein geeigneter Backofen aufwendig herzustellen ist und sich für den einzelnen zumeist nicht lohnt,141 wird in den größeren Dörfern des deutschen Südens das Gemeindebackhaus entstehen, in dem jeder individuell sein Brot herstellen kann.142 Nachlaßinventare noch des 16. Jahrhunderts erwähnen die Brottücher und Mehlbeutel, die dafür benötigt werden.143 Bisweilen können Backstuben in die Rathäuser von Dörfern und Kleinstädten einbezogen werden. Das dient zugleich dem Durchheizen der Gebäude im Winter.
Backen ist Kunst und unterliegt als solche den geschichtlichen Veränderungen. Wir widersprechen damit Justus Liebig, demzufolge das Bäckergewerbe das einzige sei, das sich seit den Zeiten des Plinius nicht verändert habe.144 Für große Veränderungen mußte schon die Professionalisierung des Backens in einem wachsenden, differenzierte Strukturen entwickelnden urbanen Gemeinwesen sorgen. Familiennamen spiegeln die |86|Orientierung auf unterschiedliche Kundenkreise wider. Wenn jemand Weißbrot heißt, dann ist er spezialisiert auf das feine, schöne Herrenbrot;145 der Schwarzenbeck hingegen backt das grobe, einfache Brot für den gemeinen Mann.146 Innerhalb der Bäckerzünfte gab es große soziale Unterschiede zwischen reichen und armen Meistern.147 Qualitätsunterschiede setzen Entwicklungen und Veränderungen voraus. Das weist auf die Begrenzung der Aussage Liebigs zurück. Aber diese Aussage hat insofern ihre Berechtigung, als sie auf die gewerbliche Stabilität des Bäckerhandwerks zielt.
Werden innerhalb einer Zunft die Gegensätze zwischen reichen und armen Meistern zu scharf, verarmt die Mehrzahl der Meister, dann droht eine Erosion der Genossenschaft, dann können – wie vielfach im Textilhandwerk zu beobachten – die wenigen Reichen zu Verlegern werden, welche die Handwerksorganisation nur als Teil des Produktionsprozesses verstehen. Das Bäckerhandwerk aber ist trotz aller ökonomischen Unterschiede im Innern148 nirgendwo von einer solchen Entwicklung bedroht gewesen. Im Gegensatz zum exportorientierten Gewerbe der Weber bot die Orientierung der Nahrungsmittelzünfte der Bäcker, Metzger und Brauer auf den lokalen städtischen Markt trotz aller obrigkeitlichen Reglementierungen wenn nicht gar Wohlstand, so doch ein zumindest ausreichendes wirtschaftliches Auskommen.
Professionalisierung des Backens in der Stadt: Ausnahmsweise glauben wir eines der ansonsten alterslosen Sprichwörter, nämlich „Gut Brot und gut Rat sind teuer“, ungefähr datieren und seine Entstehung im ausgehenden 13. Jahrhundert annehmen zu können. In dieser Zeit gewinnen die Notare eine immer größere Bedeutung. Nicht nur Freunde und Verwandte geben guten und kostenlosen Rat, sondern Experten, die zu bezahlen sind. Eine neue Erfahrung, die in dem Sprichwort mit der entwickelten Professionalität des Backens in Verbindung gebracht wird. Die seit dem 13. Jahrhundert bezeugten Bäckerzünfte stellen zunächst Produkte für den höfischen Bedarf her und sind anfangs noch hofrechtlich an ihren wichtigsten Auftraggeber gebunden. „Kammerhandwerke.“149 Diese an die Quellensprache angelehnte Bezeichnung erinnert daran, daß der fürstliche oder bischöfliche Hof den zumeist wichtigsten Kundenkreis für feine Backwaren, teure Kleidung und Schuhe umschloß. Die „camera“ war Rechnungsstelle der Hofhaltung. Mit der Verselbständigung der Städte gegenüber dem Stadtherrn orientiert sich die zunächst an den Hof gebundene Gemeinschaft der Kammerhandwerke zur Bürgergemeinde. Im Rahmen dieser auf die Urbanität bezogenen Aufgabe wandert die Bäckerzunft von den großen in die mittleren und schließlich auch in die kleineren Städte.
In den Zünften sind Tätigkeiten spezialisierter Männer organisiert, und damit ist auch die Geschichte des Backens eine Geschichte der Verdrängung von Frauenarbeit. Daran erinnert ein singulärer Fall in der Geschichte des mittelalterlichen Handwerksrechts, nämlich die Zunftordnung der Frankfurter Bäcker 1377, die ausdrücklich die Aufnahme von Frauen gestattet.150 Lange währte in Frankfurt die Erinnerung daran, daß das Backen noch um 1300 in die Hauswirtschaft eingebunden war und sich damals noch ein größeres Konfliktfeld bei der Entstehung der Handwerksorganisationen auftat. |87|Früher als die Metzger beim Hausschlachten erreichten die Bäcker die Verdrängung des Hausbackens. Nur noch bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts gibt es den „Baubeck“, den Lohnbäcker, der in vornehmen Bürgerhaushalten, vor allem bei Festen, die Zubereitung der Brote übernimmt und wie ein Tagelöhner gedingt wird.151 Verheiratete Gesellen, welche kein Meister mehr einstellte, die aber das Handwerk beherrschten, standen dafür zur Verfügung.152
Wenn früher als die Metzger die Bäcker Erfolg bei ihrem Bemühen haben, die Konkurrenz der Lohnbäcker zu verdrängen, müssen sie nicht nur den Widerstand der Gesellen, sondern auch den reicher Bürger überwinden; denn diese wollen an der partiellen Autarkie ihrer Hauswirtschaft festhalten. Obwohl die Ratsherren diesen Reichen verwandtschaftlich verbunden sind, stützen sie die Meister; das erscheint ihnen vom Gedenken des gemeinen Nutzens der Stadt her geboten. In diesem Fall zielt dieser Gedanke nicht auf den Markt, sondern auf die Bürgergemeinde. Die Meister sind allesamt zu Bürgerrecht ansässig, die Gesellen aber nicht. In Frankfurt ist jeder Bäcker zum „Baubacken“ mit dem Mehl der Kunden verpflichtet. Das freie Dingen von Lohnknechten ist damit zwar unterbunden, aber jetzt werden die Meister selbst auf die Interessen der Hausherrschaft vornehmer Bürger verpflichtet; eine der vielen Ratsvorschriften, welche das Handwerk, das natürlich lieber für den Markt produziert, einengen.153 Aber selbst dieser Kompromiß, der noch die Interessen der Reichen (natürlich nicht die der Gesellen) berücksichtigt, wird zu Anfang des 15. Jahrhunderts zugunsten der Bäcker aufgehoben.154 Die Gründe für diese auffallende Beschneidung von Interessen der Oberschicht erschließen sich bei Berücksichtigung der vom Rat zu wahrenden schwierigen Balance im städtischen Gemeinwesen mit seinen klaffenden sozialen Gegensätzen. Einerseits reglementierte der Rat das Bäckerhandwerk im Interesse des gemeinen Nutzens, andererseits mußte er, um die Ernährung der Bevölkerung zu gewährleisten, die Bäcker „bei Laune halten“. Vor allem führte das Entstehen der Bäckerzünfte zur Hierarchisierung im handwerklichen Produktionsablauf; Gewinner sind die Meister, Verlierer die Gesellen. Das gilt zwar für alle Handwerksgenossenschaften, aber für die Nahrungsmittelzünfte der Bäcker und Metzger in besonderem Maße; denn ihre Meister können gleichermaßen Handwerker und Händler und deshalb wohlhabend sein. Welten trennen sie von jenen Meistern in den reinen Handwerkerzünften, die allein von ihren Erzeugnissen leben müssen und die Bitterkeit des Sprichworts erfahren: „Fingerlang Handel bringt mehr als armlang Handwerk.“155
Über alle Unterschiede hinweg gilt für die Zünfte: Die berufliche Spezialisierung hat noch nicht den Grad erreicht, den die Meister weniger aus handwerklichen als aus familiären Interessen in der frühen Neuzeit durchsetzen werden. Der Geselle heißt noch bis Ende des 15. Jahrhunderts „Knecht“, Diener einer Hausherrschaft.156 Er verfügt, um bessere Möglichkeiten bei der Stellensuche zu haben, über die verschiedensten Fertigkeiten, so daß ein Sprichwort mahnen muß: „Wer viele Handwerke kann, kann keines recht.“157 Insofern kommen die Erzählungen von Til Eulenspiegel, der als Knecht die Meister der verschiedensten Gewerbe hereinlegt, der Realität durchaus nahe. Der |88|Wortwandel zu „Geselle“ beruht auf der im 15. Jahrhundert vor allem über das Bruderschaftswesen gewachsenen Solidarität unter den Abhängigen. Gesellenbruderschaften aber sind, gerade weil sie eine Tarnform der Interessenwahrung gegenüber den Meistern bilden, auf das jeweilige Handwerk orientiert. Der Wortwandel zu „Geselle“ bezeichnet also im Zusammenhang mit dem Bruderschaftswesen einen Spezialisierungsprozeß, der allerdings noch um 1500 in Konkurrenz zu älteren Traditionen der Mehrfachqualifikation steht.
An die Hierarchisierung des Handwerks zu Lasten der Gesellen erinnert das noch heute lebende Wort „hausbacken“. In Redensarten kann bewahrt sein, was die schriftlichen Quellen in einer Welt der mündlichen Kommunikation gar nicht enthalten können. Denn das steht hinter dem Ausdruck „hausbacken“: Der abschätzige Wortsinn folgt den Intentionen der Meister, aber er konnte nur deswegen zur Redensart werden, weil die Menschen überzeugt waren, daß die Bäcker das bessere Brot buken, weil mit der Professionalisierung des Backens zugleich eine Qualitätsverbesserung verbunden war. Gekauft wurde in den Städten anstelle des flachen Fladenbrotes der Brotlaib. „Gut Brot und gut Rat sind teuer.“
Die Professionalisierung des Bäckergewerbes erweist sich beim Ausbacken des Brotes. Auch dieses Grundnahrungsmittel folgt den Entwicklungsprozessen so vieler Handwerksprodukte im Spätmittelalter, der Veredelungswirtschaft.158 Die entscheidenden Hinweise sind erneut Ulf Dirlmeier zu verdanken. Das Brot um die Mitte des 15. Jahrhunderts war feiner ausgebacken als hundert Jahre zuvor. Das Semmelbrot um 1442 hat die Feinheit der Brezel, des feinsten Gebäcks von 1309. Also: Was 1309 noch Luxus war, ist 1442 eine normale Qualitätsvorstellung. Die Brezel von 1442 nähert sich bereits unserem Qualitätsempfinden von gutem Brot an.159 Die Gründe dafür liegen neben der Professionalisierung in den technischen Verbesserungen der Mühle, die einen zweiten, feiner eingestellten Mahlgang erlaubten.160 Jetzt wird ein weiterer Grund für den Wortwandel von „Knecht“ zu „Geselle“ sichtbar. Die Orientierung der Gesellenbruderschaft auf ein bestimmtes Handwerk beruht nicht zuletzt darauf, daß etwa beim Backen die Beherrschung verfeinerter Techniken eine Spezialisierung der „Knechte“ erzwang.
Wirken sich die angeblichen säkularen Trends der Getreidepreise auf das Bäckerhandwerk aus? Wir trauen den mit vieler Mühe erstellten Datenreihen für die Preisentwicklung des Getreides nicht allzusehr, jenen Datenreihen, denen Wilhelm Abel eine spätmittelalterliche Agrarkrise glaubte ablesen zu können.161 Die erheblichen Schwankungen der Preise162 sind nicht nur auf unterschiedliche Ernteerträge zurückzuführen, sie können auch, worauf erstmals, leider wenig beachtet, Thomas Rahlf hinwies, auf Qualitätsschwankungen beruhen, hervorgerufen durch unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalt. Je mehr es in der Erntezeit regnet, um so schwerer wiegt das Korn; es „kann die effektiv verbrauchte Menge pro Volumeneinheit um bis zu 200 % schwanken“. Die Volumenangaben in den Quellen können nicht als konstanter Faktor gewertet werden.163 Die Preisreihen täuschen.
|89|Die Handwerke der Bäcker und Metzger sind bis in das 19. Jahrhundert hinein relativ ungefährdet geblieben. Weder technische Neuerungen noch Absatzkrisen haben sie in größere Schwierigkeiten gebracht.164 Die innerhandwerkliche Erosion durch den Verlag bedrohte sie nicht. Die Krisenfestigkeit des Bäcker- und Metzgergewerbes ist nicht aus dem Handwerk selbst begründet worden, sondern durch jene, unter großen Schwierigkeiten entwickelte Marktregelungen, die einen Ausgleich zwischen divergierenden Interessen in einem Bündel von Einzelmaßnahmen erreicht hatten. Jedem modernen Ökonomen werden sich die Haare sträuben, wie tendenziell dirigistisch die Ratsobrigkeiten in das Marktgeschehen eingriffen.165 Jedoch es gilt, auch um die Überschrift des folgenden Kapitels nicht von vornherein als Unsinn abzulehnen, zu bedenken, welche heute kaum noch vorstellbare Bedeutung die Nahrungsmittel im Haushalt des gemeinen Mannes hatten. Und vor allem: Nicht der Ökonomie, sondern dem sozialen Frieden sollten die Statuten spätmittelalterlicher Stadträte dienen. Und dabei ist zu fragen, ob die Stadträte nicht ein im Vergleich zu heute viel weiteres Verständnis von Ökonomie, das den Frieden und die Konfliktfreiheit als wirtschaftliche Faktoren einschloß, besessen haben. Der dirigistische Ansatz mag aus heutiger Sicht im engeren Verständnis von Wirtschaftlichkeit verfehlt sein, aber nicht das Ziel dieser Ordnungen. Deren friedenssichernde Kraft bewies die lange und bis in das frühe 19. Jahrhundert nahezu unumstrittene Geltungsdauer ihrer Prinzipien.166