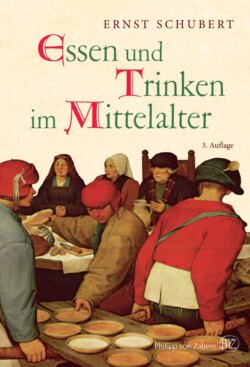Читать книгу Essen und Trinken im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 26
Die wichtigsten Getreidearten und ihre Geschichte oder: Die Problematik historischer Periodisierungen
ОглавлениеDer Wind, das Getreide und das historische Datengerüst – Die Felder und das Unkraut – Frühgeschichtliche Siedlungskammern und die Fronhöfe – Die „Vergetreidung“ des hohen Mittelalters als Folge des Wandels der Agrarverfassung – Der hochmittelalterliche Landesausbau und das Vordringen von Roggen und Hafer – Weizen und Roggen: Weißbrot und Schwarzbrot – Tradition und Fortschritt: Silo und Scheune
Dem Salz ist als Geschenk der Erde an den Menschen zu danken gewesen. Wir müssen jetzt nicht 250 Millionen Jahre zurückgehen, um ein weiteres Geschenk der Erde, das Getreide, in seiner historischen Bedeutung zu würdigen. Eine selbstkritische Frage kann der Historiker dabei nicht ausklammern: Wie tragfähig ist sein Datengerüst? Die Geschichte der Ernährung erweist, daß alle historischen Periodisierungen nur Hilfskonstruktionen sind. Im vorliegenden Fall: Die sogenannte historische Zeit hängt mit den vorgeschichtlichen Jahrtausenden viel enger zusammen, als Daten glaubhaft zu machen versuchen.14 Und deshalb ist auch die Frage ernst zu nehmen, ob die Nomadenkulturen, die ihre Kultur in vergänglichen Materialien wie Holz und Leder gestalteten, primitiver gewesen sein sollten als jene, die haltbare, halbwegs datierbare Steine und Bronzen verwendeten. Über die Wirtschaftsformen von Nomaden und Seßhaften hatte der Wind entschieden.
Sturm und Wind hatten Weizen und Roggen in vorgeschichtlicher Zeit aus Kleinasien als Unkraut nach Europa geweht.15 Wenig beachtet wurde lange Zeit die unverhoffte Gabe des Roggens und der Gerste.16 Zunächst sollten die Menschen den Emmer, einen Hartweizen, der sich vor allem für Grütze und Brei eignete, in Kultur nehmen;17 das zunächst weitverbreitete zierliche Einkorn, ein anspruchsloser Spelzweizen, war schon im frühen Mittelalter kaum noch bekannt.18 Der Dinkel hatte sich in der späten Steinzeit als Seitenzweig des Emmers als weiterer widerstandsfähiger Hartweizen entwickelt.19 Die einzige Weizenart, die auch unwirtliches Klima aushält, der Zwergweizen, wurde jahrhundertelang in den Alpentälern angebaut.20 Das klingt so einfach und verlangte doch einen schwierigen Kultivierungsprozeß. Die ältesten Weizenarten sind schwer auseinanderzuhalten.21 Der heutige Saatweizen ist die jüngste der Züchtungen.22
|74|Die Körner des Getreides waren im Mittelalter kleiner als heutzutage.23 Und zudem: Nur das Drei- oder bestenfalls das Vierfache der Aussaat erbrachte die Ernte.24 Deshalb kam der Sichel – die Kniesense kam erst um 1500 auf25 –, mit der die Ähren geschnitten wurden, besondere Bedeutung zu.26 Um einen „sägenden Schnitt“ zu erreichen, war ihre Schneidefläche eingekerbt; denn es galt den Verlust von Körnern zu vermeiden.27 Zu kostbar war jede einzelne Ähre. Verständlich, daß unter solchen Bedingungen Magie die Geschichte von Getreide und Brot bis in die frühe Neuzeit hinein begleiten sollte.28
Und auch das verbindet Urgeschichte und Mittelalter: Die starke Verunkrautung der Felder29 führt dazu, daß die Menschen mit ihrer Nahrung Unkrautsamen verschlucken mußten30 – und das, obwohl das Getreide nicht mit dem Halm geerntet, sondern an den Ähren abgeschnitten wurde.31 Aber das Unkraut duckt sich nicht am Boden, sondern erreicht die Höhe der Ähren. Im hochmittelalterlichen Neuss befinden sich regelmäßig 13 % Unkrautsamen unter dem Mehl.32 Selbst die giftige Kornrade versteckt sich im Korn.33
Die Kulturlandschaft in frühgeschichtlicher Zeit ist in deutschen Landen bestimmt von Siedlungskammern inmitten des „Unlandes“, der „terra inculta“, der siedlungsabweisenden Urwälder, Moore und Sümpfe. Lediglich die Adeligen konnten über diese Enge hinausblicken. Die Perlen etwa, mit denen sie sich schmückten, kamen von weit her.34 Die einfachen Menschen hingegen mußten sich schon beim Essen und Trinken mit dem begnügen, was ihre unmittelbare Umgebung gewährte. Diese Einzwängung der einfachen Menschen in Siedlungskammern bei gleichzeitiger adeliger Raumbeherrschung prägt im Frühmittelalter die sozialen Verhältnisse.
Eine Folge der Auflösung der Fronhofsverfassung im hohen Mittelalter beschrieb Diedrich Saalfeld, ausgehend von der Wurt Elisenhof, einer typischen Siedlungskammer, als Wandel der vielseitigen frühmittelalterlichen Ernährung „zur einseitigen kohlehydratreichen Kost in der Periode der vorherrschenden Dreifelderwirtschaft“, in der Brot und Mehlspeisen in den Mittelpunkt rücken.35 Die Forschung hat diesen Vorgang in einem sprachlich unschönen, aber sachlich zutreffenden Schlagwort zusammengefaßt, in dem der hochmittelalterlichen „Vergetreidung“.36 Bildete aber die von Saalfeld beschriebene Entwicklung tatsächlich einen, wie er nahelegte, ernährungsgeschichtlichen Rückschritt? Die vielseitige Ernährung, die er frühmittelalterlichen Besitzverzeichnissen abgelesen hat, ist die der Herrenschicht; die Knechte hingegen, die einfachen Leute konnten nur genießen, was die Herren ihnen übrigließen. Vor allem in der Geschichte des Obst- und Weinbaus werden die Abhängigkeiten sichtbar, weil die in den abgezäunten Gärten Arbeitenden vom Haupthof ernährt werden mußten.37
Die „Vergetreidung“ des hohen Mittelalters mag vordergründig als eine Verkleinerung der Nahrungspalette erscheinen, wenn der Blick nur auf die Produkte gerichtet wird, ohne den Konsum einzubeziehen. Aber erst die schlichte Frage, was wer essen kann, erklärt die hochmittelalterliche Dominanz des Getreides als des Grundstoffes für Brei und Brot und weist auf die neue Selbstverantwortung bäuerlichen Wirtschaftens hin. Die „Vergetreidung“ beruht auf einer grundlegenden Umstellung der Ökonomie |75|zum eigenverantwortlich wirtschaftenden bäuerlichen Betrieb. Was zunächst den einzelnen Bauernhof betraf, sollte weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen haben. Vergetreidung und Verdorfung hingen eng zusammen; die Welt der Siedlungskammern gehörte, was sich bereits im 11. Jahrhundert abzeichnete, der Vergangenheit an.38 Und vor allem: Die Fronhofsorganisation war zugleich ein Versorgungssystem nach oben für die Herren, nach unten für die Arbeitenden gewesen. Nunmehr aber stellten sich für den selbständig wirtschaftenden Bauern die Aufgaben der Marktorientierung. Und das betraf zunächst das Getreide, nach dem die größte Nachfrage bestand.
Weizenarten, von denen wir nur die wichtigsten hervorgehoben haben, und Gerste in ihrer ebenfalls großen Artenvielfalt39 hatten unter dem ur- und frühgeschichtlichen Getreide dominiert. Spelzweizenarten wie Emmer, Einkorn und Dinkel werden allmählich durch das ertragreichere Nacktgetreide des Weizens und Roggens an den Rand gedrängt. Die sogenannten sekundären Kulturpflanzen Roggen und Hafer „erreichten von der Eisenzeit an etwas größere Bedeutung, setzten sich weithin aber erst im Mittelalter durch“.40 Der Roggen ist schon seit dem Frühmittelalter das dominante Brotgetreide.41 Verlierer gegenüber Roggen und Hafer sind im Spätmittelalter die Weizenarten. Dazu haben nicht nur wirtschaftliche, sondern auch klimatische Gründe beigetragen.42 Ein Beispiel: Als der spätreifende, aber geringere Ansprüche an den Boden als Weizen stellende Dinkel oder Spelzweizen mit der im 14. Jahrhundert einsetzenden „Kleinen Eiszeit“ nicht mehr rechtzeitig geerntet werden konnte, begannen die Bauern ihn zu rösten.43 Der einst von den Alpentälern bis in den Moselraum, vom Elsaß bis Thüringen verbreitete Dinkel44 ist seitdem im Niedergang begriffen.45 Kein Wunder: Holz muß gespart werden. Vor dem gänzlichen Vergessen wurde er gerettet, als eine Brauerei, Dinkelacker, ihn seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder anbauen ließ. Was zunächst nostalgischer Vergegenwärtigung eines Familiennamens diente, hatte unerwartete Folgen: Grünkern wurde zum Kultgetreide.
Natürlich gab es auch weiterhin den Weizen als Brotgetreide. Er behauptete sich in besonders fruchtbaren Gebieten, stellte zum Beispiel einen wichtigen Exportartikel des fruchtbaren Jülicher Landes dar,46 er dominiert bis in das 17. Jahrhundert hinein den Getreidemarkt in Köln,47 denn er ist in viel größerem Maße als Roggen und Hafer eine Fernhandelsware. Weizenbrot ist schon allein wegen der mahltechnischen Schwierigkeiten wesentlich (durchschnittlich 20–30 %) teurer als Roggenbrot.48 Deswegen ist es das „schöne Brot“, ein Nahrungsmittel der Oberschicht.
Beim Roggen ist im Vergleich zum Weizen, der die höchsten Ansprüche an den Boden stellt, der Ernteertrag sicherer,49 die Transportfähigkeit größer, die Lagerung einfacher.50 Der winterfeste Roggen wurde zum wichtigsten Brotgetreide,51 weil er Temperaturen bis zu −30° C ertragen kann und wegen seiner dichten Bewurzelung selbst auf nährstoffarmen Sandböden gedeiht.52 Der Weizen hingegen benötigt gemäßigtes Klima.53 Das Roggenfeld wurde bei der entstehenden Dreifelderwirtschaft zum Winterfeld, hingegen ist das „haberfeld“ das Sommerfeld.54
Das Vordringen des anspruchslosen Roggens im Hochmittelalter ist kein Wunder. In |76|Osteuropa, das heute fast zwei Drittel der Weltroggenernte stellt, war er bis ins hohe Mittelalter hinein nahezu unbekannt.55 Der Landesausbau ist ohne den Roggen ebensowenig zu denken wie ohne den im Frühmittelalter noch seltenen Hafer;56 denn auch dieser ist unempfindlich gegen rauhes Klima, er gedeiht selbst auf frisch gerodeten Flächen und stellt keine großen Ansprüche an den Boden.57
In deutschen Landen hatte sich Landesausbau rein flächenmäßig am stärksten in Europa ausgewirkt. Infolgedessen sollte der Siegeszug des Roggens auch das Bild der Deutschen im Ausland mitbestimmen; denn das deutsche Brot ist das langsamer als Weißbrot austrocknende Schwarzbrot.58 Dieses läßt italienische Reisende immer wieder schaudern.59 So schimpft Antonius Campanus 1471 über dieses ungesalzene und klebrige Brot, welches geradezu eine Zumutung sei.60 Aber die Haltbarkeit der Nahrung war das entscheidende Problem in deutschen Landen.
Nur mit groben Strichen konnte die Geschichte des Getreides nachgezeichnet werden. An einem Beispiel sei begründet, warum dieses Bild nicht detailreicher und damit verwirrender ausgestaltet wird. Der vor allem für Breie geeignete Buchweizen („heiden“),61 das Basiserzeugnis der Moorkolonisation des 18. Jahrhunderts,62 ist erst im 14. Jahrhundert bekanntgeworden.63 Lediglich in kleinen Quantitäten erscheint er in den rheinischen Zollrechnungen.64 Und dieses klare Ergebnis stören archäologische Funde, die bereits für das 12. Jahrhundert in Ostfriesland und in Neuss dieses Getreide nachweisen.65 Das Beispiel mag zeigen, daß bei den weniger gängigen Getreidesorten Schwierigkeiten der historischen Einordnung fast unüberwindlich sind, weil die schriftlichen und archäologischen Quellen kein eindeutiges Bild ergeben und weil die regionalen Variations- und Anpassungsfähigkeiten viel größer gewesen sein müssen, als sich nachweisen läßt. Das Mängelwesen Mensch ist offenbar so flexibel, daß es den um klare zeitliche Abfolgen bemühten Historiker zur Verzweiflung treiben kann.
Wenn „Kultur“ in ihrer ursprünglichen Bedeutung als Ackerbau verstanden wird, läßt schon das Beispiel des Roggens und Hafers sichtbar werden, daß die vorgeschichtlichen Voraussetzungen nicht allein die Kultur der geschichtlichen Zeit determinierten. Kultur enthält immer auch Anverwandeln des Vorgegebenen oder einfacher ausgedrückt: Fortschritt. Dieser Begriff ist lange in einem so schlichten Vorverständnis gebraucht worden, daß ihn Historiker heute vielfach nur mit spitzen Fingern anfassen. Ich lasse mich aber nicht irritieren. Es ist ein Fortschritt in der Geschichte erkennbar. Allerdings vollzieht er sich nicht in linearen Abfolgen und auch nicht in Abfolgen von Entwicklungssprüngen. Er ist stets eine erst im nachhinein zu ziehende Bilanz aus einer Vielzahl von Gewinnen und Verlusten. Nicht alles, was neu ist, ist deshalb schon Fortschritt. Und oft genug erscheint zudem das Neue als Adaption des Alten. Ein Beispiel: Das Brotgetreide wurde im Frühmittelalter noch in großen Gefäßen in Gruben verwahrt,66 ein seit Jahrtausenden verbreitetes Prinzip. Diese Vorratshaltung geriet im Laufe der Zeiten in Vergessenheit, so daß Agronomen des frühen 19. Jahrhunderts erstaunt waren, als sie diese in einigen Regionen Frankreichs und Spaniens entdeckten und von daher auch das Wort übernahmen, das seitdem zu einem international üblichen Terminus technicus geworden ist: Silo.
|77|
Zisterzienser beim Mähen von Getreide. Tafel eines Flügelaltares von Jörg Breu dem Älteren, um 1500, Stiftskirche Zwettl.
Das Beispiel des Silos erinnert an die Auflösung der Fronhofsverfassung. Denn diese Form der Vorratshaltung war nicht die des kleinen Mannes, sondern gehörte zur Zentralität des Haupthofes, diente der Versorgung der „familia“, des Personenverbandes einer Villikation, und dem Verkauf von Überschüssen. Der selbstwirtschaftende Bauer brauchte neue Formen der Vorratshaltung, er brauchte die Scheune, die mehr sein mußte als der frühmittelalterliche ebenerdige Speicher.67 Diese ist integraler Bestandteil der hochmittelalterlichen „Vergetreidung“. Das um 1800 wiederentdeckte Silo hingegen erhellt eine Entwicklung, aufgrund deren der Bauer der vorindustriellen Zeit zum Landwirt des 19. Jahrhunderts werden konnte.