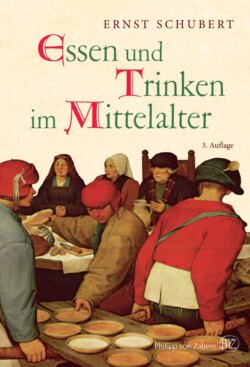Читать книгу Essen und Trinken im Mittelalter - Ernst Schubert - Страница 27
|78|Die Geschichte der Mühle: ein konstantes Element in den Wandlungen der Agrarverfassung
ОглавлениеHandmühle und Wassermühle – Die Herrschaft und die Mühle – Die Bedeutung des Satzes „Wer zuerst zur Mühle kommt …“ – Die Stadt, die Mühle und der Müller – Windmühlen?
Die triviale Tatsache, daß Getreide erst gemahlen werden muß, bevor es zu Brei oder Brot verarbeitet werden kann, erhellt Konstanz und Wandel der agrarischen Produktion. Seit vorgeschichtlicher Zeit wußten die Menschen weltweit, daß die Körner zwischen zwei Steinen zerrieben werden konnten, wobei der obere der sogenannte Läuferstein war, der untere aber fest stand.68 Zwischen Reibstein und Läufer wird das Korn zerrieben.69 Bis in das hohe Mittelalter hinein war ein solches Verfahren bekannt;70 insbesondere die kleinen Leute mußten sich zuweilen noch mit der Handmühle, der „querna“, behelfen.71 Deswegen wurde in der Volksetymologie der hl. Quirinus zum Mühlenheiligen. Aber Handmühlen waren allenfalls für Eigenbedarf sinnvoll, nicht für ein Vermarkten von Mehl.
Die Wassermühlen, die sich seit fränkischer Zeit durchsetzen, sind bedeutende technische Leistungen.72 Nur die Herrschaft besitzt das Geld für solch aufwendige Werke. Unverzichtbar ist für sie das teure Eisen, weswegen die „Lex Salica“ dessen Diebstahl aus der Mühle unter schwere Strafe stellt.73 Hohe Kosten verlangt nicht nur deren Bau, sondern auch der Unterhalt. Wie ölt man die Holzachse des Mühlrads? Offenbar mit dem Talg, der nach dem „Capitulare de villis“ (c. 35) von fetten Schafen und Schweinen gewonnen wird. Dennoch: das Mühlrad quietscht ohrenzerreißend. Um 870 reagiert darauf mit launigem Ton Notker Balbulus: „Gewiß kann das Mühlrad sprechen. Ich habe deutlich gehört, was es heute gesagt hat: Sanctus spiritus assit nobis.“74 Lautmalerisch wird hier das Geräusch des sich schwerfällig drehenden Rades nachgeahmt. Und dann die Mühlsteine. Sie werden vielfach über weite Strecken herangewuchtet, ja, sie können sogar ein Exportartikel sein. Mühlsteine aus Basaltlava der Eifel werden schon im Frühmittelalter bis nach Skandinavien exportiert.75
Die Mühle als zentraler Ort des frühmittelalterlichen Fronhofsverbandes und des hochmittelalterlichen Dorfes. Ihre grundherrschaftliche Bindung blieb selbst nach Auflösung der Villikationsverfassung bestehen.76 Mühlenbann. Nur in einer bestimmten Mühle darf ein Bauer sein Korn mahlen lassen. Abhängigkeit von der grundherrschaftlich gebundenen Mühle. Ist es, so frage ich den geduldigen Leser, der, wie ich ihn mir vorstelle, abgehärtet ist gegenüber kühnen Originalitätsideen, gar so abwegig zu behaupten, daß ein im „Sachsenspiegel“ verankerter Rechtsgrundsatz, der so weit verbreitet war, daß er zum Sprichwort wurde, eine Vorstufe zur Demokratie darstellt? Wer zuerst zur Mühle kommt, der mahlt zuerst, „der e zu der mul kumt, der melt e“.77 Zu bedenken ist bei diesem Rechtssatz: Dem Mühlenbann, der meistens nicht nur für ein |79|Dorf, sondern für einen ehemaligen Fronhofsbereich galt, waren die Bauern, waren aber auch die Pfarrer mit ihrem der Kirche gehörenden Widemgut ebenso unterworfen wie jene Adeligen, die sich bei der Auflösung der Fronhofsverfassung in Eigenwirtschaft betriebene Höfe gesichert hatten.78 Und nach der Ernte wird die Mühle ein Stoßbetrieb, zu dem alle drängen – aber Stand und Rang sollten hier nicht gelten.
|80|
Mahlwerk einer Mühle. Aus Konrad Kyesers „Bellifortis“ (Kriegsbuch), böhmisch, erstes Drittel des 15. Jh. Österreichische Nationalbibliothek, cod. 5278, fol. 173v.
Mühlen gehörten nicht nur zum Dorf, sondern auch zur Stadt.79 Die Forschung hat längst die Auffassung des 19. Jahrhunderts überwunden, wonach die mittelalterliche Stadt ein gegen die adeligen Vorrechte entwickelter Freiheitsraum gewesen wäre. Aber die Stadt veränderte in ihrem Einflußbereich die Herrschaftsordnung. Das läßt sich etwa über die bürgerliche Pfandnahme herrschaftlicher Rechte belegen, ist aber viel einfacher an der Geschichte der Mühlen zu erkennen. Diese werden aus dem grundherrschaftlichen System herausgelöst und städtische Regiebetriebe. Unter einem Mühlmeister arbeiten etwa fünf Angestellte pro Betrieb, kontrolliert von den „Beutelherren“, vom Rat beauftragten Ratsherren.80 Die Schweinemast ist wie auf dem Lande auch hier eine einträgliche, dem Stadtsäckel zufallende Nebeneinnahme.81 Ein Mühlenbann wie auf dem Lande wird von den Stadträten gar nicht angestrebt; aber die Obrigkeit kontrolliert und normiert. Überraschend einheitlich beträgt der Mahllohn etwa 6 % des Mehlpreises.82
Die Mühlen als städtische Regiebetriebe liegen anfangs wie in den Dörfern zumeist außerhalb der Siedlung. Weil sie jedoch bei Fehden zuerst den feindlichen Angriffen ausgesetzt sind, werden sie, wo immer es möglich ist, hinter die sicheren Stadtmauern verlegt.83 Und auch das wird den städtischen von dem dörflichen Müller unterscheiden: Der unter Kontrolle des Rats stehende Müller hat nicht wie sein Berufskollege auf dem Land unter Verdächtigungen und Vorurteilen zu leiden. Die städtische Überwachung trocknete den Nährboden aus, in dem die Vorurteile wurzelten, daß nämlich mit einem Beutel voll Mehl zurückkehrte, wer einen Sack mit Korn zur Mühle getragen hatte. Der ehrliche Müller, so faßt ein Sprichwort die gängigen Ansichten zusammen, hat Haare unter der Zunge – es gibt ihn nicht.84 Zur Verbreitung dieser Verdächtigung hat beigetragen, daß die Mühle außerhalb des Dorfes lag, was den Müller zum Außenseiter der Dorfgemeinschaft werden ließ. Dazu kam, daß seine Beziehung zum Grundherrn viel enger blieb als die der Bauern, deren Korn er mahlte.85 Das alles galt aber nicht für den Müller als Angestellten, bisweilen auch als Pächter eines städtischen Regiebetriebs.86
Das Mißtrauen der Bauern war verständlich in einer Welt, in der die Sicheln gekerbt waren, um bloß kein Körnchen zu verlieren. Wie weit darf der Mahlkasten vom Rand des Mühlsteins entfernt stehen, nur einen Daumen oder einen Pfennig breit?87 Aber denken die Menschen in der Stadt aufgeschlossener? Sie denken von anderen Voraussetzungen her. Die Unehrlichkeit auf dem Lande ist ein Vorurteil ohne Rechtsfolgen. Erst das städtische Handwerk wird die ausgrenzenden, die sozial diffamierenden Konsequenzen des Vorurteils ziehen; es entwickelt die Infamierung zum rechtlichen Prinzip, indem den Angehörigen sogenannter „unehrlicher Berufe“ der Zugang zu den Zünften verwehrt wurde.88
|81|Wenn in der frühen Neuzeit Mühlen als Treffpunkte zwielichtigen Gesindels gelten, wozu die Absonderung von der dörflichen Siedlung auch einlud,89 so hatte sich gegenüber früheren Zeiten viel in der Wertschätzung dieser Betriebe geändert. Denn angesichts ihrer jedermann bewußten Bedeutung, angesichts aber auch der hohen Kosten, die ihre Anlage bedeutete, standen sie von den Leges angefangen über die Landfrieden bis hin zu den bäuerlichen Weistümern unter Rechtsschutz, waren befriedete Orte, die sogar das Asylrecht beanspruchen konnten.90
Die Mühle, von der bisher gesprochen wurde, war die Wassermühle. Die Windmühle stammt aus dem Mittelmeerraum91 und setzt sich in norddeutschen Landen durch niederländische Vermittlung in Gestalt der in die jeweilige Windrichtung drehbaren Bockwindmühle erst im 18. Jahrhundert durch.92 Die zur Alltagsgeschichte gehörenden Irritationen werden diesmal nicht durch archäologische, sondern durch historische Befunde hervorgerufen. Kurzfristig stand 1222 auf der Kölner Stadtmauer eine solche Anlage, eine hölzerne „molendinum ad ventum“. Sie war eine Sehenswürdigkeit, nach der die Lage eines Hauses bezeichnet wurde.93 Zur gleichen Zeit, 1234, schenkte Heinrich von Barmstede dem Kloster Ütersen die Hälfte der Einkünfte einer Windmühle („molendinum ventivolum“).94 Solche Anlagen sind 1307 in Münster vor dem Aegidientor,95 1333 in Bremen vor dem Ostertor und 1355 vor Stralsund bezeugt.96 In Speyer konnte nachgewiesen werden, daß eine Windmühle 1393 durch holländische Experten eingerichtet worden war.97 Aber allein im Münsterland hat sich während des 16. Jahrhunderts, als die Anzahl der Mühlen verdoppelt wurde, auch die der Windmühlen entsprechend vergrößert.98
Die Nutzung der Wasserkraft für das Mahlen von Korn schuf die Erfahrung, aufgrund deren im Spätmittelalter Säge- und Hammermühlen entwickelt werden konnten, die im Mittelpunkt der sogenannten „industriellen Revolution des Spätmittelalters“ standen.99 Wie bei der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts erweist sich auch hier, daß erst Entwicklungen der agrarischen Produktion die Voraussetzungen geschaffen hatten.
Weit sind wir scheinbar von unserem Thema abgekommen. Die Geschichte der Mühle und des Müllers lud zu diesem Umweg geradezu ein, erweist sich doch, welche Folgen die Geschichte der Ernährung haben kann. Wenn wir zur Hauptstraße zurückkehren, werden wir belehrt werden, daß Korn nicht unbedingt zu Brot verarbeitet werden muß. Das ist heutzutage zwar auch bei den Frühstücksbuffets der Hotellerie oder in Reformhäusern zu erfahren, aber die Bedeutung, die in früheren Jahrhunderten der Brei gehabt hat, ist kaum noch bekannt.100