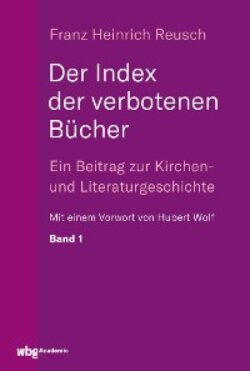Читать книгу Der Index der verbotenen Bücher. Bd.1 - Franz Reusch - Страница 21
1. Einleitung.
ОглавлениеIm J. 1559 unter Paul IV. erschien zu Rom ein „Verzeichniss von Schriftstellern und Büchern, — Index autorum et librorum, — vor denen die Römische und allgemeine Inquisition unter Androhung von Censuren und Strafen allen Christen sich zu hüten gebietet.“ Das Verzeichniss ist alphabetisch geordnet, aber so dass bei den einzelnen Buchstaben zuerst die Schriftsteller verzeichnet werden, deren sämmtliche Werke als verboten angesehen werden sollten, — seitdem gewöhnlich Auctores primae classis genannt, — dann einzelne mit den Namen ihrer Verfasser erschienene, zuletzt anonyme Schriften. Von einer Commission des Trienter Concils wurde in den Jahren 1562–63 dieser Index überarbeitet und zehn allgemeine Verordnungen über Bücherwesen, die sog. Regulae Indicis, beigefügt. Dieser neue Index, gewöhnlich der Trienter genannt, wurde als Index librorum prohibitorum 1564 von Pius IV. publicirt. Eine bedeutend vermehrte und theilweise modificirte Ausgabe desselben wurde 1590 unter Sixtus V. gedruckt, nach dem Tode des Papstes (27. Aug. 1590) aber unterdrückt und 1596 unter Clemens VIII. durch eine andere ersetzt, in welcher der Index Pius’ IV. unverändert reproducirt, aber den drei Classen desselben bei den einzelnen Buchstaben eine Appendix beigefügt wurde, deren Inhalt grösstentheils aus dem Index Sixtus’ V. entnommen ist.
Seitdem sind zu Rom von Zeit zu Zeit neue Ausgaben publicirt worden, — im Ganzen etwa 40, — in welchen die mittlerweile durch päpstliche oder Decrete der Index-Congregation, der Inquisition oder anderer Congregationen verbotenen Bücher beigefügt wurden. Unter diesen späteren Ausgaben sind besonders bemerkenswerth die von Alexander VII. 1664 publicirte, in welcher die drei Classen in ein einziges Alphabet vereinigt wurden, — eine Einrichtung, welche in allen folgenden Ausgaben beibehalten wurde, — und die von Benedict XIV. vom J. 1758, in welcher die zahllosen Fehler und Ungenauigkeiten der früheren Ausgaben grossentheils verbessert und neue allgemeine Verordnungen über das Bücherwesen beigefügt wurden.
Ausserhalb Roms erschienen mehrere Abdrücke des Index Pius’ IV., einige derselben mit selbständigen Vermehrungen. Von letzteren sind besonders die zu Antwerpen 1570, zu Lissabon 1581 und zu München 1582 erschienenen Ausgaben zu nennen, deren Zusätze grösstentheils von Sixtus V. und Clemens VIII. in den Römischen Index aufgenommen wurden. Die nach der Publication des Index Clemens’ VIII. ausserhalb Roms erschienenen Ausgaben, deren Zahl hundert übersteigt, sind mit wenigen Ausnahmen einfache Abdrücke der Römischen Ausgaben.
Unabhängig von den Römischen Indices, wenn auch zum grossen Theile inhaltlich mit ihnen übereinstimmend, sind die von der spanischen Inquisition vom J. 1551 bis zum J. 1844 publicirten Indices. Die ersten und für die Vergleichung mit den Römischen Indices wichtigsten sind die von den Generalinquisitoren Valdés (1551 und 1559), Quiroga (1583) und Sandoval (1594) herausgegebenen; von den späteren ist der von Sotomayor (1640) der wichtigste. Eine ähnliche Stellung gegenüber den Römischen Indices, wie die spanischen, nimmt der portugiesische vom J. 1624 ein.
Vor dem ersten päpstlichen Index vom J. 1559 wurden mehrere Verzeichnisse von verbotenen Büchern, — nicht unter dem Namen Index, sondern Catalog, — ausserhalb Roms publicirt, namentlich von der Löwener Universität 1546, 1550 und 1558, von der Pariser Sorbonne 1544, 1547 und 1551, von dem päpstlichen Legaten Giovanni della Casa zu Venedig 1549, von dem Erzbischof Arcimboldi zu Mailand 1554 und von der Venetianischen Inquisition 1554. Kleinere Verzeichnisse von verbotenen Büchern kommen noch früher vor, namentlich in Belgien in Erlassen Karls V. und in England unter Heinrich VIII., einzelne Bücherverbote noch früher, auch schon in der Zeit vor der Reformation und vor der Erfindung der Buchdruckerkunst bis in das 4. Jahrhundert hinauf.
In dem Index Pius’ IV. und in den folgenden werden manche Bücher nicht unbedingt verboten, sondern mit Formeln wie „donec corrigatur“ oder dergleichen, d.h. der Gebrauch der Bücher wird gestattet unter der Bedingung, dass einzelne Stellen in den vorhandenen Ausgaben getilgt oder mit der Feder corrigirt, in neuen Abdrücken weggelassen oder modificirt, dass die Bücher, wie der technische Ausdruck lautet, expurgirt werden. Bücher, in denen die Expurgationen für mehr oder weniger viele Bücher angegeben werden, heissen, im Unterschiede von den Indices librorum prohibitorum oder prohibitorii, Indices expurgatorii. In Rom ist, abgesehen von Expurgationen einzelner Bücher, nur ein einziger Index expurgatorius erschienen, im J. 1607, von dem Magister Sacri Palatii Giovanni Maria da Brisighella (Brasichellensis) bearbeitet. Vorher erschien ein im Auftrage des Herzogs von Alba ausgearbeiteter Index expurgatorius zu Antwerpen 1571. Der spanische Generalinquisitor Quiroga liess seinem Index librorum prohibitorum vom J. 1583 im nächsten Jahre einen Index librorum expurgatorum folgen. Die späteren spanischen Indices heissen alle Index librorum prohibitorum et expurgatorum. Auch die beiden portugiesischen Indices sind beides.
Manche Schriftsteller, namentlich französische, nennen alle Indices, welche bedingte und unbedingte Bücherverbote enthalten, namentlich die Römischen Indices librorum prohibitorum, im Gegensatze zu anderen Indices, z.B. bibliographischen Bücherverzeichnissen, Index expurgatorius. Der gewöhnliche und richtige Sprachgebrach ist aber, diesen Namen auf die Indices librorum (prohibitorum et) expurgatorum zu beschränken und also die Römischen Indices mit Ausnahme des von Brisighella und die ihnen ähnlichen Index librorum prohibitorum oder kurzweg Index zu nennen.
Es gibt viele Bücher, welche von den kirchlichen Bücherverboten überhaupt und speciell von den Indices handeln, meist im polemischen oder apologetischen Interesse. Die umfangreichsten und bedeutendsten darunter sind die von dem italienischen Jesuiten Francescantonio Zaccaria zu Rom 1777 veröffentlichte „Storia polemica delle proibizioni de’ libri“, und das Buch des anglicanischen Geistlichen Joseph Mendham: „The Literary Policy of the Church of Rome exhibited in an account of her damnatory Catalogues or Indexes, both prohibitory and expurgatory“, London 1826, 2. Auflage 1830.
In dem Buche von Zaccaria ist die Polemik gegen die Tadler der kirchlichen, speciell der Römischen Bücherverbote das Vorwiegende; die geschichtliche Darstellung ist bezüglich der ältern Zeit am eingehendsten, bezüglich der Indices vielfach lückenhaft. Mendhams Buch ist hinsichtlich der Bibliographie der Indices fast vollständig und durchgängig zuverlässig: er hat die meisten wichtigen Indices selbst in Händen gehabt und beschreibt sie im allgemeinen genau und in guter übersichtlicher Ordnung. Aber neben dieser äussern Geschichte der Indices tritt die innere, das Eingehen auf den Inhalt derselben und die Charakteristik der verbotenen Bücher, sehr zurück. Und doch ist dieses, freilich der schwierigere, aber auch der wichtigere und interessantere Theil der Aufgabe einer Geschichte des Index. Es ist zwar eine starke Uebertreibung und Einseitigkeit, wenn Thomas James1) meint, man könne aus den Indices die werthvollen Bücher kennen lernen; aber das darf man sagen: sehr viele in den Indices stehenden Bücher gehören zu den in irgend einer Hinsicht, und grösstentheils nicht bloss wegen ihrer Seltenheit interessanten Büchern, und eine Geschichte des Index, welche auch auf den Inhalt desselben eingeht, liefert einen nicht unbedeutenden Beitrag zur Literaturgeschichte, und zwar nicht bloss, wenn auch vorwiegend zur theologischen Literaturgeschichte.
Was die protestantisch - theologische Literatur betrifft, so bestimmt zwar die zweite Regel des sog. Trienter Index, die noch heute in Kraft ist, dass alle Schriften von häretischen Verfassern, welche ex professo über religiöse Dinge handeln, selbst wenn sie nicht ausdrücklich im Index stehen, verboten sind, und die Geschichte des Index hat in dieser IIinsicht nur zu zeigen, mit welcher Consequenz oder vielmehr mit welcher Inconsequenz und Ungeschicklichkeit diese Regel von den Herausgebern der Indices durchgeführt worden ist. Es sind aber von Anfang an nicht nur auch viele Schriften von häretischen Verfassern, welche nicht ex professo über religiöse Dinge handeln, sondern auch viele Schriften von katholischen Verfassern in den Index gesetzt worden, und seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts tritt das Verbieten von protestantisch-theologischen Schriften gegenüber dem Verbieten von Schriften der beiden genannten Kategorieen in den Hintergrund und greift die Index-Congregation, theils durch die von ihr selbst ausgehenden Verbote, theils durch das Einregistriren der von den Päpsten oder von der Inquisition erlassenen Verbote, in die zahlreichen und wichtigen, die Lehre und die Verfassung der katholischen Kirche und ihr Verhältniss zu den anderen Confessionen und zur Staatsgewalt betreffenden Streitigkeiten innerhalb der katholischen Kirche mächtig ein, so dass sich die Geschichte des Index seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts zu einer Geschichte dieser Streitigkeiten, so weit sie sich in der Literatur abspiegeln, gestaltet.
Es übersteigt freilich die Kräfte Eines Mannes, alle im Index, auch nur alle im Römischen Index stehenden Bücher zu charakterisiren; es ist schon unmöglich, sie alle zu Gesicht zu bekommen, auch nicht wohl für einen einzelnen möglich, alle zugänglichen auch nur zu durchblättern. Aber das ist möglich, — und das ist der mühevollste Theil meiner Jahre langen Vorarbeiten gewesen, — auf Grund eigener Anschauung oder zuverlässiger Berichte, — letzterer gibt es viele, aber sie finden sich in vielen Büchern, oft an schwer auffindbaren Stellen zerstreut, — die wichtigsten im Index stehenden Bücher und eine erkleckliche Anzahl der an sich weniger wichtigen, theilweise an sich ganz unbedeutenden, genau genug kennen zu lernen, um die Gesichtspunkte angeben zu können, welche bei den Verboten massgebend gewesen sind, und die sonstige Literatur vollständig genug kennen zu lernen, um nachweisen zu können, welchen Einfluss die Verbote auf die Entwicklung derselben geübt haben, ein Einfluss, der bedeutender gewesen ist, als man ohne eine specielle Kenntniss der Geschichte des Index anzunehmen geneigt sein dürfte.
In der Geschichte des Index sind nach dem Gesagten zwei Hauptperioden zu unterscheiden: in der ersten, die bis zur Vollendung des sog. Trienter Index mit seinen Appendices, also bis zum Ende des 16. Jahrhunderts geht, tritt die Bekämpfung der Reformation in den Vordergrund; in der zweiten handelt es sich vorwiegend um die innerkirchlichen Bewegungen. In dieser zweiten Periode bildet der Index Benedicts XIV. vom J. 1758 einen Incidenzpunkt.
Wenn es sich in einer Geschichte des Index auch vorzugsweise um den Römischen Index handelt, so ist doch namentlich in der ersten Periode eine eingehendere Besprechung der ausserhalb Roms erschienenen Indices schon darum nicht zu umgehen, weil manche von diesen auf die Gestaltung des Römischen einen bedeutenden Einfluss geübt haben. Es wird sich zeigen, dass die Römischen Indices des 16. Jahrhunderts ihrem Hauptinhalte nach nur Compilationen, theilweise recht ungeschickte Compilationen anderer Indices sind. So wird die Frage, warum ein Buch im Römischen Index stehe, vielfach durch die andere Frage ersetzt werden müssen, warum es in einem Löwener oder einem spanischen oder einem andern Index stehe, aus welchem die Compilatoren des Römischen den Titel abgeschrieben; ja in manchen Fällen wird sich nur durch ein Zurückgehen auf die von diesen Compilatoren benutzten Quellen die Frage beantworten lassen, welches Buch denn eigentlich gemeint sei.
Ein Zurückgehen auf die Quellen und Hülfsmittel, die bei der Ausarbeitung der Römischen und der ihnen zu Grunde liegenden Indices benutzt wurden, wird denn auch das anscheinend so schwierige Problem, welches die mehr als tausend Namen enthaltende erste Klasse des Römischen Index darbietet, sehr vereinfachen. Der grösste Theil dieser vielen Namen steht einfach darum in der ersten Classe, weil nicht gerade alle, aber doch die meisten Leute — Männer darf ich nicht sagen, denn es sind auch ein paar Frauen darunter, — in die erste Classe eingereiht worden sind, die in den verschiedenen Ausgaben des grossen bibliographischen Werkes von Conrad Gesner oder in Frankfurter Messkatalogen als protestantische Schriftsteller, vielfach nur als Verfasser einiger Predigten, einer Dissertation oder einer andern ephemeren Production, verzeichnet sind oder verzeichnet zu sein schienen; denn es ist auch nicht ausgeblieben, dass man einige sehr eifrige Katholiken, durch missverständliche bibliographische Angaben irregeführt, in die 1. Classe gesetzt hat, wo sie — was schärfern Tadel verdient — noch jetzt zu finden sind.
Auch ein Theil der in der 2. und 3. Classe stehenden Büchertitel ist, wie sich nachweisen lässt, mechanisch aus Gesner, den Messkatalogen u.dgl. abgeschrieben; das gilt aber bei diesen Classen nur von der Minderzahl.
Seit dem Erscheinen des Index Clemens’ VIII. im J. 1596 ist die 1. Classe im Römischen Index nicht weiter vermehrt worden (anders ist es bei dem spanischen Index) und hat man sich im allgemeinen auf das Verbieten bestimmter einzelner Schriften beschränkt. Darum findet das eben über die Quellen des Index Gesagte auf die zweite Periode keine Anwendung.
Da die Trienter Regeln einen integrirenden Theil des Römischen Index bilden, so wird auch über die in ihnen enthaltenen, im wesentlichen wenigstens in der Theorie noch jetzt in der katholischen Kirche zu Recht bestehenden allgemeinen Bestimmungen über das Bücherwesen und über die allmähliche Entstehung und theilweise spätere Modification dieser Bestimmungen eingehend zu handeln und nebenbei auch über die im 16. Jahrhundert darüber erlassenen staatlichen Verordnungen und über das Verfahren in protestantischen Kreisen zu handeln sein.
Dass ich meine Darstellung nicht erst mit der Reformation oder der Erfindung der Buchdruckerkunst beginne, hat seinen guten Grund. Die mittelalterlichen Bücherverbote sind grösstentheils auch dem Index einverleibt worden und darum in einer Geschichte des Index nicht zu umgehen, und die Bücherverbote der alten Kirche lassen sich auf so wenigen Blättern behandeln, dass ich diesen Abschnitt schon der Vollständigkeit halber beifügen zu müssen glaube; er ist aber darum auch interessant, weil er zeigt, wie weit man in der spätern Zeit von der Praxis der alten Kirche abgewichen ist.
1) Index Generalis Librorum prohibitoruram a Pontificiis una cum Editionibus expurgatis vel expurgandis juxta seriem literarum et triplicem classem. In usum Bibliothecae Bodleianae, et Curatoribus ejusdem specialiter designatus. Per Tho. James, S. Theol. D. … Oxoniae 1627. — James sagt in der Vorrede, sein Buch solle den Gelehrten, speciell den Curatoren der Bodleyanischen Bibliothek ans Herz legen, die im Index stehenden Bücher und Ausgaben zu beachten, aufzubewahren und vorkommenden Falls anzuschaffen, da die Bücher durchgängig werthvoll, namentlich aber die (nicht expurgirten) Ausgaben werthvoller seien als die späteren (expurgirten). — Speciell von den Indices expurgatorii sagt der anglicanische Bischof Barlow: „Es sind sehr gute Nachschlagebücher, mit deren Hülfe wir leicht finden können, was die darin verzeichneten Schriftsteller den Papisten Unangenehmes gesagt haben. Man braucht nur einen solchen Index nachzuschlagen, um die Stellen nach Buch, Capitel und Zeile angegeben zu finden, wo gegen irgend einen Irrthum oder Aberglauben Roms gesprochen wird, so dass derjenige, welcher solche Indices besitzt, wenn er nicht faul oder unwissend ist, um Zeugnisse gegen Rom nicht in Verlegenheit sein kann“. Mendham p. 5.