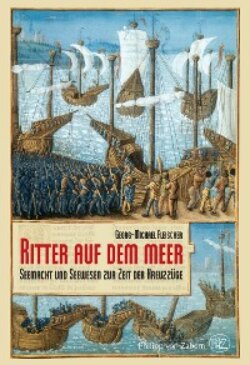Читать книгу Ritter auf dem Meer - Georg-Michael Fleischer - Страница 10
Klima und Winde
ОглавлениеBei allen diesen Unterschieden der Lebensräume, die das Mittelmeer in den unterschiedlichen und teilweise weit auseinanderliegenden Regionen zu bieten hat, eint sie alle eine, schon buchstäblich gewordene Gemeinsamkeit – das Klima. Wenn wir von einem „mediterranen Klima“ sprechen, sind damit warme trockene Sommer und niederschlagsreiche, relativ milde Winter gemeint. Es ist das Produkt eines immerwährenden Kampfes zweier gigantischer Klimakonstellationen um die Vorherrschaft in dieser Region, wie sie gegensätzlicher kaum sein können. Riesige Tiefdruckgebiete sammeln sich im Winter über dem Atlantik und gelangen, beladen mit Feuchtigkeit, Welle auf Welle in östlicher Richtung über das Mittelmeer. Die Temperatur fällt, heftige Stürme wühlen das Wasser auf und tiefhängende Wolken treiben in Fetzen über die See. Wenn sich die winterlichen Einflüsse abschwächen, gewinnt die brennendheiße und trockene, von Süden her einströmende Saharaluft die Oberhand und verwandelt das ganze Mittelmeer in eine paradiesische Welt, die nahezu sprichwörtlich mit dem Begriff der Subtropen verbunden ist. Allerdings dürstet das Land rings um das Meer, je länger der Sommer dauert, nach Wasser und je weiter man nach Osten kommt, desto schmerzlicher ist die Trockenheit. Mit den ersten Schlechtwetterperioden ab Mitte Oktober, die den Regen bringen, schließt sich der Wetterkreislauf, der seit Jahrtausenden die Landschaften und das Meer charakterisiert.
In einer Zeit, in der das Segel die Hauptantriebskraft der Schiffe darstellte, waren die aus dieser Großwetterlage resultierenden Windverhältnisse von größter Bedeutung für die Schifffahrt. Einige typische Windkonstellationen machten seit alters her das Mittelmeer zu einem nicht ungefährlichen Meeresteil für die Schifffahrt. Vielleicht der bekannteste Wind, den die Seefahrer auch schon im Mittelalter fürchteten, war der Mistral: Geboren aus einem Hochdruckgebiet über der Biskaya und einem Tief im Golf von Genua, entstand ein Luftdruckunterschied von mehr als 15 hp und es floß nördliche Polarluft durch das Rhone-Becken nach Süden. Pyrenäen und Alpen wirkten wie eine Düse, die eine Beschleunigung der Luftmassen veranlasste, so entstanden, oft am Vormittag, ganz plötzlich hereinbrechende hohe Windgeschwindigkeiten, die insbesondere Schiffen unter Segeln äußerst gefährlich werden können. Aus einer ähnlichen klimatischen Situation entwickelte sich die Bora, die schon immer in der Adria für die Seefahrt bedrohlich war und ebenso plötzlich von Osten her über die See hereinbrach. Sie konnte mit Frost und Schneestürmen einhergehen und in den Böen schwere Sturmstärken erreichen, wenn die sehr kalte Kontinentalluft aus den Karsttälern Kroatiens als Fallwinde die Adria erreichten. Von den ersten Anzeichen bis zum Eintreffen der orkanartigen Stürme blieben den Seeleuten oftmals weniger als 30 Minuten, um einen schützenden Hafen zu erreichen oder wenigstens die Segel zu reffen.
Weniger dramatisch, ja sogar als angenehmer Schönwetterwind aus nördlichen Richtungen, durchwehte der Meltemi in den Sommermonaten von Juni bis September die Ägäis, konnte allerdings auch über mehrere Tage ziemlich gleichmäßig bis zu acht Windstärken nach Beaufort (Bft.) erreichen. Die typische Wetterlage war ein stabiles Hoch über dem Balkan und ein beständiges Hitzetief über Zentral-Anatolien, an deren Rändern diese Winde (die von den alten Griechen Etesien genannt wurden) heiteres Wetter und gute, klare Sicht mit sich brachten. Ebenfalls ein warmer, nicht selten sehr heißer Wind kam von den Tiefdruckgebieten über der Sahara und wehte ziemlich beständig in nördlicher Richtung – der Schirokko. Da er recht gleichmäßig bläst und sehr selten Sturmstärke erreicht, war er für die Segelschifffahrt weniger gefährlich und schaffte durch sein Auftreten vom Frühjahr bis zum Herbst in dieser Zeit stabile Bedingungen. Im südlichen Mittelmeer brachte er sehr trockene und staubhaltige Luft mit, die sich jedoch bei längerem Weg über das Meer (nach Sizilien, Süditalien, Golfe du Lion) mit Feuchtigkeit aufladen konnte und damit für diesige und feucht-schwüle Verhältnisse sorgte (feuchter Schirokko), die von den Menschen als unangenehm empfunden wurden.
Es wird später noch darzustellen sein, dass die mediterrane Schifffahrt mit den hölzernen Galeerenflotten im Winter weitgehend eingestellt wurde und es zeigte sich auch in der historischen Betrachtung, dass die Missachtung der klimatischen Gegebenheiten, insbesondere durch die arabische Flottentaktik, zu schweren Verlusten, teilweise zum Verlust ganzer Geschwader führte. So scheiterte am 24. September 958 die gesamte fatimidische Flotte nach Einfällen in Kalabrien auf dem Rückweg nach Palermo kurz vor dem Ziel in einem schweren Sturm. Aber auch die damals noch wenig seeerfahrenen Römer verloren schon 255 v. Chr. auf der Rückfahrt von Afrika nach einem großartigen Sieg über die punische Flotte in einem schweren Sturm etwa 300 Schlachtschiffe mit mehr als 100 000 Mann Besatzung – einer der schwersten Schiffbrüche in der Geschichte der Seefahrt.
Die vorherrschen Windrichtungen im Mittelmeer während der bevorzugten Passagezeiten und die wichtigsten periodisch einfallenden Winde
Die oben dargestellte Großwetterlage stellte sich am Umschlag vom Sommer in den Herbst besonders dramatisch dar, weil eine aus unseren Breiten bekannte milde Spätsommerperiode fast vollständig fehlte; kamen die Galeerenflotten von ihren Expeditionen nicht rechtzeitig in die Häfen, gingen ganze Flottenabteilungen verlustig. Bereits zwischen dem 15. und 20. September traten die ersten heftigen, aus westlicher Richtung kommenden Luftströmungen auf. Der seit Jahrhunderten etablierten Seefahrernation Byzanz, vor allen ihren Kapitänen, waren – im Gegensatz zu den arabischen Seeleuten – die verschiedenen Wetter- und Klimawechsel durch zahllose Überlieferungen wohlbekannt, daher waren deren Verluste deutlich geringer. Das was man Jahrhunderte später als gute Seemannschaft bezeichnete, vielleicht auch die besseren Schiffe, erlaubten den byzantinischen Seeleuten, ähnlich wie später den Venezianern und Genuesen, auch unter ungünstigen klimatischen Bedingungen in See zu stechen. Ein Admiral der Kibyrrhaioten formulierte das so:
„Es gibt keine anderen Sterne, auf die der Seemann acht gibt (gewisse maritime Gefahrenperioden des Kalenders waren nach bestimmten Sternen benannt), und wirklich erfahrene Schiffleute beachten nicht einmal die oben genannten, sondern stechen in See, obschon das Meer stürmisch und das Wetter rauh, ja, am Tage des ungünstigen Sternes selbst.“4
Die große Hitze, die monatelang das Mittelmeer beherrschte, führte zur Verdunstung reichlicher Wassermengen, die durch die Zuflüsse aus den großen Strömen Nil, Po und Rhone und dem Zustrom aus dem Schwarzen Meer nicht gedeckt werden konnten. Die entscheidende Wasserzufuhr erfolgte aus dem Atlantischen Ozean, dadurch entstand eine ständige, wenn auch nicht ganz gleichmäßige Strömung, die es den Schiffen entscheidend erleichtert hat, mit Hilfe von Segel und Ruder das ganze Mittelmeer zu umfahren. Von Gibraltar verliefen die Strömungen entlang der nordafrikanischen Küste bis zur Levante5, wendeten sich nach Norden und umkreisten Zypern, die Ägäis und die Adria, gelangten durch die Straße von Messina (Scylla und Charybdis der alten Griechen), wo sie gefährliche Geschwindigkeiten erreichten, ins Tyrrhenische Meer und kehrten an den Küsten Frankreichs und Spaniens zurück zum Atlantik. So reichte der Tidenhub von 20 bis 40 Zentimetern zwischen dem Ionischen und Tyrrhenischen Meer, der im Abstand von sechs Stunden auftrat, um in der weniger als drei Kilometer breiten Straße von Messina die Strömung um fünf Knoten zu beschleunigen. Mit Unterstützung der Strömungen gelang es schon in alten Zeiten sogar gegen den Wind zu segeln.6 Als Gefahren für die Schifffahrt spielten allerdings Strömungen, ebenso wie die Gezeiten, im Mittelmeer keine gravierende Rolle.