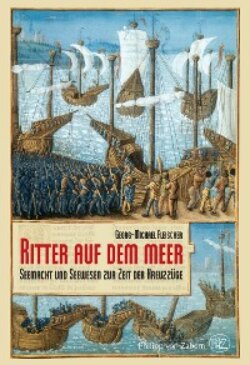Читать книгу Ritter auf dem Meer - Georg-Michael Fleischer - Страница 19
Geißel der Meere – die Piraten
Оглавление„Was ist dein Beruf? Fährst du zur See in Geschäften deines Landes oder bist du einer jener kühnen Seeräuber, die Entsetzen bis an die fernsten Gestade tragen?“
fragt der Kyklop den Odysseus. Bereits vor 3000 Jahren war die Seeräuberei, diesem Ausspruch Homers zufolge, ein bekanntes und vielleicht sogar ein ehrenhaftes Gewerbe, sicher gehen die Wurzeln noch weiter zurück. Der Reichtum der Anliegerstaaten des Mittelmeers lockte zum Seeraub, die stark gegliederten Küsten und Inseln boten unzählige Verstecke. Vor allem blühte die Piraterie in der unmittelbaren Umgebung viel befahrener Seewege und buchtenreicher Durchfahrten, wie beispielsweise der Meerengen von Sizilien, im Tyrrhenischen Meer und den zahlreichen griechischen und dalmatinischen Inseln.
Dabei hatten es die antiken Piraten relativ leicht, um zu ihrer Beute zu gelangen. Da sich die Schifffahrt vorwiegend in Küstennähe abspielte, mussten sie nur hinter einer Landzunge oder Insel in Lauerstellung gehen und dann blitzschnell ihre Beute ergreifen. Die Jagd auf Handelsschiffe war aber nur ein Teil der Piraterie, der zudem noch unsicher und gefährlich war. Viel einträglicher und erfolgssicherer war ein anderer Erwerbszweig – der Küstenraub. Ungeschützt lagen im Altertum die Küstenorte und Hafenstädte, eine Einladung geradezu für die kühnen Räuber, sich der Besitztümer, vor allem aber der Bewohner zu bemächtigen. Der Sklavenhandel war zudem wesentlich einträglicher, da hierfür immer sichere Absatzmärkte zur Verfügung standen; eine Tatsache, an der sich über viele Jahrhunderte bis hinein in die Neuzeit wenig änderte. Durch Menschenraub wurden ganze Küstenstriche verödet, an denen die Römer später gefangene Piraten als Bauern wieder ansiedelten. Das galt gesellschaftlich durchaus nicht als verwerflich und von manchen Herrschern wurden ganze Piratenflotten zur Kriegsführung und Unterstützung der kriegerische Seeoperationen angeheuert, die natürlich auch mit der Aussicht auf einträgliche Beute, seien es Waren oder Sklaven, angelockt wurden.82 Verlust durch Piraterie galt als alltägliches Risiko für Kapitäne, Passagiere, Schiffseigner und Geldverleiher. Seeversicherungen wurden in Kaufmannskreisen erst Anfang des 14. Jahrhundert aus Italien bekannt (s. S. 134 ff.), bis dahin waren Verluste an Menschen und Besitztümern bis auf wenige Ausnahmen, in denen Lösegeld gefordert wurde, meistens endgültig.
Heroisiert wurde in der griechischen Sagenwelt der Raubzug der Griechen in das ferne Kolchis am Schwarzen Meer mit ihrem Schiff „Argo“, um das Goldene Vlies zu erobern. In späteren Jahrhunderten entstanden an den kleinasiatischen und nordafrikanischen Küsten mächtige Seeräuberstaaten, die zeitweilig den gesamten Seeverkehr der Region beherrschten. Im westlichen Mittelmeer waren es ab der Mitte des 2. vorchristlichen Jahrhunderts vor allem die etruskischen Seeräuber, die am meisten gefürchtet waren; der Osten wurde von den Liburnern, einem illyrischen Stamm aus Dalmatien, bedroht. Dieser Name ging in die Seefahrtsgeschichte ein: Die von ihnen benutzten sehr schnellen und leichten Ruderkriegsschiffe dienten als Vorlage der Liburne, die die Römer als Standardtyp in ihre Kriegsflotte übernahmen. Offenbar waren es die im gleichen Jahr erfolgten Zerstörungen von Karthago und Korinth (146 v. Chr.), die einen gewaltigen Aufschwung der Piraterie ermöglichten, da einerseits die Kontrolle der Seewege durch die beiden Städte wegfiel und andererseits eine Menge seeerfahrener Männer nach einem anderen Betätigungsfeld suchen mussten. Nach dem Sieg der Römer über die Flotte des Mithridates (ca. 63 v. Chr.) kamen kampferfahrene Seeleute hinzu, die sich in Kilikien festsetzten und einen Seeräuberstaat errichteten, der zu einem gewaltigen Machtfaktor wurde. Von hier aus kamen vielfältige Kriegsoperationen mit ausgedehnten Plünderungen der Mittelmeerküsten zustande – selbst Roms Hafen Ostia wurde verwüstet und dort liegende Handels- und Kriegsschiffe verbrannt.
Viel schlimmer traf die Römer allerdings eine andere Folge der Seeräuberei: Das Brot wurde teuer! Die Getreidelieferungen aus den Kornkammern des Römischen Reichs – Sizilien, Sardinien und Afrika – blieben infolge der andauernden Beherrschung der Seewege durch die Piraten aus. Etwa im Jahre 70 v. Chr. besaßen sie mit 1000 Schiffen, zahlreichen Häfen und im Taurus-Gebirge gelegenen Burgen wohl die größte Machtfülle. Rom brauchte sein ganzes Machtpotential und seine besten Strategen, um die Seemacht wieder zurückzugewinnen: Gnaeus Pompeius (* 106, † 48 v. Chr.) standen 500 Schiffe, 5 000 Reiter, ein Heer von 12 000 Mann und unbeschränkte Vollmachten zur Verfügung. Diese Kräfte setzte er im Jahr 67 v. Chr. mit strategischem Geschick zunächst gegen die Piratenflotten, später gegen ihre Stützpunkte ein und konnte so die Seeräuberplage innerhalb weniger Monate für einige Jahrzehnte aus dem Mittelmeer bannen.83 Die gefangenen Piraten wurden von Gnaeus Pompeius mild behandelt und an den Küsten des östlichen Mittelmeers angesiedelt. Aus maritim-historischer Sicht hatte Pompeius allerdings mehr vollbracht als einen Sieg über die Piraten: Die neu aufgestellten Flottenverbände waren der Kern der kommenden großen Seemacht des Imperiums, die das Mittelmeer zu einem römischen Binnensee machen sollte.
Pikanterweise spielte der zweite Sohn des Piratenbezwingers, Sextus Pompeius, in der Seeräubergeschichte eine ebenfalls beherrschende Rolle – allerdings auf der anderen Seite. Nach der Ermordung Caesars wurde er Kommandant der römischen Flotte und sollte die Piraten in Zaum halten. Genau das Gegenteil unternahm er: Mit dem von seinem Vater angesiedelten ehemaligen Piraten, deren Söhnen und zugelaufenen Sklaven aus dem Römischen Reich, schuf er eine mächtige Flotte, mit der er Sizilien, Sardinien und Korsika eroberte und die Seewege nach Rom blockierte. Rom war zunächst gezwungen eine Art Nichtangriffspakt zu schließen, konnte aber 36 v. Chr. unter dem Feldherrn Agrippa die Piratenflotte vernichtend schlagen – der letzte große Piratenführer der Antike wurde von Marcus Antonius in Milet getötet. Danach gab es kleinere Piraterien, die nie ganz ausgestorben waren, im Großen und Ganzen aber herrschte über mehrere Jahrhunderte die römische „Pax maritima“.
Einige Jahrhunderte später machten die Vandalen im Mittelmeer von sich reden, ein germanischer Volksstamm, der im Zuge der Völkerwanderung aus dem Osten des heutigen Deutschlands und Polens kommend, im Jahre 411 Südspanien erreichte. Unter ihrem gewählten König Geiserich, der Schiffe nach römischem Vorbild bauen ließ, setzte der gesamte Stamm – man schätzte 80 000 Menschen mit Tieren und ihrem gesamtem Hab und Gut – bei Gibraltar nach Nordafrika über. Sie eroberten Nordafrika und machten das ehemalige Karthago zu ihrem Hauptsitz. Von hier aus wurden Sizilien, Sardinien und Korsika erobert und 455 n. Chr. Rom gestürmt und 14 Tage geplündert. Da auch kirchliche Kulturgüter geraubt wurden, entstand der Begriff des Vandalismus für sinnlose Zerstörung (erstmalig 1794 in Frankreich gebraucht). Das Vandalenreich wurde 534 von Byzanz, unter dem berühmten Feldherrn Belisar erobert und verschwand damit aus der Geschichte.
Seit Beginn der muslimischen Expansion im Mittelmeerraum sorgte der fortwährende Gegensatz zum Christentum für eine ständige Motivation zur Piraterie, zumindest verursachte er eine permanente ideologische Konfrontation. Genährt wurde diese Ideologie von christlicher Seite durch die Kreuzzüge, auf muslimischer Seite trug die Vorstellung des Djihad, des Heiligen Kriegs gegen die Ungläubigen, zur Professionalisierung des latenten Kriegszustands bei. Wahrscheinlich entstand hier auch der aus der lingua franca der Mittelmeerwelt stammende Begriff des Korsaren als Typ des professionellen Seeräubers.
Vom 7. bis 11. Jahrhundert beherrschten die Schiffe der islamisch-arabischen Kleinstaaten Nordafrikas und der Iberischen Halbinsel das Mittelmeer und suchten die angrenzenden Küstengebiete heim. Jagd gemacht wurde auf alles und jeden, die Seeräuber dehnten ihre Interessengebiete bis nach Italien aus. Es herrschte ein erbitterter Kleinkrieg zwischen den nordafrikanischen Piraten und den Flotten der oberitalienischen Seestädte, hier allen voran wiederum Venedig, Genua und Pisa. Der Zwang zur Abwehr der sarazenischen Angriffe im 11. Jahrhundert führte in Genua und Pisa zum ersten umfangreichen Flottenbau und wurde damit zur Basis der späteren Seemacht beider Städte.84 Diese gewannen ständig an Boden und eroberten bereits 1016 Sardinien zurück. Genua und Pisa konnten kurz darauf Korsika unter ihren Einfluss bringen, Pisa eroberte einen Brückenkopf in Nordafrika (Bono 1034) und im Bündnis mit den Normannen 1063 Palermo. Der erfolgreiche Kampf gegen die Piraten und die Erlangung der Seemacht im westlichen Mittelmeer waren Voraussetzungen dafür, die Expansionsbestrebungen zu den Häfen der östlichen Mittelmeerküste auszudehnen.
Aufgrund der ständigen Bedrohung durch die Piraterie jeglicher couleur waren auch die normalen Kauffahrteischiffe schon im 12. Jahrhundert häufig bewaffnet. Aus den mittelalterlichen Quellen geht nicht immer eindeutig hervor, ob es sich bei den beschriebenen Ereignissen um Handelsschifffahrt, Seekriegshandlungen oder Piraterie und bei den Seeräubern um Christen oder Sarazenen handelte.85 Bereits aus dem Jahr 1000 ist bekannt, dass der venezianische Doge Peter II. Orseolo mit einer starken Flotte slawische Piraten aus der Inselwelt Dalmatiens vertreiben musste, da diese die Handelsschifffahrt in der Adria erheblich behinderten.86
Es fällt schwer, nach den Berichten christlicher Pilger und abendländischer Reisender zu entscheiden, welcher Herkunft die jeweils attackierenden Piraten zuzuordnen waren, natürlich wurden die muslimischen zuerst als die Bösen beschrieben. Grundsätzlich aber waren alle seefahrenden Völker im Zeitalter der Kreuzzüge (und natürlich davor) an der Piraterie beteiligt. Die seebeherrschenden und handeltreibenden Nationen waren notwendigerweise darauf bedacht, die Seewege für ihre Handelsschiffe zu sichern, was sie aber keinesfalls davon abhielt, selbst zu kapern, was gerade ihre Route kreuzte. Sicher könnte man zwischen denjenigen unterscheiden, die ausschließlich von den Erträgen der Piraterie lebten und denen, die auf dem Weg einer normalem Handelsfahrt die Gelegenheiten zur Kaper nutzten, die sich ihnen boten. So waren es keineswegs nur Auseinandersetzungen zwischen sarazenischen Korsaren und christlichen Handelsflotten, sondern die verfeindeten christlichen Seemächte nahmen in Piratenmanier untereinander vom anderen, was ihnen vor den Bug kam. Andererseits nahmen sie auch die Dienste der Seeräuber zur Erreichung ihrer Ziele und Schädigung des jeweiligen Gegners in Anspruch – die moralischen Grenzen waren sehr variabel, obwohl sie alle das christliche Moralgefüge für sich in Anspruch nahmen. Ebenso wenig Skrupel bestanden darin, christliche Gefangene anderer verfeindeter Nationen in die Sklaverei auf muslimischen Sklavenmärkten zu verkaufen, versprach die Ware Mensch doch immer noch den höchsten Profit aller gehandelten Produkte.
Mit Beginn der Kreuzzüge rückte das östliche Mittelmeer sehr stark in den Blickpunkt des Interesses der seefahrenden Nationen. Die Schifffahrt von und nach den levantinischen Küsten und die Sicherheit dieser vielbefahrenen Seewege waren außerordentlich abhängig von den marinen Machtverhältnissen. Mit dem Rückgang der einst äußerst starken byzantinischen Flottenpräsenz durch die Sparmaßnahmen von Johannes II. Komnenos (* 1118, † 1143), nahmen die Aktivitäten christlicher Korsaren in den byzantinischen Reichsgewässern bereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts wieder stark zu. Waren es bis dahin einzelne Piraten oder kleinere Gruppen von Seeräubern, die eine überschaubare Bedrohung der Schifffahrtsrouten bedeuteten, traten durch die Konflikte der italienischen Seerepubliken, die ihre Gegensätze mehr und mehr auch in der Levante austrugen, immer größere Verluste in den Handelsflotten auf, da die verfeindeten Staaten die Korsaren in ihre Dienste nahmen. Die Geschwader der verfeindeten Seemächte kaperten und plünderten die Handelsschiffe des jeweiligen Gegners, als ob es echte Piratenflotten wären, so dass es kaum möglich war, zwischen regulären Kriegshandlungen in der Seekriegsführung, insbesondere zwischen Genua, Pisa und Venedig zu unterscheiden.87
Wie auf allen befahrenen Meeren und zu allen Zeiten, in denen zur See gefahren und Handel getrieben wurde, spielte auch im Hochmittelalter auf dem Mittelmeer die Piraterie eine gewichtige Rolle im Machtgefüge der Nationen. Besonders trat dies immer dann in Erscheinung und war als Machtfaktor von Bedeutung, wenn sich die Konfliktparteien der Berufspiraten bedienten, um damit ihre Flotten mit kampferprobten und schlagkräftigen Marineeinheiten zu verstärken. Diese Vorgehensweise wurde oben am Beispiel der Römer gezeigt, setzte sich im Mittelalter fort und kam später in der Seefahrtgeschichte, besonders in den Auseinandersetzungen im atlantischen Raum zwischen den Niederlanden, Spanien Frankreich und England im 16. bis 18. Jahrhundert, immer wieder zur Geltung.