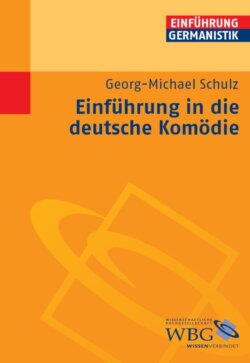Читать книгу Einführung in die deutsche Komödie - Georg-Michael Schulz - Страница 11
II. Forschungsbericht
ОглавлениеDie Poetik des Aristoteles
Schon die Poetik des Aristoteles schreibt den Dramatikern nicht willkürlich irgendwelche Regeln vor, sondern sichtet erst einmal die vorhandenen Dramen. Sie registriert dabei, dass es hinsichtlich der Anlage einer Handlung, der Gestaltung von Figuren usw. durchaus verschiedene Möglichkeiten gibt, die sie dann freilich teils als besser, teils als weniger gut bewertet. Auf dieser Grundlage gewinnt sie die Vorstellung einer Tragödienstruktur, die sie schließlich für musterhaft erklärt. Methodisch gesehen, bedeutet das: Sie verfährt sowohl empirisch-deskriptiv als auch normativ-regelsetzend. Und da das zweite Buch der Poetik, in dem es um die Komödie gehen sollte, nicht erhalten ist, gibt es hier für die Komödie wesentlich weniger Regelungen als für die Tragödie, was auch der Forschung im Fall der Komödie einen freieren Blick auf die zu beurteilenden Dramen-Texte und deren Vielfalt erlaubt hat als im Fall der Tragödie, bei der die Aristotelischen Vorgaben die Bewertung der zu betrachtenden Texte stärker reglementiert haben (Zimmermann 2006, 36).
Poetiken des Barock und der frühen Aufklärung
Was die sowohl empirisch-deskriptive als auch normativ-regelsetzende Einstellung betrifft, so gilt Entsprechendes wie für die Aristotelische Poetik auch für die Poetiken des Barock und der frühen Aufklärung, die, soweit sie sich auf das jeweils Vorhandene beziehen, so etwas wie Bestandsaufnahmen liefern. Johann Christoph Gottsched zum Beispiel reserviert in seiner Poetik (Critische Dichtkunst, 1730) ein Kapitel für die Komödie, behandelt darin im historischen Rückblick griechische, römische, italienische, englische, französische und deutsche Komödien, bevor er systematisch auf formale Aspekte eingeht. Hinsichtlich der deutschen Komödien beschränkt er sich auf das 17. Jahrhundert und gibt Hinweise – freilich im Umfang von nur einer Seite – zu Andreas Gryphius und Christian Weise. Was dabei die Verbindung von Komödientheorie und Komödienpraxis betrifft, so verfährt das Gros der späteren Forschung im Grunde nicht viel anders – der Forschung jedenfalls, die über die Beschäftigung nur mit einzelnen Texten oder einzelnen Autoren hinausgeht. Es gibt kaum eine Darstellung der Komödiengeschichte einer Epoche oder noch größerer Zeiträume, die nicht zugleich die entsprechende Komödientheorie einbezöge, und umgekehrt geht selbst eine Arbeit, die sich im Titel nur auf die „Komödiendiskussion von Aristoteles bis Ben Jonson“ bezieht (vgl. Bareiß 1982), regelmäßig dennoch zugleich auf die Komödienpraxis mit ein.
Neben den Poetiken gibt es im 18. Jahrhundert auch anders geartete und andere Zielsetzungen verfolgende umfangreichere Darstellungen, die sich mit der Literatur im Ganzen oder mit Teilbereichen beschäftigen (wie zum Beispiel Lessings Hamburgische Dramaturgie [1767–1769]) und die in diesem Rahmen die Gattung der Komödie ebenfalls unter theoretischen und historischen Aspekten behandeln. Dabei beziehen die Ausführungen sich zunehmend nicht mehr nur auf die formalen Seiten der Gattung bzw. ihre Wirkung („Belustigung“), sondern enthalten vermehrt auch Reflexionen über das Wesen der Komödie, und dies unter Einbeziehung auch psychologischer Gesichtspunkte.
Carl Friedrich Flögel
Derartige Darstellungen verfahren freilich – nicht anders als die Poetiken auch – mehr kritisch-wertend als nur referierend. Man könnte mit Bezug auf sie von Literaturkritik sprechen, nicht eigentlich von Vorläufern der Literaturwissenschaft bzw. der Literaturgeschichtsschreibung. Eine bemerkenswert frühe durchaus literaturgeschichtliche Darstellung ist dagegen Carl Friedrich Flögels (1729–1788) vierbändige Geschichte der komischen Literatur (1784–1787), die sich sowohl mit der komischen Literatur im Ganzen und der Gattung der Komödie als auch mit dem Komischen beschäftigt. Flögel liefert zunächst Überlegungen zum „Komischen oder Lächerlichen überhaupt“ und behandelt dann sehr breit die satirische Schreibweise quer durch verschiedene literarische Gattungen, beginnend bei den Griechen und Römern und endend – unter Einbeziehung verschiedener europäischer Völker – im 18. Jahrhundert. Separat und vergleichsweise knapper werden anschließend Eigenart und Geschichte speziell der Komödie behandelt, abermals von der Antike bis ins 18. Jahrhundert und sogar noch unter Einbeziehung verschiedener „ungebildeter“ Völker – von China über (unter anderem) Ägypten und Peru bis Sibirien. Ihren monumentalen Umfang von vier Bänden erreicht die Darstellung übrigens durch die Integration vieler Zitate.
Friedrich W. Ebeling
Von dieser außergewöhnlichen Darstellung hat knapp achtzig Jahre später Friedrich W. Ebeling im Jahr 1862 unter dem Titel Flögel’s Geschichte des Grotesk-Komischen eine Bearbeitung herausgegeben, die auf 500 Seiten den Flögelschen Text teils entschieden kürzt, teils aber auch hinsichtlich der behandelten Themen erheblich erweitert. Die Bearbeitung ist nämlich – mit einem Terminus von heute – kulturwissenschaftlich ausgerichtet (und darin ebenfalls außergewöhnlich), wie zudem etliche Illustrationen von der Antike bis zur Neuzeit verdeutlichen. Die Bearbeitung geht deutlich über die Literatur hinaus und untersucht das Komische auch in religiösen Bräuchen, in weltlichen Feiern (etwa die Zwischenspiele bei fürstlichen Gastmählern) und närrischen Geselligkeiten (z. B. in der Fastnacht), in Kunst und Musik, und zwar, über Flögel hinaus fortgeführt, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie enthält aber immerhin im ersten Abschnitt eine Geschichte der Komödie seit der Antike und liefert im Unterabschnitt über die deutsche Komödie einen Überblick über die Komödiengeschichte wiederum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, beginnend mit den Fastnachtspielen und konzentriert auf das Volkstheater sowie mit Interesse eher an der Theatergeschichte als an der Dramengeschichte.
Damit war Ebeling offenkundig noch nicht zufrieden; er hat nämlich seinerseits – mit Bezug nur auf die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts – 1869 unter eigenem Namen auf rund 1900 Seiten eine dreibändige Darstellung der komischen Literatur folgen lassen (mit etwa 90 Seiten über das Drama).
Hermann Reich
Abermals einen Hang zum Monumentalen (und zugleich eine Tendenz zum Manischen) bezeugt 1903 ein 900 Seiten umfassender erster (und einziger) Band Der Mimus von Hermann Reich, der alle „dramatische Poesie in der Welt“ auf griechische Ursprünge zurückführt (Reich 1974, 898), die „klassische“ Poesie ohnehin, aber auch diejenige, die nicht „klassisch oder klassizistisch ist“ und die im antiken Mimus ihre „Grundlage“ (Reich 1974, 896) habe. Die Arbeit bezieht – über die breit dargestellte Antike hinaus – den Orient, Indien und das europäische Mittelalter (mitsamt der Hofnarren) mit ein, um schließlich bei William Shakespeare und dessen Ausstrahlungen bis ins 18. Jahrhundert hinein zu landen.
Karl Holl
Nach einigen allgemeineren Darstellungen zur Komödie und zur Komödientheorie aus dem 19. Jahrhundert (vgl. Creizenach 1879, Altenhofer [Hrsg.] 1973) erscheint 1911 Karl Holls Geschichte der Lustspieltheorie, die zuerst Ansichten zum Komischen vorträgt, das Holl im überlegenen Humor gipfeln lässt, und die dann, beginnend mit Aristoteles, sechs Stationen der Komödientheorie erörtert, deren letzte, die Gottschedische, hervorgegangen „aus dem Nährboden des plattesten Rationalismus“, immerhin „der literarisch verwahrlosten Zeit“ eine praktische Orientierung vermittelt habe (Holl 1976, 107). Statt einer geplanten Fortführung dieser Darstellung schreibt Holl dann eine umfangreiche Geschichte des deutschen Lustspiels (1923), die die Komödientheorie integriert und tatsächlich die Komödiengeschichte vom Mittelalter bis zum beginnenden 20. Jahrhundert behandelt. Gleich eingangs versichert Holl, neben dem höheren Lustspiel, das vom Humor lebt, auch das niedere Lustspiel, den derberen Schwank, gelten lassen zu wollen. Aufgrund der Verbindung beider Arten (unter Mithilfe der Musik) erkennt Holl in Richard Wagners „Meistersingern“ einen „Höhepunkt deutscher Lustspielleistung“ (Holl 1964, 2).
Man könnte in Holls Lustspiel-Geschichte den Beginn der modernen Komödienforschung sehen, wenn man den Begriff der Moderne aus der Literaturgeschichte nun auch für die Forschungsgeschichte übernehmen wollte. Von einer kontinuierlichen Beschäftigung mit der Gattung der Komödie (über Einzelinterpretationen hinaus), die dieser Begriff zumindest suggeriert, kann aber nicht die Rede sein. Zwar bezeugen in den folgenden Jahrzehnten einzelne Forscher ihr Interesse an der Gattung (vgl. etwa Rommels Arbeiten aus den vierziger und fünfziger Jahren [1975a, 1975b, 1952]). Eine wirklich bemerkenswerte Erweiterung erfährt die Komödienforschung aber erst in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, und zwar eine Erweiterung, was die Arbeiten mit umfassenderem Anspruch betrifft, aber auch mit Bezug auf die Quantität derjenigen Arbeiten, die zu einzelnen Dramen oder einzelnen Autoren verfasst werden.
Helmut Prang
1968 erscheint Helmut Prangs übergreifende gattungsgeschichtliche Darstellung, eingeleitet durch Überlegungen zum „Begriff und Wesen des Lustspiels“. „Von der Antike bis zur Gegenwart“, d. h. bis zu Dürrenmatt reichend, behandelt sie die Geschichte der Komödie „in den Ländern unseres Kulturkreises“ (364). Im Wesentlichen bedeutet das – neben griechischen und römischen Komödien der Antike – englische, französische, italienische und spanische und in Bezug auf das 19. und das 20. Jahrhundert auch nordamerikanische, russische und polnische Komödien.
Eckehard Catholy
Konzentriert auf die deutsche Komödie liefert Eckehard Catholy – in Orientierung an den Epochen der deutschen Literaturgeschichte – 1969 und 1982 eine Darstellung der Gattungsgeschichte vom Mittelalter bis zur Romantik in zwei Bänden. Hinsichtlich des „spezifisch Lustspielhaften“ hält Catholy sich an eine „Anzahl von Strukturmerkmalen, die einerseits noch zeitlich weit voneinander entfernten Stücken gemeinsam, andererseits nur für Lustspiele kennzeichnend sind“ (Catholy 1969, 7).
Bernhard Greiner
Ebenfalls epochenübergreifend ist Bernhard Greiners umfangreiche Darstellung, erschienen 1992, die eine größere Zahl exemplarischer Einzelinterpretationen deutscher Komödien enthält und dazu in einem ausgedehnten ersten Abschnitt eine Grundlegung bietet mit der Einbeziehung auch der Antike, Shakespeares und Molières. In historischer Perspektive sieht Greiner die abendländische Komödie aus zwei Ursprüngen hervorgehen, einerseits aus dem Orgiastischen, Grenzensprengenden, Dionysisch-Karnevalistischen (Letzteres mit Berufung auf den russischen Theoretiker Michail Bachtin) aufgrund der Herkunft der Gattung aus dem Dionysos-Kult, andererseits aus dem Interesse der Dramatiker an der literarischen Organisation, deren ein Drama mit geordneter Handlung, konsistenten Figuren und geformter Rede bedarf (im Hintergrund dieser Deutung steht offensichtlich Friedrich Nietzsches Unterscheidung zwischen dem Dionysischen und dem Apollinischen).
Interpretations-Sammlungen
Epochenübergreifend, ohne dass eine einheitliche Perspektive vorgegeben wäre, sind schließlich Interpretations-Sammlungen von mehreren Verfassern zumeist mit einer Einleitung des Herausgebers, die immerhin auf prinzipiellere Aspekte zielt. Es liegt auf der Hand, dass diese Sammlungen repräsentativ sein wollen und daher den etablierten Kanon der „wichtigen“ Komödien eher bestätigen als in Frage stellen. Herausgegeben worden sind solche Sammlungen von Hans Steffen (1968 und 1969), Walter Hinck (1977), Herbert Mainusch, auf die europäische Komödie ausgedehnt (1990), und Winfried Freund (1995, zuerst 1988). Fritz Martini (1979, zuerst 1974) hat eine Sammlung eigener Interpretationen mit einer Einleitung „Überlegungen zur Poetik des Lustspiels“ zusammengestellt.
Einzelne Gattungen
Abermals epochenübergreifend, allerdings nicht mehr mit Bezug auf das Terrain der Komödie im Ganzen (oder doch auf repräsentative Teile dieses Terrains), sind Darstellungen, die einzelne Gattungen behandeln. Manche von ihnen wie zum Beispiel die Burleske oder die Humoreske oder das Schäferspiel (als Teil der Schäferdichtung) sind vergleichsweise selten in speziell ihnen gewidmeten Darstellungen untersucht worden. Dieser Befund müsste allerdings modifiziert werden, wenn man sich nicht nur auf Deutschland, sondern auf Europa im Ganzen bezöge. Dem Boulevardstück zum Beispiel sind in Deutschland nur erst wenige Darstellungen gewidmet worden, während es als Gattung in Frankreich und England durchaus anerkannt ist und auch ein größeres Interesse der Forschung gefunden hat. Deutlich mehr Beachtung, nun wiederum bezogen auf Deutschland, ist dagegen der Tragikomödie zuteil geworden, sei es dass der Gattungsbegriff auf seine unterschiedlichen Verwendungen hin untersucht worden ist, sei es dass die Tragikomödie als entschieden moderne Gattung verstanden worden ist (Guthke 1968). Auch das „bürgerliche Lachtheater“ (Klotz 1980), nämlich Posse, Schwank, Operette, hat die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen und dadurch eine Aufwertung erfahren. Das Fastnachtspiel und das Wiener Volkstheater (bzw. die dort gespielten Stücke) sind schließlich zwei Beispiele für tatsächlich vielfach untersuchte komische Untergattungen, für die sich zwar einzelne Forscher besonders engagiert haben (Eckehard Catholy für das Fastnachtspiel; zuerst Otto Rommel, später Jürgen Hein für das Wiener Volkstheater), die aber im Ganzen derart häufig thematisiert worden sind, dass ihnen sogar Einzelbände mit Forschungsüberblicken gewidmet worden sind (Catholy 1966 [Fastnachtspiel], Hein 1978 [Wiener Volkstheater], Schmitz 1990 [Volksstück überhaupt]). Besonders im Fall des Wiener Volkstheaters – das soll nicht verschwiegen werden – gingen dabei wichtige Impulse von der Theaterwissenschaft aus. Das gilt übrigens auch für die „komische Figur“, zu der es inzwischen eine wiederum vor allem auf Wien bezogene reichhaltige Forschung gibt (Csobádi 1994, Ernst 2003, Müller-Kampel 2003, mehrere Beiträge in Erdmann 2003).
Mit Bezug nicht eigentlich auf eine bestimmte Gattung, sondern eher pauschal auf die nicht-hochliterarischen Spielarten der Komödie sei erwähnt, dass die Entdeckung des russischen Theoretikers Michail Bachtin und seiner Beschäftigung mit der „karnevalistischen“ Volkskultur bedeutsame Impulse auch für die entsprechende Komödienforschung gebracht hat.
Historisch begrenztere Darstellungen
Wichtig für das Verständnis einzelner Ausschnitte der Komödiengeschichte sind Darstellungen, die bestimmte Spielarten der Komödie mit Bezug auf historisch begrenztere Zeiträume behandeln. Hervorzuheben sind hier insbesondere „Das deutsche Lustspiel des 17. und 18. Jahrhunderts und die italienische Komödie“ (1965) von Walter Hinck und „Die ernste Komödie. Das deutsche Lustspiel von Lessing bis Kleist“ (1968) von Helmut Arntzen. Anschließen lassen sich Darstellungen der Komödiengeschichte einzelner Epochen, von denen es allerdings nicht sehr viele gibt, da in wenigen Epochen das epochenspezifische „Programm“ ein eigenes Profil auch für die Komödie entwickelt hat; als Beispiele genannt seien „Die Komödie der Aufklärung“ (1966) von Horst Steinmetz und „Die Komödie der Romantik“ von Uwe Japp (1999).
Geographisch begrenzte Darstellungen
Geographisch begrenzt sind Darstellungen natürlich dann, wenn sie – wie beim Wiener Volkstheater – eine lokal fixierte Art der Komödie zum Thema machen. Auch sonst können Darstellungen sich räumlich begrenzen, zum Beispiel auf österreichische Beiträge zur Komödie (Scheit 1995), wobei dann nicht von vornherein ausgemacht ist, ob die geographisch begrenzte Komödienproduktion als ein Beitrag zur gesamten deutschsprachigen Komödienproduktion angesehen wird oder ob sie als ein gesondert für sich wahrzunehmender Zweig gelten soll.
Geschichte der Komödientheorie
Auch der Geschichte der Komödientheorie gilt – nach der erwähnten Arbeit von Holl (1911) – seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts ein vermehrtes Interesse. Dies zeigt sich vor allem in Sammelbänden, in denen entweder (normativ-programmatische oder deskriptive) Äußerungen von Literaten, Philosophen und Vertretern anderer Disziplinen aus verschiedenen Zeiträumen zusammengestellt sind oder in denen einzelne (literaturwissenschaftlich analysierende) Beiträge verschiedener Forscher aus dem 20. Jahrhundert wieder abgedruckt sind. Allerdings ergibt sich daraus nicht wirklich ein Bild einer übergreifenden Geschichte der Komödientheorie, sofern man mit dem Begriff der Geschichte (der Komödientheorie) die Existenz eines geschichtlichen Kontinuums verbindet. Schon Holl greift sechs einzelne Stationen heraus (wobei er sich an literaturgeschichtlichen Epochen orientiert), er sieht sich also eigentlich nicht in der Lage, eine kohärente Theorie-Geschichte zu liefern. Und dass inzwischen kein Forscher mehr sich an eine tatsächlich übergreifende Darstellung der Geschichte der Komödientheorie herantraut, ist im Grunde leicht erklärbar. Denn im Fall der Theorie der Komödie gibt es einfach kein geschichtliches Kontinuum. Zwar folgen die einzelnen komödientheoretischen normativen oder deskriptiven Stellungnahmen einander (im Sinne eines bloßen chronologischen Nacheinanders), sie beziehen sich aber nicht auf die ihnen vorhergehenden Stellungnahmen, sondern auf die jeweils aktuelle Komödienproduktion. Überdies entstehen in den Epochen nach der Aufklärung kaum mehr eigentlich epochenspezifische komödientheoretische Programme, von denen dann die Programme einer nachfolgenden Epoche sich kritisch absetzen könnten. Insofern bildet die Komödientheorie viel eher einen integralen Teil der Komödiengeschichte, als dass sie eine eigene Geschichte hätte.
Zu nennen sind mit Bezug auf die Geschichte der Komödientheorie jedenfalls die Sammlungen von Reinhold Grimm und Klaus Berghahn (1975), Joachim Suchomski (1979) und Ulrich Profitlich (1998). Texte zur Theorie nicht der Komödie, sondern der Komik hat Helmut Bachmaier gesammelt (2005). Um Arten des Lachens geht es in der Sammlung von Arnd Beise u. a. (2003). Ein sehr wichtiger Sammelband, der sich von verschiedenen Disziplinen her mit dem entsprechend vielseitig ins Auge gefassten Phänomen des Komischen befasst (und dabei auch mit Komödien und mit komödientheoretischen Aspekten), ist bereits 1976 in der Reihe der Veröffentlichungen der Forschergruppe „Poetik und Hermeneutik“ erschienen (Preisendanz/Warning 1976).
Einzelfragen
Mit einzelnen Fragen der Komödientheorie befassen sich verschiedene wichtige Beiträge, von denen einige beispielhaft erwähnt seien. Rainer Warning (1976) untersucht das heikle Verhältnis zwischen dem Komischen (als Inhalt) und der Komödie (als dramatischer Gattung); er hält sich dabei vor allem an die Typenkomödie. Hans Joachim Schrimpf erörtert die terminologische Problematik der Begriffe „Komödie“ und „Lustspiel“ (1978). Reinhold Grimm und Walter Hinck veröffentlichen vier eigene Arbeiten über die Komödie zwischen Satire und Utopie (1982). Karl-Heinz Bareiß verfolgt die Komödiendiskussion von Aristoteles bis Ben Jonson (1982). Abermals ein heikles Verhältnis, nämlich das zwischen normativer Setzung („Wesen der Komödie“) und empirischem Befund (also der Einstufung des einzelnen Textes), wird von Ulrich Profitlich (1997) in einem unten noch einzubeziehenden Aufsatz über Probleme der Gattungsgeschichtsschreibung behandelt.
Zwei Arten des komischen Dramas
Methodisch problematische Aspekte der Komödienforschung, etwa das bisweilen ungeklärte Verhältnis von Komödientext und Theaterinszenierung oder die nicht selten begegnende Tendenz, die Komödie von ihrer vermeintlichen Opposition zur Tragödie her erfassen zu wollen, kommen unten noch zur Sprache. Hier sei daher mit Blick auf die Forschung nur mehr hervorgehoben, dass viele Darstellungen mit umfassenderem Anspruch dazu neigen, zwei (im Einzelnen freilich unterschiedlich gefasste) Arten des komischen Dramas zu unterscheiden, etwa einerseits einen dem Grotesken sich nähernden Typus mit einer Tendenz zur offenen Form und andererseits einen (von heiterer Gelöstheit beherrschten) Typus mit einer Tendenz zur geschlossenen Form (Rommel 1975b). Eine solche Unterscheidung kann auch in historischer Perspektive von den Ursprüngen der abendländischen Komödie her begründet werden. Eine ältere Arbeit (Kindermann 1975) stellt zwei antike „Grundformen“ einander gegenüber, den Komos (davon ist der Begriff „Komödie“ abgeleitet, und gemeint ist die höhere Komödie) und den Mimus (die niedrigere Komödie mit geringerem literarischem Anspruch, wie unten im Rahmen der Gattungsgeschichte ausgeführt wird). Eine eben erwähnte jüngere Arbeit (Greiner 1992) bezieht sich auf zwei zusammenfließende „Ursprünge“, einerseits auf das Dionysisch-Karnevalistische und andererseits auf die notwendige literarische Formung. Ähnliche Unterscheidungen begegnen auch in zahlreichen weiteren verschieden akzentuierenden Dichotomien wie Ausgrenzung und Einsicht in die Hinzugehörigkeit des Ausgegrenzten, Herabsetzung und Heraufsetzung, Lachen über und Lachen mit, Distanzierung und Identifikation.