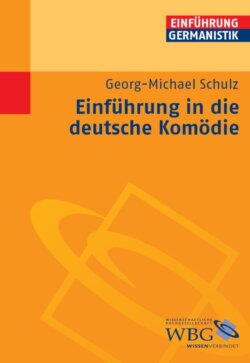Читать книгу Einführung in die deutsche Komödie - Georg-Michael Schulz - Страница 8
2. Elemente der Komödie
ОглавлениеDer Gattungsbegriff der Komödie verführt leicht dazu, spontan an solche Komödien zu denken, die der aus der Antike stammenden Komödien-Tradition angehören, einer im Mittelalter unterbrochenen und von der Renaissance bis zum Barock sich erneut etablierenden Tradition, die sich in unauffälliger und oft kaum bewusster Weise selbst noch in den Boulevard-Komödien des 20. Jahrhunderts fortschreibt ebenso wie in der gängigen Verwendung der Gattungsbezeichnung „Komödie“ für die entsprechenden Filme. Demnach ist die Komödie eine Untergattung in einem System der dramatischen Gattungen, in dem im Prinzip alle dramatischen Texte unterzubringen sind. Der Untergattung Komödie, der traditionellerweise die Opposition zu der Untergattung Tragödie bzw. ernstes Dramas zufällt, werden daher alle „komischen“ Dramen zugeordnet, also auch solche Dramen, die außerhalb dieses Systems oder vor dessen erneuter Etablierung entstanden sind, wie zum Beispiel die noch zu besprechenden Fastnachtspiele. Rechtfertigen lässt sich das nur, wenn sich auch in diesen Dramen nicht alle, aber doch einige derjenigen Elemente finden, die quer durch die Zeiten immer wieder als charakteristisch für eine Komödie angesehen werden.
Komik
Drei dieser Elemente sind die Komik, die erheiternde Wirkung und das gute Ende. Die Komik ist sicherlich eine herausragende Qualität der Gattung, ohne freilich eine unerlässliche Bedingung zu sein (es gibt tatsächlich auch Komödien ohne Komik oder mit nur wenigen komischen Elementen, etwa die „rührenden Lustspiele“ im 18. Jahrhundert). Die Komik bzw. das Komische ist andererseits nicht an eine bestimmte Gattung gebunden (wie z. B. der komische Roman zeigt). Vielmehr ist das Komische zunächst einmal ein vorliterarisches Phänomen der Lebenswelt und daher ebenso kulturell bedingt und historisch wandelbar wie die Lebenswelt im Ganzen.
Die Instanz des Betrachters
Das Komische lässt sich nur beschreiben, wenn man die Instanz des Betrachters mit einbezieht. Denn es gibt nicht das „objektiv Komische“; vielmehr hängt es vom Betrachter ab, ob er eine Äußerung, eine Person, eine Situation als komisch bewertet (daher die Unterschiede von Betrachter zu Betrachter). Entscheidend ist – im Sinne der so genannten Kontrast- oder Inkongruenztheorie – der Kontrast zwischen einer Erwartung auf der Seite des Betrachters und der ausbleibenden Erfüllung auf der Seite des Betrachteten, also die Inkongruenz zwischen dem eigentlich Erwarteten und dem tatsächlich dafür Eintretenden. Bei der Betrachtung von Äußerungen, Personen, Situationen orientiert man sich, meist ohne darüber nachzudenken, an Kriterien wie Normalität / Anormalität, Ordnung / Unordnung, Vernunft / Unvernunft, Sein / Schein, Anspruch / Wirklichkeit usw. Und in der Regel unterstellt man dabei zugleich ein Wertgefälle zwischen Normalität und Anormalität, Ordnung und Unordnung usw., ein Wertgefälle, das – aus der (subjektiven) Sicht des Betrachters – die miteinander kontrastierenden Phänomene voneinander trennt. Indem der Betrachter sich an der Normalität, Ordnung, Vernunft usw., also an einer Norm, orientiert, bewertet er Verstöße gegen die Norm spontan als komisch, allerdings nur dann als komisch und nicht als skandalös, wenn einige (noch zu erwähnende) Zusatzbedingungen erfüllt sind.
Das Komische der Heraufsetzung und das Komische der Herabsetzung
Dementsprechend kann man unterscheiden zwischen einem Komischen der Heraufsetzung und einem Komischen der Herabsetzung (Jauß 1976), eine Unterscheidung, die letzten Endes bei Sigmund Freud vorgeformt ist. Demnach wird entweder etwas Unterdrücktes heraufgesetzt, also aufgewertet, besonders die Kreatürlichkeit, die Leiblichkeit der menschlichen Natur, die Triebe, die Affekte – eine Heraufsetzung, die ein „Lachen mit“, ein Lachen der Solidarität hervorrufen kann und Übermut, Lebensfreude, Enthemmung bewirken kann. Oder aber es wird etwas vermeintlich Ideales herabgesetzt, also abgewertet, zum Beispiel etwas einschüchternd Überlegen-Erhabenes, eine Norm in ihrer angenommenen Gültigkeit, ein Held, der Vollkommenheit beansprucht – eine Herabsetzung, die eher ein „Lachen über“, ein Auslachen bewirkt, da sie Unzulänglichkeit und Versagen enthüllt.
Komplizierend hinzu kommt die Einsicht, dass das in der Regel für selbstverständlich gehaltene Wertgefälle durch das Komische vorübergehend in Frage gestellt wird. Besonders der komisch wirkende Verstoß gegen die übliche Tabuisierung der Triebe hebt zwar die Unterscheidung von Sittlichkeit und Unsittlichkeit nicht auf und macht das Obszöne nicht hoffähig, er lässt aber erkennen, dass das normalerweise Ausgegrenzte und Verdrängte insgeheim dennoch zu dem Hochwertigen hinzugehört und dass nur beides zusammen ein Lebensganzes bildet.
Angesichts dieser Komplexität des Komischen sind im Übrigen Versuche, das Komische, ausgehend von einem Gegensatz von Tragischem und Komischem, zu erklären, regelmäßig gescheitert, auch wenn über lange Zeiten hin die (Regel-)Poetiken sich an einem solchen Gegensatz orientiert haben.
Zusatzbedingungen für die Wirkung von Komischem
Ausschlaggebend für die Wirkung von Komischem sind, wie erwähnt, einige Zusatzbedingungen. Da ist zum einen die Plötzlichkeit, der Überraschungseffekt, der mit der Wahrnehmung von Komischem verbunden ist. Zum anderen ist diese Wahrnehmung ein intellektueller Vorgang; der Betrachter muss Distanz wahren können, er darf nicht emotional engagiert sein. Emotional nicht beteiligt ist der Betrachter besonders dann, wenn er von der Harmlosigkeit, der Folgenlosigkeit des komischen Faktums ausgehen kann. Schließlich wird die Wahrnehmung von Komischem durch eine für sie förderliche Situation, durch einen passenden Rahmen unterstützt, sei es dadurch, dass etwas eigens zu einem komischen Gegenstand und damit zum Lachanlass hergerichtet wird, sei es durch die Bereitschaft des Betrachters zum Lachen und eventuell sogar seine Erwartung von Komischem (zum Beispiel in einer Komödie).
Das Lächerliche
Gelegentliche Versuche, zwischen einem echt Komischen und einem nur Lächerlichen zu trennen, haben keine breitere Resonanz gefunden. Auch bringt es nicht viel, wenn man das Komische / Lächerliche (als Eigenschaft komischer Gegenstände) und das Lustige (als Hervorbringung des Komischen – Beispiel: der Narr) einander gegenüberstellt, da beides gar nicht auf einer Ebene steht (Produkt und Produktion) und darum nicht miteinander konkurriert.
Das Lachen
Der Versuch schließlich, das Komische / Lächerliche vom Lachen her zu erfassen, kann problematisch sein, da das Lachen – als unbeherrschte körperliche Reaktion – keine Bedingung für die Wahrnehmung von (vielleicht nur erheiterndem, ein Schmunzeln provozierendem) Komischem ist. Zudem gibt es höchst unterschiedliche Lachanlässe und Arten des Lachens, auch solche, die wenig mit dem Komischen zu tun haben – vom verächtlichen oder verlegenen Lachen bis zum so genannten „Osterlachen“ aus Freude über die Auferstehung Christi, einem Lachen, das freilich eine Kehrseite hat: „das aggressive Lachen wider den Tod“ und das „Verlachen des Teufels“ an der Grenze zum „Makabren“ (Haug 1996, 52f.).
Sprache, Personen, Einzelhandlungen
Das Komische ist ein augenblickhaft, einzeln, punktuell auftretendes Phänomen. Komisch sein können dementsprechend einzelne Äußerungen einzelner Personen (etwa Wortspiele, witzige Pointen) ebenso wie Dialoge (zum Beispiel beim Aneinander-vorbei-Reden). Das Komische kann des Weiteren an einzelnen Personen haften, egal ob sie eher Typen sind, also reduziert auf wenige Züge (zum Beispiel der „Geizige“), oder eher zu differenzierteren Charakteren individualisiert erscheinen (zum Beispiel der „Schwierige“ [Hugo von Hofmannsthal]). Komisch können schließlich Einzelhandlungen sein (zum Beispiel im Fall von Verwechslungs-, Verstellungs-, Situationskomik).
Die Komödienhandlung im Ganzen
Problematischer wird es bei der Frage, ob eine ganze Komödienhandlung komisch sein kann. Es gibt Komödien, die weitestgehend aus der Aneinanderreihung von Slapsticks bestehen. Hier muss die Handlung als komisch eingestuft werden, aber sie entspricht kaum den üblichen Vorstellungen von einer richtigen Dramenhandlung. Es gibt auch Komödien, in denen die Handlung – wie in Heinrich von Kleists Zerbrochnem Krug – wesentlich auf eine Figur bezogen ist, die ständig – willentlich oder nicht – für komische Effekte sorgt, so dass die Dramenhandlung, die eigentlich ernsthaft auf die Frage ausgerichtet ist, wer den Krug zerbrochen hat, und die mit der Einzelfigur verbundenen komischen Effekte sich kaum voneinander trennen lassen. Es gibt aber nicht zuletzt auch die so genannten Typenkomödien, bei denen die Einzelaktionen komisch sind, während die Komödienhandlung im Ganzen zwar komische (und nicht-komische) Elemente enthält, aber als plot, als dramaturgisch gebaute Bewegung von einem Ausgangspunkt zu einem Endpunkt, nicht komisch ist. In solchen Dramen erweist sich der komische Typ als ein Störenfried, der den Fortgang der Handlung sogar verzögert. In Luise Adelgunde Victorie Gottscheds Pietisterey im Fischbein-Rocke zum Beispiel möchten die „vernünftigen“ Figuren Jungfer Luischen und Herr Liebmann gerne heiraten, was Luischens unter pietistischem Einfluss stehende Mutter, Frau Glaubeleichtin (Namen von Frauen werden im 18. Jahrhundert noch mit weiblichen Endungen versehen) – sie ist hier der komische „Typ“ – zu verhindern versucht, zu guter Letzt freilich ohne Erfolg, denn die vernünftigen Figuren erreichen am Ende ihr Ziel. Besonders komisch wirkt in solchen Stücken in der Regel die mehrfach wiederholte „fehlerhafte“ Einzelaktion des Typen, die ganz offensichtlich die Gesamthandlung nicht voranbringt.
Bühnenkomik
Eingebürgert hat sich zwar der Begriff der Bühnenkomik, er bezieht sich aber auf die eben erwähnten komischen Äußerungen, Personen und Handlungen, wie die Dramentexte sie vorsehen (oder jedenfalls vorsehen können). Bühnenkomik ist also eine Qualität eines Komödien-Textes und nicht erst der Inszenierung einer Komödie auf einer Bühne, wenngleich eine solche Inszenierung natürlich bemüht sein kann, die komischen Züge eines Textes in ganz besonderer Weise zur Geltung zu bringen.
Wirkung
Von der Komik als einer Eigenschaft des Bühnengeschehens hinüber zur Komödie als einer Gattung führt der häufig genannte Aspekt der Wirkung. Dabei geht es entweder um die beabsichtigte Wirkung entsprechend der so genannten Wirkungsästhetik, die die künstlerischen Werke nach den von ihnen zu erzielenden Wirkungen einordnet. Demnach soll die Komödie Lachen (Lächeln, Schmunzeln usw.) hervorrufen (im Unterschied zu den Affekten der Furcht und des Mitleids bzw. – in neuerer Terminologie – des Schauders und des Jammers, die die Tragödie erzeugt). Dieses Lachen ist eine zwar spontane, aber mit dem Intellekt, mit einer Einsicht verbundene Reaktion. Oder aber es geht um die psychologisch-literaturwissenschaftlich zu analysierende Wirkung, die von komischen Bühnengeschehnissen hervorgerufen wird. In dieser Hinsicht kann der Rezipient unter Umständen ganz Verschiedenes empfinden: ein Gefühl der Überlegenheit (über die komisch verblendeten Personen), Schadenfreude (im Fall der komischen Herabsetzung) oder Solidarität (im Fall der komischen Heraufsetzung), eine Entlastung vom Druck gemeinsam erfahrener Zwänge, die Erwartung eines guten Endes, Heiterkeit, Distanz.
Das gute Ende
Zu nennen ist sodann das gute Ende, das zwar in den Komödientheorien nicht immer zur Bedingung erhoben ist, mit dem die Komödien aber sehr oft schließen. Dieses gute Ende kann der wahrhaft glückliche Ausgang, der „exitus felix“, sein, wenn etwa die Liebenden sich nach der Beseitigung aller Widerstände doch noch „kriegen“. Die „Güte“ des Endes kann aber auch so weit eingeschränkt sein, dass man besser von der vermiedenen Katastrophe spricht oder es als Eigenart der Komödie sieht, dass sie ein Misslingen so darstellt, dass dabei die schmerzliche Seite nicht hervorgehoben wird.
Solange die Dichtkunst noch unter der Vormundschaft normativer Poetiken steht, also bis ins 18. Jahrhundert hinein, wird die Komödie auch in Bezug auf das Personal und dessen sozialen Rang, die behandelten Stoffe und Themen und die Sprache von der Tragödie abgegrenzt (davon ist unten unter der Überschrift „Analytisches Instrumentarium“ ausführlicher die Rede).