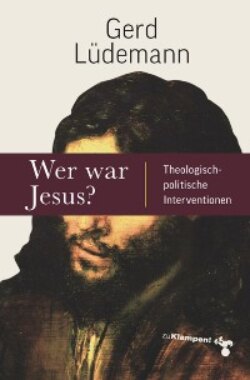Читать книгу Wer war Jesus? - Gerd Ludemann - Страница 11
5. Als Johannes der Täufer Karriere machte1
ОглавлениеJohannes der Täufer stand in einer langen Reihe jüdischer Propheten, die zur Umkehr mahnten. Er verband die Bußforderung mit einer Taufe zur Vergebung der Sünden und der Ankündigung, dass nach ihm ein »Stärkerer« zum Gericht kommen werde. Für die Christen war dies Jesus, auf dessen Geburt Johannes nach den Evangelien verwies.
Als Wüstenbewohner trug der Täufer ein Kleid aus rauem Kamelhaar mit einem ledernen Gürtel. Damit erinnerte er an den Gottesmann Elia, dessen endzeitliche Wiederkunft viele Juden erwarteten. Johannes’ Auftreten knüpfte an prophetische Traditionen an, denen zufolge Israels zukünftiges Heil sich in der Wüste verwirklichen sollte. Massen strömten zu ihm an die Ostseite des Jordan, nahe der Einöde am Toten Meer. Auch Jesus von Nazareth und einige seiner späteren Jünger ließen sich taufen.
Das Wirken des Johannes begann demnach vor dem öffentlichen Auftreten Jesu (ca. 30 n. Chr.). Er überlebte seinen berühmtesten Täufling aber auch um etliche Jahre. So berichtet der jüdische Historiker Josephus von der Hinrichtung Johannes des Täufers durch seinen Landesherrn Herodes Antipas in der Festung Machärus östlich des Toten Meers – der Evangelist Markus setzt fälschlich die königliche Residenz in Tiberias in Galiläa als Ort der Exekution voraus – und fügt hinzu, laut jüdischer Volksmeinung habe Gott als Rache für diese Untat das Heer des Antipas durch den Nabatäerkönig Aretas IV. vernichten lassen.
Diese Schlacht fand im Jahr 36 n. Chr. statt. Dann aber lag der Tod des Täufers dazu in unmittelbarer Nähe. Hiergegen kommen die ersten drei Evangelien (Matthäus, Markus und Lukas) nicht an; ihnen zufolge gehören Johannes’ Gefangennahme und Tod ungefähr ins Jahr 28 n. Chr., also in die Zeit vor dem Auftreten Jesu. Doch hat diese »Chronologie« keine historische Basis und ist allein im theologischen Urteil begründet, dass Johannes der Vorläufer Jesu sei.
Die Johannestaufe schuf im Judentum etwas Neues. Im Unterschied zu den bisher üblichen Waschungen, die nicht Sündenvergebung, sondern kultische Reinheit bewirkten – vor allem nach Berührung mit Totem, nach Ausfluss, Menstruation und Geburt –, war sie ein einmaliger Akt und keine Selbstwaschung; der Täufer vollzog sie persönlich, durch Untertauchen.
Seitdem Jesus durch die »Auferstehung« zur Rechten Gottes erhöht und Mittelpunkt eines Kultes war, mutierte die Johannestaufe zur christlichen Taufe. Sie galt von Anfang an als Aufnahmeritus, obwohl Jesus sie gar nicht befohlen hatte, und wurde fortan auf seinen Namen vollzogen. Die Gemeinden praktizierten sie übereinstimmend, weil Jesus selbst getauft worden war.
Indes bereitete frühen Christen die Taufe Jesu durch Johannes auch Schwierigkeiten. Zum einen geschah die Johannestaufe zur Vergebung der Sünden. Hatte also auch Jesus gesündigt? Da diese Möglichkeit der Überzeugung widersprach, er sei als Sündloser »für unsere Sünden« gestorben, blieb eigentlich nur die Schlussfolgerung übrig, dass seine Taufe überflüssig war.
Zum anderen entstand leicht der Eindruck, dass Johannes einen höheren Rang als der von ihm getaufte Jesus besaß. Auch dies lief dem Glauben der Christen zuwider. Daher gestalteten die Autoren der neutestamentlichen Evangelien die Traditionen von der Taufe Jesu um. Die dabei zu beobachtenden Eingriffe vermitteln aufschlussreiche Einblicke in die christliche Theologie des ersten Jahrhunderts.
Markus, Verfasser des ältesten Evangeliums, das die anderen Evangelisten voraussetzen, stilisiert die Taufe Jesu als Akt der Einsetzung Jesu zum Gottessohn, dessen Kommen Johannes in Übereinstimmung mit der Schrift angekündigt hat.
Matthäus lässt Johannes den Taufwunsch Jesu mit den Worten ablehnen: »Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir?« Doch Jesus beharrt darauf, »alle Gerechtigkeit zu erfüllen.« Damit steht fest, dass Jesus nicht als Sünder, sondern als Gerechter getauft wird.
Lukas erweckt den Eindruck, dass Jesus gar nicht von Johannes getauft wurde, denn zum Zeitpunkt von Jesu Taufe saß dieser bereits im Gefängnis. Damit ist Jesus von Johannes abgegrenzt, und der Verdacht, dass Jesus dem Täufer untergeordnet sei, kommt erst gar nicht auf.
Johannes erzählt gar nicht mehr von einer Taufe Jesu, obwohl er sicher von ihr wusste, und erwähnt auch an keiner Stelle die Bußpredigt Johannes des Täufers. Dieser wird vielmehr zum ersten christlichen Prediger und bezeugt bereits zu Beginn des Johannesevangeliums Jesus als Logos (»Wort«), der von Anfang an bei Gott gewesen sei. Er kündigt Jesus mit den Worten an: »Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, denn er war eher als ich.« Wenn der Evangelist hervorhebt, dass nicht Johannes, sondern Jesus das Licht der Welt sei, so ist dies – ähnlich wie die manipulierte Fassung der Täuferlegende im Lukasevangelium – ein Seitenhieb auf Johannesjünger, die solches von ihrem Meister behaupteten.
Die Existenz von Johannesjüngern lässt sich an weiteren Stellen des Neuen Testaments belegen. Sie bestatteten ihren Meister nach dessen Exekution, erzählten von den Einzelheiten seines Martyriums und hielten auch danach feste Gebets- und Fastenzeiten ein. Das Verhältnis zwischen Täufer- und Jesusjüngern verlief anfangs konfliktfrei, umso mehr, als Jesus selbst und einige seiner späteren Jünger vorübergehend dem Täuferkreis angehörten. Durch die Übernahme der Johannestaufe bejahten die ältesten Judenchristen, ebenso wie Jesus zuvor, auch den Inhalt der Verkündigung des Johannes: Naherwartung des letzten Gerichts und Umkehrpredigt.
In der ersten Zeit waren die Übergänge zwischen Jesusbewegung und Johanneskreis fließend, zumal sich beide innerhalb der Glaubenstraditionen der jüdischen Religion bewegten. Dies änderte sich spätestens, als Täuferjünger – wie aus dem Lukas- und Johannesevangelium hervorgeht – ihrem Meister Ehrentitel (»Großer«, »Licht«, »Leben«) zuschrieben, die Christen auch für Jesus in Anspruch nahmen. Ein Bruch war unvermeidlich.
In den sogenannten Pseudoklementinen – einer Reihe von Texten, die vom Leben des heiligen Clemens von Rom handeln – sind gnostische Traditionen aus dem 2. Jahrhundert enthalten. Sie schildern gleichsam die Fortsetzung des Konflikts zwischen Johannes- und Jesusgemeinde und malen Johannes im dunkelsten Schwarz. Er gehöre der auf Eva zurückgehenden weiblichen Falschprophetie zu, Jesus als der wahre Prophet hingegen der auf Adam zurückgehenden männlichen Prophetie.
Die Forschung hat zumeist einen aktuellen Bezug dieser Polemik auf eine Täufergruppe um Johannes abgelehnt. Doch findet sich eine Analogie im gnostischen Traktat »Paraphrase des Seem« aus den Nag-Hammadi-Schriften. Er erzählt von einem erbitterten Kampf zwischen Jesus (= »der Dämon Soldas«), in dem der gnostische Erlöser Derdekeas zeitweise wohnt, und seinem Widersacher Johannes (= »der andere Dämon«). Der gut erhaltene Text, der streckenweise aber nur schwer zu verstehen ist, spiegelt den die Taufe betreffenden Konflikt zwischen zwei Parteien wider und belegt zusammen mit den Pseudoklementinen die Existenz lebendiger sich auf Johannes berufender Täuferkreise im 2. Jahrhundert.
Die Polemik in den genannten Schriften wirkt wie eine Steigerung der Angriffe, die das Johannesevangelium gegen Täuferjünger richtete. Vielleicht hatten die Attacken in der »Paraphrase des Seem« die gnostische Taufbewegung der Mandäer (»die Erkennenden«) im Blick; diese verehrten Johannes den Täufer und lehnten Jesus als Betrüger ab.
Die Mandäer zogen im 2. Jahrhundert aus dem Ostjordanland in das südliche Euphrat-Tigris-Gebiet, wo sich – vor allem in Bagdad und Basra – große Teile von ihnen heute noch aufhalten. Während die Christen den jüdischen Bußprediger Johannes zum Vorläufer Jesu stilisierten, haben die Mandäer den Täufer zum gnostischen Heiligen gemacht.