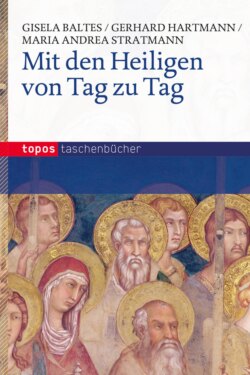Читать книгу Mit den Heiligen von Tag zu Tag - Gerhard Hartmann - Страница 6
Оглавление1. Februar
Katharina de’ Ricci
Katharina de’ Ricci (1522–1590), auch Caterine de’ Ricci, hieß ursprünglich Alessandra Lucrezia Romola, stammte aus Florenz und trat mit 14 Jahren den Dominikanerinnen in Prato bei, deren Priorin sie bereits mit 25 Jahren war. Sie war stigmatisiert, wirkte Wunder und hatte Visionen, wodurch sie schon zu Lebzeiten verehrt wurde. Bekannt wurde sie auch durch zahlreiche Briefe, die sie wichtigen Persönlichkeiten der damaligen Zeit – u. a. Philipp Neri [26. 5.], Karl Borromäus [4. 11.] und Juan d’ Austria – geschrieben hatte. (H)
Severus von Ravenna (4. Jh.) – Petrus von Antiochien (um 340–vor 440) – Brigitta von Kildare (um 453–525) – Sigibert III. von Austrasien (um 630–656) – Reginald von St-Gilles (1183–1220) – Maria-Anna Vaillot (1736–1794) – Odilia Baumgarten (1750–1794) – Johanna Franziska von der Heimsuchung (Anna Michelotti) (1843–1888)
2. Februar
Darstellung des Herrn – Mariä Lichtmess
Das Fest der Darstellung des Herrn gehört zu den älteren Marienfesten. Im Lukasevangelium (2,22f.) wird davon berichtet, dass die Eltern Jesu das Kind in den Tempel brachten, wo sie auch das gebotene Reinigungsopfer für die Mutter vollzogen. Hier begegneten sie Simeon und Hanna, die in Jesus den Messias erkannten. Zwei historische Feste liegen diesem Festtag zugrunde: ein älteres Fest in Jerusalem und ein jüngeres in Rom. Seit dem 5. Jh. feierte man es in Jerusalem, seit dem 7. Jh. in Rom als „Fest der Begegnung“ mit einer Lichterprozession. Bis zur Liturgiereform von 1969/70 hieß das Fest „Mariä Reinigung“ (In purificatione B. M. V.). Mit der Bezeichnung „Darstellung des Herrn“ erhielt das heutige Fest danach seinen Charakter als Herrenfest wieder. Im deutschen Sprachraum führte der Brauch der Kerzensegnung und der Lichterprozession zu der Bezeichnung „Mariä Lichtmess“. Simeon nennt Jesus „ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel“. Der 2. Februar ist seit 1997 zugleich der „Tag des geweihten Lebens“, ein Tag des Dankes und der Bitte für Menschen, die sich mit ihrem Leben ganz Gott zur Verfügung stellen, sich ihm geweiht haben. Nach dem Brauchtum endet an diesem Tag die Weihnachtszeit, wo
z. B. der Weihnachtsschmuck in den Kirchen abgebaut wird. In Österreich war dieser Tag bis 1918 gesetzlicher Feiertag. (S)
Burkhard von Würzburg
Burkhard (Burkard) (um 684–755?) war Angelsachse und der erste Bischof von Würzburg. Er ist um 735 zusammen mit Bonifatius [5. 6.] nach Deutschland zwecks Missionierung gekommen und von ihm im Jahr 742 zum Bischof von Würzburg geweiht worden. Als solcher nahm er 743 an der Reformsynode (Concilium Germanorum) teil. Angeblich soll er nach zehnjähriger Amtszeit abgedankt haben, was aber Legende ist. Um 750 gründete er das Andreas-Kloster. Burk-
hard starb während einer Rast in einer Tropfsteinhöhle in Homburg im Maintal und wurde in St. Andreas (später
St. Burkhard) begraben. (H)
Hadeloga (Adelheid) von Kitzingen (um 710–um 750) – Johanna von Lestonnac (1556–1640) – Stephan Bellesini (1774–1840) – Maria Katharina Kasper (1820–1898)
3. Februar
Blasius
Blasius (3. Jh.–um 316) gilt als Schutzpatron gegen Halsleiden und wird zu den Vierzehn Nothelfern gezählt. Als standhafter Bekenner seines Glaubens erlitt er unter Kaiser Licinius (oder bereits unter Diokletian) nach schrecklichen Qualen den Märtyrertod. Von seinem Leben wissen wir nur aus Legenden. Bevor er Bischof von Sebaste (heute: Sivas, Türkei) wurde, soll er Arzt gewesen und wegen seiner Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe besonders geschätzt worden sein. Eine Legende berichtet, er habe im Kerker einen Knaben, der sich an einer Fischgräte verschluckt hatte, durch sein Gebet vor dem Erstickungstod gerettet. Darauf geht der im 16. Jh. entstandene Brauch des Blasiussegens mit gekreuzten Kerzen zurück, in dem Blasius um den Schutz vor Halskrankheiten gebeten wird. (B)
Ansgar
Ansgar (801–865) gilt als Wegbereiter des Christentums in Dänemark und Schweden und wird deshalb „Apostel des Nordens“ genannt. Er stammte aus Corbie (Picardie) in Frankreich, wurde in der dortigen Benediktinerabtei erzogen und trat dann dort ein. 823 wurde er Lehrer an der Klosterschule der neugegründeten Abtei Corvey an der Weser. Ab 826 unternahm er entbehrungsreiche Missionsreisen nach Skandinavien, die kaum Erfolg hatten. 831 wurde er erster Bischof von Hamburg und päpstlicher Legat für die Mission im Norden. Nach der Plünderung seines Missionsstützpunktes Hamburg durch die Wikinger musste er die Skandinavienmissionierung aufgeben und wurde Bischof von Bremen. Versuche, den Bischofssitz wieder nach Hamburg zu verlegen, scheiterten an erneuten Plünderungen. Deshalb wurde 864 die Diözese Hamburg-Bremen errichtet. Ansgar errichtete Spitäler, kaufte Gefangene frei und setzte sich für die Abschaffung des Sklavenhandels ein. Nach wie vor betrieb er seine weiterhin äußerst mühsame Missionstätigkeit. In den letzten Jahren seines Lebens widmete er sich verstärkt der kirchlichen Aufbauarbeit in seinem Bistum. (B)
Simeon und Hanna (1. Jh.) – Maria vom hl. Ignatius (Claudine Thévenet) (1774–1837) – Maria (Anna Helena) Stollenwerk (1852–1900) – Alois (Alojs) Andritzki (1914–1943)
4. Februar
Veronika
Veronika wurde weder im Neuen Testament erwähnt – wenn man vom Bezug zu den „weinenden Frauen“ bei Lk 23,26-31 absieht – , noch gibt es andere historische Quellen. Trotzdem hat sie es geschafft, mit dem Kreuzweg Jesu geradezu untrennbar in Verbindung gebracht zu werden. Das „Schweißtuch der Veronika“ zählt zu den bekanntesten Bild-Legenden des Passionsgeschehens und ist als 6. Station Bestandteil der Kreuzwegandacht geworden. Seit dem 4. Jh. taucht in der apokryphen Literatur eine „Berenike“ (= lateinisch „Veronika“) auf, die schon in den apokryhen„Pilatus-Akten“ als Zeugin für ein Heilungswunder Jesu aufgetreten war, zunächst noch ohne das Schweißtuch-Motiv. Nach einer Quelle aus dem 6. Jh. besaß Veronika ein gemaltes, heilkräftiges Bild, das die Schuld des Pilatus erwiesen und Kaiser Tiberius hatte gesunden lassen. Die Erzählung der 6. Kreuzwegstation kam erst viel später (im 13. Jh.) auf: Veronika begegnet auf dem Kreuzweg Jesus, reicht ihm ein Tuch, um damit Schweiß und Blut abzuwischen, worauf sich das Antlitz Jesu im Tuch verewigt. Solche wunderbaren und oft als übernatürlich entstanden geltenden Bilder beruhen auf der Wunschvorstellung nach einem Original-„Porträt“ Jesu. Bei der Seherin Anna Katharina Emmerick [9. 2.] erfährt man in „Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi“ etwas mehr darüber, wie Veronika zu ihrem Namen kam: „Es war Seraphia, das Weib des Sirachs, … welche durch ihre Handlung den Namen Veronika, von ‚vera ikon’ (= das wahre Bild), erhalten hat.“ Trotz alledem ist Veronika bis heute ein auch in Abwandlungen (Ronja, Frauke) beliebter Vorname. (H)
Rabanus Maurus
Rabanus (780–856) war ein hochgebildeter Mann, der es sich zur Aufgabe machte, das klassische Wissen an seine Gegenwart weiterzugeben. Er erhielt deshalb den Ehrennamen „Lehrer Germaniens“ (Praeceptor Germaniae). Rabanus wurde mit 15 Jahren Mönch des Benediktinerklosters Fulda. Später kam er zur weiteren Ausbildung nach Tours zu Abt Alkuin, der ihm den Beinamen Maurus in Erinnerung an den großen Schüler des hl. Benedikt [11. 7.] gab. Nach Fulda zurückgekehrt, wurde Rabanus Lehrer, später Leiter der Klosterschule. 814 empfing er die Priesterweihe. 822 übernahm er als Abt die Leitung des Klosters. 847 wurde er zum Erzbischof von Mainz gewählt. Trotz seiner vielfältigen Aufgaben nahm er sich weiterhin Zeit für seine schriftstellerische und lehrende Tätigkeit. Unter anderem verfasste er eine 22-bändige Enzyklopädie des gesamten Wissens seiner Zeit. Neben anderen Hymnen soll auch der berühmte Pfingsthymnus Veni creator spiritus von ihm stammen. (B)
Isidor von Pelusium (um 360–431/41) – Nikolaus Studites (793–868) – Gilbert von Sempringham (um 1085–1189) – Johanna von Valois (1464–1505) – Josef von Leonessa (1556–1612) – Johannes Hector de Britto (1647–1693)
5. Februar
Agatha
Agatha (um 225–um 250) stammte der Überlieferung nach aus Catania (Sizilien) und erlitt – wahrscheinlich unter Kaiser Decius – den Märtyrertod. Die Legende berichtet, sie habe sich geweigert, den heidnischen Präfekten Quintianus zu heiraten. Um ihren Glauben zu erschüttern, habe dieser sie daraufhin verhaften und in ein Bordell verschleppen lassen. Da er damit nichts ausrichten konnte, habe er sie grausam martern lassen, bis sie schließlich im Kerker den Tod fand. Ihre Verehrung verbreitete sich schon früh über Sizilien hinaus. (B)
Jakob (Israel) (AT) – Ingenuin (6. Jh.–um 605) – Sabas der Jüngere (um 910–um 990) – Albuin von Säben-Brixen (10. Jh.–1005/06) – Adelheid von Vilich (um 960–1010/20) – Elisabeth (Elisabetta) Canori-Mora (1774–1825)
6. Februar
Dorothea
Dorothea (um 290–305) stammte aus einer christlichen Familie in Cäsarea in Kleinasien (heute Kayseri in der Türkei). Ihr Leben ist nur legendenhaft überliefert. Danach soll sie das Liebeswerben des heidnischen Statthalters Apricius zurückgewiesen haben, der sie darauf zum Tode verurteilte. Auf dem Weg zur Hinrichtung begegnete sie dem Advokaten Theophilus, der durch ein plötzliches Wunder bekehrt wurde. Er wurde daraufhin gleich gemeinsam mit Dorothea hingerichtet. (H)
Paul Miki und Gefährten
Paul Miki (um 1565–1597) bemühte sich im Anschluss an die Mission Franz Xavers [3. 12.] erfolgreich um die Verbreitung des christlichen Glaubens in Japan. Er stammte aus einer vornehmen japanischen Familie. Seit seinem elften Lebensjahr wurde er von Jesuiten erzogen und trat mit 22 Jahren in den Jesuitenorden ein, wo er als Einheimischer auf die Glaubensverkündung in Japan vorbereitet wurde. Dort setzte nach anfänglicher Duldung des Christentums ab 1587 aus religiösen und politischen Motiven eine Wende ein, in der der christliche Glaube verboten und schließlich verfolgt wurde. Vor allem die Missionare wurden gefangen genommen und grausam gefoltert, um sie zum Glaubensabfall zu bewegen. Unter ihnen war Paul Miki mit 25 Gefährten, den Märtyrern von Nagasaki. Da sie standhaft blieben, wurden sie zum Tode durch Kreuzigung verurteilt. Noch am Kreuz bekannten sie singend und predigend ihren Glauben. (B)
Vedastus (Vaast, Gaston) von Arras (5. Jh.–540) – Amandus von Maastricht (6. Jh.–679) – Reinhild von Aldeneyk (8. Jh.–780) – Guarin von Palestrina (um 1080–1159)
7. Februar
Pius IX.
Giovanni Maria Mastai-Ferrati (1792–1878) wurde in Seni-
gallia (Marken, Italien) geboren, sein Elternhaus war an sich liberal. Er studierte zuerst am Piaristenkolleg zu Volterra, das ihn wegen seiner epileptischen Anfälle entließ, dann in Rom, wo er nach einer Dispens wegen seiner Krankheit 1819 zum Priester geweiht wurde. Danach machte er bald Karriere, war ab 1823 in der päpstlichen Diplomatie tätig und wurde 1827 zum Erzbischof von Spoleto und 1832 (parallel) zum Bischof von Imola ernannt. Schon 1840 wurde er zum Kardinal kreiert. Bereits am 16. Juni 1846 wurde er zum Papst gewählt. Anfänglich als „liberaler“ Papst wahrgenommen, änderte sich seine Haltung mit seinen Erfahrungen im Revolutionsjahr 1848. Pius IX. schlug in der Folge im Kirchenstaat sowie innerkirchlich einen schroffen antiliberalen Kurs ein. 1854 definierte er das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis Marias. 1864 veröffentlichte er die Enzyklika Quanta cura und den Syllabus, wo er die Zeitirrtümer, besonders den Liberalismus, verurteilte. Er berief in der Folge das I. Vatikanische Konzil ein, das in dem Dekret Pastor aeternus gegen erhebliche Opposition den Jurisdiktionsprimat sowie die Unfehlbarkeit des Papstes beschloss. Damit erreichte der päpstliche Zentralismus seinen Höhepunkt. Das Konzil musste in Folge des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 abgebrochen werden, und die letzten Reste des Kirchenstaates – die Stadt Rom – wurden dem neuen Königreich Italien einverleibt. Pius IX. betrachtete sich in der Folge als „Gefangener des Vatikans“ und exkommunizierte das italienische Königshaus. Seine von Papst Johannes Paul II. [22. 10.] im Jahr 2000 vorgenommene Seligsprechung stieß auf Kritik. (H)
Mose(s) (AT) – Richard von England (7. Jh.–720) – Rizerius von Muccia (1190–1236) – Jakob Salès (1556–1593) – Wilhelm Saultemouche (1556–1593) – Maria von der Vorsehung (Eugènie Smet) (1825–1871)
8. Februar
Hieronymus Ämiliani
Hieronymus (1486–1537) stammte aus einer vornehmen venezianischen Familie. Schon früh wandte er sich dem Waffendienst zu und führte während dieser Zeit ein ausschweifendes Leben. 1508 geriet er in Gefangenschaft. Hier vollzog sich bei ihm ein innerer Wandel. Nach seiner unerwarteten Befreiung stellte er sein Leben in den Dienst der Nächstenliebe. Er setzte sich besonders für Waisenkinder und Pestkranke ein. In mehreren Städten errichtete er Waisenhäuser. Gleichgesinnte schlossen sich ihm an. Daraus entstand 1528 eine Genossenschaft von Regularklerikern, die Gemeinschaft der „Somasker“ (genannt nach der Gründungsstadt Somasca). Hieronymus starb an der Pest, die er sich bei der Pflege Pestkranker zugezogen hatte. Bis zur Liturgiereform von 1969/70 war der 20. Juli sein Gedenktag. (B)
Josefine Bakhita
Josefine (1869–1947) war die erste Ordensfrau mit schwarzer Hautfarbe. Sie wurde im Sudan geboren und als Kind von Sklavenhändlern geraubt. Zynisch gab man ihr den Namen „Bakhita“ – „Du hast Glück gehabt“. Bis 1885 wurde sie fünfmal verkauft und denkbar schlecht behandelt. Schließlich kam sie zum italienischen Konsul Callisto Legnani, wo sie erstmals gut behandelt wurde. Er nahm sie mit nach Italien und übergab sie einer befreundeten Familie als Kindermädchen. Während einer vorübergehenden Unterbringung bei den Canossianerinnen lernte das junge Mädchen den Glauben kennen. Nach einigen Monaten des Katechumenats wurde sie in die Kirche aufgenommen und erhielt den Namen Josefina. Mit Hilfe der Oberin setzte sie durch, dort im Kloster bleiben zu dürfen. Obwohl erst 1920 offiziell die ersten schwarzen Schwestern in einem katholischen Orden zugelassen wurden, durfte Josefine auf Fürsprache des Patriarchen von Venedig, Giuseppe Sarto, des späteren Papstes Pius X. [21. 8.], schon 1891 in den Orden eintreten. Papst Johannes Paul II. [22. 10.] hat sie am 17. Mai 1992 selig- und am 1. Oktober 2000 heiliggesprochen. Er nahm ihre Heiligsprechung zum Anlass, die Gesellschaft zu mahnen, Gewalt und Unterdrückung von Mädchen und Frauen nicht länger zu dulden. (B)
Honoratus von Mailand (6. Jh.–570)
9. Februar
Anna Katharina Emmerick
Anna Katharina Emmerick (1774–1824) wurde in Coesfeld
(Westfalen) als Tochter armer Kleinbauern geboren. Sie be-
suchte kaum die Schule, arbeitete als Magd und machte eine Lehre als Näherin. 1802 trat sie in Dülmen ins Augustiner-
innenkloster ein, das aber bereits 1811 aufgehoben wurde. Sie erkrankte zunehmend, und die Wundmale Christi erschienen auf ihrem Körper. In den folgenden zwölf Jahren bis zu ihrem Tod hatte sie mystische Visionen an Freitagen, in denen sie u. a. die Passion Christi miterlitt. In diesen sah sie auch Ereignisse aus dem Leben Jesu, die nicht in den Evangelien überliefert sind, etwa von der Passion oder dem Leben Mariens in Ephesos. Zwischen 1819 und 1824 war der Schriftsteller Clemens Brentano bei Anna Katharina Emmerick und zeichnete die Visionen auf, die er dann veröffentlichte. (H)
Apollonia (2. Jh.–um 249) – Alto von Altomünster (8. Jh.) – Michael Febres Cordero (1854–1910)
10. Februar
Scholastica
Scholastica (um 480–um 547) war die Schwester des hl. Benedikt von Nursia [11. 7.]. Einzige biographische Quelle ist ein legendärer Bericht von Papst Gregor I. dem Großen [3. 9.]. Schon als Kind wurde sie Gott geweiht und in klösterliche Erziehung gegeben. Als Ordensfrau lebte sie zunächst in einem Kloster bei Subiaco, später in der Nähe von Montecassino. Ihrem Bruder Benedikt war sie ein Leben lang in tiefer Geschwisterliebe verbunden. Beide trafen sich einmal im Jahr zu einem geistlichen Gespräch. Beim letzten Gespräch soll ihn auf ihr Gebet hin ein Unwetter daran gehindert haben zu gehen, sodass ihr Gespräch bis weit in die Nacht dauerte. Drei Tage später starb sie. Benedikt soll gesehen haben, wie ihre Seele als weiße Taube in den Himmel flog. Sie ist Patronin gegen Blitz und Regen. (B)
Alois (Alojzije) Stepinac
Alois (Alojzije) Viktor Stepinac (1898–1960) wurde in Krašić (Kroatien) als Sohn eines Großbauern geboren und besuchte in Agram (Zagreb) das erzbischöfliche Knabenseminar, wo er 1916 maturierte (Abitur). Danach musste er in die österreichisch-ungarische Armee einrücken und war an der Isonzo-Front eingesetzt, wo er verwundet wurde und in italienische Gefangenschaft geriet. Nach seiner Rückkehr begann er zuerst mit dem Landwirtschaftsstudium, beschloss aber dann, Priester zu werden, studierte Theologie in Rom und wurde 1930 zum Priester geweiht. Danach wurde er Sekretär des damaligen Erzbischofs von Agram (Zagreb) und 1937 – mit 39 Jahren – selber Erzbischof. Nach der deutschen Besetzung 1941 wurde Kroatien ein eigener Staat unter zuerst italienischer, dann deutscher Abhängigkeit sowie unter Führung eines halbfaschistischen Regimes. Die Rolle von Stepinac in dieser Zeit bis 1945 wird ambivalent beurteilt. Einerseits ging er mit dem Regime konform, andererseits soll er Juden geholfen haben, gegen die KZ’s der Ustascha protestiert und die Serben in Schutz genommen haben. Nach der Machtübernahme der kommunistischen Tito-Partisanen wurde er im Mai 1945 verhaftet, jedoch bald wieder freigelassen. Im September 1946 wurde er neuerlich verhaftet und zu 16 Jahren Gefängnis und Zwangsarbeit wegen seiner Zusammenarbeit mit dem kroatischen Regime verurteilt. 1951 gab das Tito-Regime dem internationalen Druck nach – es war das gerade die Zeit, als Tito mit der Sowjetunion gebrochen hatte – und entließ Stepinac in einen Hausarrest in seinem Heimatdorf. 1953 wurde er zum Kardinal kreiert, reiste aber nicht nach Rom, weil er glaubte, nicht mehr in seine Heimat zurückkehren zu können. Er erkrankte an Leukämie, an der er dann auch starb. Sein Grab befindet sich im Dom von Agram (Zagreb). Seine im Oktober 1998 vorgenommene Seligsprechung war wegen seiner Ambivalenz nicht unumstritten. (H)
Wilhelm von Malavalle (12. Jh.–1157) – Hugo von Fosses (um 1093–1164)
11. Februar
Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes
Am 11. Februar 1858 erschien der vierzehnjährigen Bernadette Soubirous [16. 4.] in der Felsengrotte Massabielle bei Lourdes (Südfrankreich) eine „schöne Frau“, von der sie später, auf wiederholte Nachfrage hin, erfuhr, sie sei die „Unbefleckte Empfängnis“. In der Zeit bis zum 16. Juli erschien Maria dem in einfachsten Verhältnissen, ohne Schulbildung aufgewachsenen Mädchen noch weitere 17-mal. Trotz aller Infragestellungen verteidigte Bernadette die Echtheit der Erscheinungen. Eine vom Bischof einberufene Untersuchungskommission stellte schließlich 1862 fest, dass die Erscheinungen alle Kennzeichen der Wahrheit aufweisen. Die Zustimmung durch Papst Leo XIII. für die regionale Verehrung erfolgte 1891, Papst Pius X. [21. 8.] dehnte 1907 das Fest auf die ganze Kirche aus. (S)
Soteris (3. Jh.–305) – Gregor II. (669–731) – Paschalis I. (8. Jh.–824)
12. Februar
Benedikt (Witiza) von Aniane
Witiza (lateinisch Euticius) (um 750–821) wurde in Aquitanien geboren, ist adeliger Herkunft und stand zuerst im Dienste Pippins des Jüngeren und Karls des Großen [28. 1.]. 773 trat er in bei Dijon in ein Kloster ein und nahm den Ordensnamen Benedikt an. 780 gründete er aber dann auf dem elterlichen Gut Aniane ein eigenes Benediktinerkloster. Dieses wurde Ausgangspunkt einer Klosterreform und war bald eines der größten des Frankenreichs. König Ludwig der Fromme (später Kaiser) machte ihn daher 792 zum Gener-
alabt des ganzen Frankenreiches und 814 zum Abt des von ihm gegründeten Klosters Kornelimünster bei Aachen. Von dort konnte er besser seine Funktion als Generalabt wahrnehmen. Ihm war auch zu verdanken, dass bis ins Hochmittelalter hinein alle Klöster Deutschlands und Frankreichs nach der Regel des hl. Benedikt [11. 7.] lebten. (H)
Eulalia von Barcelona (3. Jh.–um 290) – Humbelina (11. Jh.–vor 1136)
13. Februar
Christina von Spoleto
Christina (um 1435–1456) wurde in Ostena bei Porlezza am Luganer See (Schweiz) geboren und hieß ursprünglich Augustina Camozzi. Nachdem ihr Ehemann verstorben war und nach einer Zeit eines unsteten Lebens, besann sie sich und trat um 1455 als Terziarin in den Dritten Orden der Augustinerinnen von Spoleto ein. Durch ihr Bußverhalten und ihre Werke der Nächstenliebe stand sie sehr bald im Ruf der Heiligkeit, starb aber bereits in relativ jungen Jahren. (H)
Kastor von Karden (4. Jh.–um 400) – Gosbert von Osnabrück (9. Jh.–874) – Jordan von Sachsen (vor 1200–1237) – Eustochia von Padua (1444–1469)
14. Februar
Cyrill und Methodius
Die Brüder Cyrill (826/7–869) und Methodius (9. Jh.–885) werden „Apostel der Slawen“ genannt. Sie stammten aus Thessaloniki und waren beide sehr sprachbegabt. Bei der Missionierung der Slawen, zunächst am Schwarzen Meer, dann besonders in Mähren, führten sie die slawische Sprache in die Liturgie ein. Hierfür entwickelten sie eigene „glagolitische“ Schriftzeichen. Cyrill übersetzte biblische und in der Liturgie gebrauchte Texte in die Volkssprache. Die Einführung der slawischen Muttersprache in die Liturgie war im Westen zunächst sehr umstritten. Cyrill und Methodius setzten sich aber in Rom dafür ein, dass auch sie in der Liturgie erlaubt wird. Durch Papst Hadrian II. wurde sie 867 anerkannt. Cyrill starb in Rom. Sein Bruder wurde dann vom Papst zum Erzbischof von Pannonien (damals oströmische Provinz) und Mähren ernannt und war gleichzeitig Legat des Apostolischen Stuhls bei den Slawen. Nach Differenzen mit dem Erzbischof von Salzburg, der die Gebiete, in denen Methodius wirkte, als seinen Missionsbereich betrachtete, wurde dieser für einige Zeit verbannt, später jedoch wieder frei gelassen. Seine Befugnisse wurden aber eingeschränkt. Unter direkter Leitung Roms sollten fortan die lateinische und die slawische Kirchensprache im kirchlichen Leben gleichberechtigt nebeneinander gelten. Johannes Paul II. [22. 10.] ernannte die Brüder am 31. Dezember 1980 zu Schutzpatronen Europas. Bis zur Liturgiereform von 1969/70 war der 7. Juli ihr Gedenktag. (S)
Valentin von Terni (3. Jh.–268) – Johannes Baptist von der Empfängnis (Johannes Garcia Jijón) (1561–1613)
15. Februar
Siegfried von Schweden
Siegfried (10. Jh.–um 1040) wurde in England geboren, war Mönch in Glastonbury (in der Nähe von Bristol) und kam als Missionar von dort um 995 nach Norwegen und dann nach Schweden. Dort gründete er in Gotland das erste Bistum Sakara und taufte den König Olaf Skötkonung. Er starb in Vässjö und erhielt nach seinem Tod den Beinamen „Apostel von Schweden“. (H)
Onesimus von Ephesus (1. Jh.) – Faustinus und Jovita (2. Jh.) – Druthmar vom Corvey (10. Jh.–1046) – Claudius de la Colonbière (1641–1682)
16. Februar
Juliana von Nikomedien
Juliana (um 285–um 304) wurde in Nikomedien (heute Izmid, Türkei) geboren. Nach der Legende wurde sie bereits als kleines Kind Christin, obwohl die Eltern Heiden waren. Als sie erklärte, ihren vorgesehenen Ehemann nur dann zu heiraten, wenn er sich taufen lässt, wurde ihr Christsein bekannt. Ihr versprochener Ehemann, der inzwischen Stadtpräfekt geworden war, ließ sie foltern, damit sie vom Christentum abschwört. Als das keinen Erfolg hatte, wurde sie mit flüssigem Blei übergossen und enthauptet. Ihre Reliquien befinden sich in Neapel. (H)
Simeon von Metz (4. Jh.) – Philippa Mareri (1200–1236)
17. Februar
Die sieben Gründer des Servitenordens
1233 beschlossen sieben reiche Kaufleute aus Florenz, ihr Leben grundlegend zu ändern und in den Dienst der Armen und Kranken zu stellen. Es waren das: Buonfiglio dei Monaldi (Bonfilius, † 1262), Giovanni di Buonagiunta (Bonajuncta,
† 1257), Benedetto dell’ Antella (Manettus, † 1268), Bartolomeo degli Amidei (Amideus, † 1266); Ricoverino dei Lippi-Ugoccioni (Hugo, † 1282), Gheradino di Sostegno (Sosteneus, † 1282) und Alessio de’Falconieri (Alexius, † 1310). Nachdem sie ihre Familien versorgt hatten, verließen sie diese, verschenkten ihren übrigen Besitz und lebten als „Diener Mariens“ (Ordo Servorum Mariae – daher der Name „Serviten“) fortan in einem einfachen Haus am Rande von Florenz. Schon bald schlossen sich ihnen gleichgesinnte Männer an. Sie lebten nach der Regel des Augustinus [28. 8.] und gaben sich eine schwarze Ordenstracht. Benedikt XI. bestätigte 1304 den Orden. 1888 wurden die sieben Servitengründer, „als ob es eine Person wäre“, von Leo XIII. heiliggesprochen, ein einmaliger Fall in der Kirchengeschichte. Bis zur Liturgiereform von 1969/70 war der 12. Februar ihr Gedenktag. (B)
Bonosus von Trier (4. Jh.–370) – Evermod von Ratzeburg (um 1100–1178) – Lukas Belludi (Lukas von Padua) (um 1200–1285)
18. Februar
Fra Angelico
Fra Angelico (zwischen 1386 und 1400–1455) wurde als Guido di Pietro in Vicchio bei Florenz geboren. Er war bereits vor 1418 Maler und trat vor 1423 dem Dominikanerorden bei. Er lebte längere Zeit im Kloster San Marco, das er mit vielen Fresken ausmalte. Obwohl sein eigentlicher Ordensname Johannes war, wurde er wegen seines künstlerischen Schaffens bald „Il beato Angelico“ genannt. Er war einer der bedeutendsten Maler der italienischen Frührenaissance. Papst Johannes Paul II. [22.10.]sprach ihn 1982 selig. (H)
Constantia (um 320–354)
19. Februar
Bonifatius von Lausanne
Bonifatius (um 1182–1261) wurde in Brüssel geboren und studierte in Paris. 1216 wurde er Dekan in Brüssel, dann Domscholastiker in Köln. 1231 wurde er Bischof von Lausanne. 1238 musste er wegen Widerständen in seinem Bistum gegen ihn nach Rom fliehen, wo er 1239 auf sein Amt verzichtete. 1243 kehrte er in seine belgische Heimat als Weihbischof zurück und lebte bei den Zisterzienserinnen in La Cambre (Ter Kameren/Maria Kammern). 1245 verkündete er im Auftrag des Papstes die Exkommunikation von Kaiser Friedrich II. (H)
Barbatus von Benevent (um 612–682) – Alvárus (Alvárez) von Zamora (von Córdoba) (14. Jh.–um 1430) – Elisabeth Picenardi (um 1428–1468)
20. Februar
Jacinta Marto
Jacinta Marto (1910–1920) war das jüngste der drei Kinder, denen 1917 in Fatima Maria erschienen ist [13. 5.]. Im Dezember 1918 erkrankte sie zusammen mit ihrem Bruder Francisco an der sogenannten Spanischen Grippe, erholte sich jedoch wieder. Im Januar 1920 wurde sie nach Lissabon ins Krankenhaus gebracht, um sie wegen einer eitrigen Rippenfellentzündung zu operieren. Dort starb sie nach langer, schmerzhafter Krankheit. Ihr eigenes Schicksal hat sie verschiedentlich gegenüber ihrer Kusine Lucia vorausgesagt; sie prophezeite auch den Tod eines Arztes, der sie behandelte. Ihre letzte Ruhestätte fand sie zusammen mit ihrem Bruder Francisco 1951 in der alten Basilika von Fatima. (H)
Falko von Tongern (5. Jh.–um 512) – Eleutherius von Tournai (455–530) – Eucherius von Orléans (um 694–738)
21. Februar
Petrus Damiani
Der Kirchenlehrer Petrus Damiani (1007–1072) war einer der großen Reformer der Kirche im Mittelalter. Er stammte aus Ravenna. Nach einer harten Jugend wurde er 1035 Eremitenmönch und erneuerte die Ordnung für die Eremitenkongregationen. 1057 wurde er gegen seinen Willen zum Kardinal-Bischof von Ostia erhoben. Er setzte sich für eine vom Staat unabhängige Kirche ein und kämpfte gegen die Simonie (Erkaufen geistlicher Ämter) und den Sittenverfall des Klerus. Gleichzeitig war er einer der produktivsten Schriftsteller des Mittelalters und hinterließ ein umfangreiches Werk theologischer Schriften. Er wird als Heiliger verehrt, obwohl eine offizielle Heiligsprechung niemals stattgefunden hat. Leo XII. erhob ihn 1828 zum Kirchenlehrer. Bis zur Liturgiereform von 1969/70 war der 23. Februar sein Gedenktag. (B)
Germanus von Münster-Granfelden und Randoald von Granfelden (um 610–675) – Eleonore von England (1222–1291) – Robert Southwell (um 1561–1595) – Natalis Pinot (1747–1794) – Maria Enrica Dominici (1829–1894)
22. Februar
Petri Stuhlfeier (Cathedra Petri)
Dieser Gedenktag ist in Rom seit dem 4. Jh. bekannt und erinnert an die Berufung des Apostels Petrus [29. 6.] und seine Übernahme des römischen Bischofsstuhles. Ursprünglich gab es zwei Festtage dafür, nämlich neben dem 22. Februar zusätzlich den 18. Januar. Jedoch legte Papst Johannes XXIII. [3. 6.] den 22. Februar als einzigen fest. Dieser Tag ist im bäuerlichen Leben auch als sog. Lostag („Bauernregeln“) bekannt (z. B. „Die Nacht zu Petri Stuhl zeigt an, was wir noch vierzig Tag für Wetter han“). (H)
Papias von Hierapolis (um 70–nach 130) – Maximianus von Ravenna (um 500–556) – Elisabeth (Isabella) von Frankreich (1225–1270) – Margareta von Cortona (1247–1297)
23. Februar
Polykarp von Smyrna
Polykarp (um 70–155/56) zählt zu den Apostolischen Vätern und ist der letzte Zeuge aus apostolischer Zeit. Er gilt als Schüler des Apostels Johannes [27. 12.] und war Bischof von Smyrna (Izmir). Als eine der führenden Gestalten der wachsenden Großkirche im Kleinasien des 2. Jhs. verhandelte er mit dem römischen Bischof Anicet um die Festlegung des Ostertermins. Über den Märtyrertod des bereits Sechsundachtzigjährigen berichten die ältesten christlichen Märtyrerakten: Als er sich weigerte, Christus abzuschwören, sollte er verbrannt werden. Aber die Flammen des Scheiterhaufens konnten ihm nichts anhaben. So wurde er mit einem Dolch erstochen. Bis zur Liturgiereform von 1969/70 war der 26. Januar sein Gedenktag. (B)
Sirenus von Sirmium (3. Jh.–307) – Willigis von Mainz (10. Jh.–1011)
24. Februar
Matthias
Die Apostelgeschichte berichtet (1,15–26), dass Matthias („Geschenk Gottes“) durch Los anstelle von Judas Iskariot zum Apostel berufen wurde. Der Überlieferung zufolge missionierte Matthias zunächst in Judäa und später in verschiedenen heidnischen Gebieten bis nach Äthiopien. Über sein weiteres Leben gibt es keine genaueren Berichte. Er soll um das Jahr 63 den Tod erlitten haben, wobei es verschiedene Überlieferungen darüber gibt. Zu Beginn des 4. Jhs. sollen die Gebeine des Apostels durch den Trierer Bischof Agritius im Auftrag der Kaiserin Helena [18. 8.] als Geschenk nach Trier gebracht worden sein. Seit 1127 werden sie in der dortigen Basilika der Benediktiner-
abtei St. Matthias verehrt, z. B. auch durch traditionelle Matthias-Wallfahrten, die von Matthias-Bruderschaften durchgeführt werden. Bei der Liturgiereform 1969/70 wurde der Festtag auf den 14. Mai verlegt, wird aber im deutschen Sprachraum weiter am 24. Februar gefeiert. Das Matthiasgrab ist das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen. (S)
Modestus von Trier (5. Jh.–486)
25. Februar
Walburga
Walburga (um 710–779) ist eine besonders volkstümliche
Heilige. Ihre Eltern, das angelsächsische Königspaar Ri-
chard von Wessex und Wunna, ihre Brüder Willibald [7. 7.] und Wunibald [18. 12.] und ihr Onkel Bonifatius [5. 6.] werden ebenfalls als Heilige verehrt. Sie soll im Kloster Wimborne erzogen worden sein. 750 folgte Walburga dem Ruf des Bonifatius [5. 6.] als Glaubensbotin nach Deutschland. Zunächst lebte sie als Nonne im Benediktinerkloster Tauberbischofsheim. 761 übernahm sie nach dem Tode ihres Bruders Wunibald die Leitung des von ihm gegründeten Doppelklosters in Heidenheim. Ihre Glaubenskraft und mütterliche Ausstrahlung trugen viel zur Gewinnung der heidnischen Bevölkerung bei. So wurde diese klösterliche Gemeinschaft bald zu einem Mittelpunkt der christlichen Mission, einer Stätte der Bildung und der Sorge für die Menschen. Sie ist Patronin der Bauern und für das Gedeihen der Feldfrüchte. (B)
Cäsarius von Nazianz (4. Jh.–368) – Adeltrudis (Aldetrudis) von Maubeuge (7. Jh.–um 696) – Robert von Arbrissel (um 1045–1116) – Adelhelm (11. Jh.–1131) – Sebastian von der Erscheinung (ab Apparitio) (1502–1600) – Domenico Lentini (1770–1828) – Luigi Versiglia (1873–1930)
26. Februar
Edigna von Puch
Edigna (11. Jh.–1109) soll der Legende nach die Tochter von König Heinrich I. von Frankreich gewesen sein, die – um einer Ehe zu entgehen – geflohen und schließlich durch eine wundersame Fügung in den Ort Puch bei Fürstenfeldbruck (Bayern) gelangt ist. Dort lebte sie 35 Jahre als Einsiedlerin, war als Lehrerin für Lesen und Schreiben tätig, gab Ratschläge zur Viehhaltung und unterwies die Bevölkerung im christlichen Glauben. Sie war bereits zu ihren Lebzeiten hochverehrt. (H)
Hilarius von Mainz (2./3. Jh.) – Alexander von Alexandria (3. Jh.–328) – Dionysius von Augsburg (3./4. Jh.) – Gerlinde von Sponheim (12. Jh.)
27. Februar
Gabriel von der schmerzhaften Jungfrau
Gabriel (1838–1862) wurde als Francesco Possenti in Assisi geboren und von den Jesuiten in Spoleto erzogen. 1856 wurde er bei der Betrachtung eines Marienbildes gleichsam verwandelt, trat in den Passionistenorden ein und nahm den Ordensnamen Gabriel von der schmerzhaften Jungfrau an. Die Profess legte er 1857 ab und studierte dann Theologie und Philosophie. Er erhielt aber nur die sog. Niederen Weihen. Sein Leben war von großer Bußfertigkeit und von der Marienverehrung gekennzeichnet. Er starb in Isola del Gran Sasso. (H)
Baldomerus (Galmier) (um 600–um 655) – Anne Heigham Line (16. Jh.–1601)
28. Februar
Romanus und Lupicius
Romanus (5. Jh.–463/464) und Lupicius (5. Jh.– 480) waren Brüder. Sie gründeten das Kloster Condat, heute St-Claude, in Burgund. Zuerst war Romanus Abt, dann bekleidete Lupicius dieses Amt. (H)
Silvana (3. Jh.) – Sirin (Sira) (um 520–559) – Theodulf von Trier (6./7. Jh.)
29. Februar
(In Jahren ohne Schalttag werden die Gedenktage am 28. Februar begangen.)
Antonia von Florenz
Antonia (1401–1472) wurde in Florenz geboren und war ursprünglich in L’Aquila (Abruzzen) Terziarin der Zisterzienserinnen, deren Kloster sie 13 Jahre vorstand. Da ihr dieser Orden zu wenig streng erschien, gründete sie am selben Ort ein Klarissenkloster, dem sie ebenfalls sieben Jahre vorstand. Sie hatte schwere körperliche und seelische Beschwerden, die sie mit großer Geduld ertrug. (H)
Hilarius von Rom (5. Jh.–468) – Oswald von York und Worcester (10. Jh.–992) – August Chapdelaine (1814–1856)
Anna Katharina Emmerick - 9. Februar