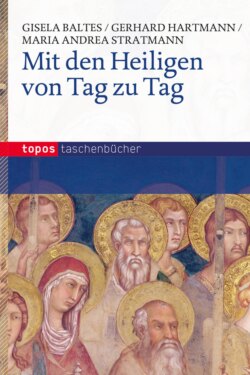Читать книгу Mit den Heiligen von Tag zu Tag - Gerhard Hartmann - Страница 9
ОглавлениеKarwoche und Ostern
Palmsonntag
Der Palmsonntag ist das Tor zur Karwoche, der „Heiligen Woche“, der Feier von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi, und erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem, über den alle vier Evangelisten berichten. In der Evangelischen Kirche wird dieser Sonntag in Anlehnung an die alten lateinischen Bezeichnungen der Sonntage „Palmarum“ genannt. Den Hosanna-Rufen der Menschen, die Jesu Einzug in die Heilige Stadt damals begleiteten, folgten bald schon die crucifige-Rufe („kreuzige ihn“) der Menge. Denn Jesus erfüllte nicht die Erwartungen derjenigen, die in ihm den politischen Befreier Israels sahen. Das Reich, das er errichtet und für das er bis zuletzt eintritt, ist nicht von dieser Welt. Etwa seit dem Jahr 400 gab es in Jerusalem den Brauch, am Nachmittag des Palmsonntags in feierlicher Prozession mit dem Bischof vom Ölberg in die Stadt zu ziehen. Im Mittelalter übernahm die Kirche des Westens den Brauch der Palmprozession vor der Eucharistiefeier dieses Tages. Die während der Prozession getragenen, gesegneten Palmzweige, oft auch andere Zweige, werden dann mitgenommen und in den Wohnungen aufgesteckt. Während in der Prozession mit geschmücktem Kreuz und dem Gesang von Lobliedern ein Bekenntnis zum Auferstandenen zum Ausdruck kommt, betonen die Lesungen des Tages, insbesondere die Passion (sie wechselt nach Lesejahr) stärker das Leiden und Sterben Jesu. (S)
Gründonnerstag
Mit dem Abend des Gründonnerstages oder Hohen Donnerstages beginnt das Gedächtnis von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Der Name Gründonnerstag geht wahrscheinlich auf das mittelhochdeutsche Wort gronan (weinen) zurück (vgl. greinen, grienen). Dahinter steht die Bußpraxis der römischen Kirche, nach der die Bußzeit für öffentliche Büßer, auch Weinende genannt, mit dem Gründonnerstag endete und sie wieder in die volle Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wurden. In der hl. Messe am Abend steht das Letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Tod im Mittelpunkt. Jesus gibt dabei durch die Deutung von Brot und Wein als seinen Leib und sein Blut dem Mahl einen neuen Sinn. An der Stelle, wo die Synoptiker das Abendmahlsgeschehen berichten, spricht Johannes von der Fußwaschung. Daher wird in manchen Gottesdiensten an diesem Abend auch eine Fußwaschung vorgenommen. Diese wurde – von der Liturgie losgelöst – bis 1918 auch von den Habsburger-Kaisern vorgenommen. Nach dem Gloria des Abendmahlsgottesdienstes verstummen die Glocken und die Orgel bis zur Feier der Osternacht. Der Legende nach „fliegen die Glocken nach Rom“. An ihrer Stelle ertönen am Karfreitag und Karsamstag zum Morgen, Mittag und Abend Geräusche aus Holzvorrichtungen – je nach den Bräuchen in den verschiedenen Gegenden (z. B. sog. „Ratsch’n“). Vom Altar wird aller Schmuck entfernt, und die konsekrierten Hostien werden zu einem Nebenaltar getragen. (S)
Karfreitag
Der Karfreitag steht ganz im Zeichen des Kreuzes. Die Trauer um den gekreuzigten Herrn (althochdeutsch kara = Trauer, Klage) hat dem Karfreitag wie auch dem Karsamstag und der ganzen Karwoche den Namen gegeben. Zur Zeit der Todesstunde Jesu, um 15 Uhr, versammelt sich die Gemeinde zu einem Gottesdienst. Die Karfreitagsliturgie beginnt in aller Stille. Vor dem Altar auf dem Boden ausgestreckt, verharrt der Priester zunächst in schweigendem Gebet. Dieser Tag kennt keine Eucharistiefeier. Die drei Abschnitte des Gottesdienstes bestehen aus dem Wortgottesdienst mit der Johannespassion sowie den Großen Fürbitten für die Anliegen von Kirche und Welt, der Verehrung des Kreuzes durch alle am Gottesdienst Teilnehmenden und der Kommunionfeier als Verbindung der Gläubigen mit Jesus Christus im Sakrament seiner Liebe. (S)
Karsamstag
Als Tag der Grabesruhe Jesu hat der Karsamstag keine Eucharistiefeier. Ursprünglich wurde dieser Tag als Fasttag gehalten. Bis ins 5. Jh. begann man um Mitternacht mit der Auferstehungsfeier, die bis in den Morgen dauerte. Später wurde die Feier der Osternacht immer weiter vorverlegt, bis sie schon am Morgen des Karsamstags stattfand. 1955 wurde unter Pius XII. die alte Ordnung wieder eingeführt. Als richtige Zeit dafür gilt der Abend nach Einbruch der Dämmerung oder in der Frühe des Ostersonntags vor dem Morgengrauen. In alpinen Gegenden hat sich am Karsams-
tag seit langem der Brauch der sog. Fleischsegnung eingebürgert. Es werden in die Kirche jene Speisen und Getränke (Wein) gebracht, die vornehmlich nach der Feier der Osternacht bzw. am Ostersonntag verzehrt werden. (S)
Die Feier der Osternacht
Die Feier der Osternacht ist der Höhepunkt des österlichen Triduums. Nach ältester Überlieferung ist sie eine Zeit des Wachens (vigilia) und Betens in Trauer um den Gekreuzig-
ten und in der Erwartung seines sieghaften Kommens. Woher die deutsche Bezeichnung Ostern kommt, ist unklar. Vermutlich steht dahinter eine falsche Übersetzung des lateinischen hebdomada in albis (= Woche in weißen Kleidern), wobei man in albis als Plural von alba (= Morgenröte) verstand und es mit dem althochdeutschen eostarum übersetzte. Die Osternachtfeier hat eine klare Grundstruktur: Auf die Lichtfeier folgt der Wortgottesdienst, danach die Tauffeier und die Eucharistiefeier.
Mit der Lichtfeier wird die Feier der Osternacht eröffnet. Nach Beginn der Abenddämmerung am Karsamstag oder bevor der Morgen des Ostersonntags dämmert, wird vor der Kirche ein Holzfeuer angezündet. Das Feuer wird gesegnet, und die Osterkerze, Symbol für Christus, wird an diesem neuen Feuer angezündet. Mit einem Griffel zeichnet der Zelebrant ein Kreuz und den ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets, das Alpha und das Omega, sowie die jeweilige Jahreszahl in die Kerze. Mit dem dreimaligen Ruf Lumen Christi – deo gratias zieht die Gemeinde mit dem Osterlicht in die dunkle Kirche ein. Der österliche Jubelruf des Exultet ist ein kunstvoll gestalteter Lobpreis der Heilstaten Gottes, wie er sie in der Geschichte des Heils, besonders aber in Jesus Christus, an uns erwiesen hat.
Der Wortgottesdienst beginnt mit der Lesung des ersten Schöpfungsberichts, mündet in die Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer und endet mit dem Osterevangelium, dem jeweiligen Lesejahr entsprechend.
Dann folgt die Tauffeier. Seit dem Ende des 3. Jhs. wird die Osternacht als Tauftermin bevorzugt. Sie ermöglicht erwachsenen Taufbewerbern – nach einer längeren Zeit der Vorbereitung –, nun auch an der Eucharistiefeier in dieser Nacht voll teilzunehmen. Wo keine Taufe stattfindet, wird nur das (Tauf-)Wasser gesegnet, und die Gläubigen erneuern mit brennenden Kerzen in den Händen ihr Taufversprechen. Anschließend segnet der Priester sie mit dem neugeweihten Wasser.
Die Eucharistiefeier dieser Nacht ist ganz erfüllt vom frohen Jubel über den Sieg Jesu Christi über Sünde und Tod. Das frohe Osterhalleluja erklingt nach den langen Fastenwochen ganz neu. Mit dem Gloria setzen Orgel und Glocken wieder ein. (S)
Erster Sonntag nach Ostern – „Weißer Sonntag“
Der „Weiße Sonntag“ – dominica in albis – erinnert an den Brauch der frühen Kirche, dass die in der Osternacht Getauften eine Woche lang ihre weißen Taufkleider trugen. Die Osteroktav diente dazu, sie tiefer in die Heilsgeheimnisse der Sakramente einzuführen. Diese „Weiße Woche“, die ganz im Zeichen der Neugetauften stand, wurde so zugleich für die Gemeinde zu einer Erinnerung an die eigene Taufe und zur Besinnung auf das eigene Christsein. Die gemeinsame Erstkommunionfeier, wie wir sie heute vornehmlich in Deutschland vielerorts am „Weißen Sonntag“ kennen, bildete sich im 18. Jh. heraus. Die Kinder empfangen an diesem Tag nicht nur zum ersten Mal die Kommunion, sie werden auch in einem feierlichen Gottesdienst in die Mahlgemeinschaft der Gemeinde voll integriert. (S)
Zweiter Sonntag der Osterzeit – Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit
Papst Johannes Paul II. [22. 10.] hat im Jahr 2000 den zweiten Sonntag der Osterzeit unter den Gedanken „Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit“ gestellt. Er will damit die Barmherzigkeit Gottes als zentralen Aspekt der göttlichen Liebe zu uns Menschen stärker bewusst machen. Die Nähe zum Osterfest verdeutlicht, dass Gott allen Menschen Anteil geben will an der Erlösung durch Jesus Christus. Wenn Gott nur heilig und gerecht wäre, wer könnte dann vor ihm bestehen? Die barmherzige Liebe Gottes aber lässt uns hoffen, dass Gott uns immer wieder einen Neuanfang schenken will, wenn wir selbst dazu bereit sind. (S)