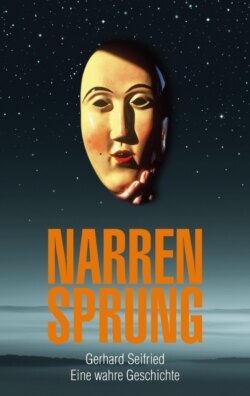Читать книгу NarrenSprung - Gerhard Seifried - Страница 4
2
ОглавлениеFür die Familie Seifried hatten sich die ersten Monate des laufenden Jahres 1948 gut angelassen. Von der Schömberger Sparkasse war die lang ersehnte Nachricht gekommen, dass Josef Seifrieds Beamtengehalt schon bald wieder überwiesen werde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte keiner gewusst, wovon man in der nächsten Zeit leben sollte und ob Josef Seifried überhaupt noch als Zollbeamter im Dienst war. Die Zeiten waren zwar immer noch recht lausig, es gab fast nichts zu kaufen, aber so schrecklich wie unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges, insbesondere im trostlosen Hungerjahr 1946, ging es nicht mehr zu. Als Nichtbauern hatten die Seifrieds in den zwei Jahren nach dem Krieg, in denen es ums pure Überleben ging, recht wenig zu lachen und noch weniger zu essen. Auch sie mussten sich mit Hamsterfahrten in die benachbarten Dörfer durchschlagen, und diverser Hausrat, aber auch einige der wenigen Schmuckstücke im Familienbesitz wechselten im Tausch gegen einen Sack Kartoffeln, einige Kilo Mehl oder ein paar Eier den Besitzer. Die Tauschbedingungen waren nicht immer fair, sie wurden diktiert von denen, die über das knappe Gut Lebensmittel verfügten. Am wenigsten kam meine Mutter mit dem Geschäftsgebaren einiger Bauern klar.
„Ich weiß ja“, sagte sie, „Geschäft ist Geschäft, aber Mensch ist Mensch“, und schüttelte dazu den Kopf.
Dass Josef Seifried ein geschickter Hufschmied war, wusste in Schömberg praktisch jeder. Als Vollwaise aufgewachsen, steckte ihn sein damaliger Vormund nach der Volksschule ohne viel Aufhebens zu einem Schmied in der Nähe von Karlsruhe in die Lehre. In jungen Jahren hatte Josef diesen Beruf so lange ausgeübt, bis der Erste Weltkrieg begann und er sich als Freiwilliger zum Kriegsdienst meldete.
Leider gab es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Schömberg nur noch drei Pferde, alle anderen hatte die Deutsche Wehrmacht zwischen 1939 und 1943 als kriegswichtig eingezogen. Das war natürlich Pech für meinen Vater, der mit seinem erlernten Handwerksberuf in dieser schwierigen Zeit bei den Bauern kaum etwas dazuverdienen konnte.
Eine Chance, an Lebensmittel zu kommen, bot sich unserer Familie durch Tagelöhnerarbeit bei einzelnen Bauern. Vor allem in der Erntezeit waren Arbeitskräfte knapp, und als kräftiger junger Mann Jahrgang 1929 musste mein älterer Bruder Rudi nicht lange fragen — er war in Schömberg durchweg beliebt, und jeder wusste, dass er zulangen konnte. Was er heimbrachte, konnte sich denn auch in aller Regel sehen lassen, da ließen sich die Schömberger nicht lumpen.
Bei allem Organisationstalent, das die Beamtenfamilie Seifried in dieser Krisenzeit an den Tag legte, wäre sie trotzdem kaum über die Runden gekommen, wenn ihr nicht zuweilen nette Nachbarn ein paar Eier, einen Liter frische Kuh- oder Geißenmilch oder gar ein Stück geräucherten Speck zugesteckt hätten. Das alte Bauernhaus an der B 27, das sie in Miete bewohnten, war zwar riesig, außer einem winzigen Kräutergärtchen an der Stirnseite des Hauses bot es jedoch keine weiteren Möglichkeiten, irgendetwas Essbares anzubauen.
Geld befand sich in der Nachkriegszeit ausreichend unter den Leuten — Hitler hatte schließlich eine Menge davon drucken lassen - leider war die alte Reichsmark aber nichts wert. Kein Bauer ließ sich dazu überreden, dafür auch nur ein paar Kartoffeln rauszurücken - es sei denn, diese waren genauso wenig wert, weil sie getrieben oder infolge der Kälte eine blaugrüne Farbe angenommen hatten und somit kaum genießbar waren. Dass man mit der alten Reichsmark so wenig anfangen konnte, empfand man in meiner Familie als doppelt schade, denn davon gab es im Haus überreichlich. Das hatte nichts mit dem Salär des Josef Seifried zu tun, das für einen Beamten im Rang eines Zollsekretärs recht bescheiden war. Nein, den Reichsmark-Segen im Hause hatten wir Onkel Christof zu verdanken. Er sammelte die gute alte Reichsmark, nicht nur die kleinen Scheine, nein, er berauschte sich auch an den großen Banknoten, die schon gegen Kriegsende und natürlich noch mehr danach günstig zu haben waren. Eine Million, zwei Millionen? Die Geldsumme, die er gegen Wertgegenstände eintauschte, konnte sich sehen lassen, und garantiert war er auf dem Papier längst ein stinkreicher Mann. Er versteckte das Geld überall, auch bei uns auf dem weitläufigen Speicher unseres Bauernhauses, und wenn man ihn fragte, was er denn damit vorhabe, dann schmunzelte er geheimnisvoll und sagte, er habe so seine Pläne. Der kleine Mann mit Nickelbrille und blauem Siegelring am rechten Mittelfinger galt als intelligent, allerdings mit kauzigem Einschlag. Man ließ ihn gewähren.
Nicht nur als Sammler von Reichsmarknoten, auch als Tüftler und Erfinder wurde Onkel Christof auffällig. Diverse seiner Erfindungen waren sicherlich ihrer Zeit voraus oder erfuhren einfach nicht die ihnen gebührende Wertschätzung. Volle Anerkennung zollte mein Vater, ein starker Pfeifenraucher, seinerzeit allerdings der technisch perfekten, halbautomatischen Tabakblätterschneidemaschine, die Onkel Christof anlässlich eines Besuches im Sommer 1947 als fix und fertigen Prototyp mitbrachte. Nicht nur die Technik der Maschine, auch die kaufmännische Idee, die dahintersteckte, war überzeugend: Mangels anderer Beschaffungsmöglichkeiten hatten sich in der Nachkriegszeit Millionen deutscher Pfeifenraucher in ihrem Schrebergarten oder notfalls auf dem Balkon eine Mini-Tabakplantage eingerichtet. Jeder davon — allein in Schömberg waren es mehrere hundert — kam deshalb als Käufer für die Christof’sche Wundermaschine in Frage. Leider erwiesen sich derlei Spekulationen wieder einmal als blanke Theorie.
Eine Umfrage im Testmarkt Schömberg brachte es denn auch zweifelsfrei an den Tag: Die Tabakblätterschneidemaschine von Onkel Christof war viel zu teuer. Pfeifenraucher in Schömberg schärften lieber das große Küchenmesser und schnippelten sich ihre Mixtur von Hand zurecht — „alles Banausen“, wie Onkel Christof knurrte. So ging der Prototyp dieser Monsterschneidemaschine mangels zahlungskräftiger Nachfrage zwar nie in Serie, kam aber immerhin im Hause Seifried zu Ehren und erfreute sich dort bei meinem Vater großer Beliebtheit.
Es gäbe noch viel zu erzählen über Onkel Christofs Emsigkeit im Austüfteln bahnbrechender Erfindungen, unter anderem seine im Anschluss an einen stürmischen Wirtshausabend gemachte Erfindung einer seitenwindunempfindlichen Kopfbedeckung. Besondere Erwähnung verdient aber auf jeden Fall seine genial einfache, überaus menschenfreundliche Erfindung eines sogenannten Blähungsverhinderers. Mit einem kleinen Trichterröhrchen wollte er die Millionen Menschen, die an lästigen Darmblähungen litten, von ihrer Pein befreien. Dieses Röhrchen, gefertigt aus hautverträglichem Material, Länge 7 Zentimeter, konnte bei Bedarf unauffällig und vor allem unsichtbar am Darmausgang eingeführt werden und sorgte fortan für einen kontinuierlichen, absolut geräusch-, wenn auch nicht geruchlosen Abgang der überflüssigen Darmwinde.
Obwohl auch diese vielversprechende Erfindung leider kein Verkaufsschlager wurde („Kein Wunder,“ schimpfte Onkel Christof, „die Bauern hier furzen gern und laut“), unterstützte Tante Luise ihren Mann treu und brav bei all seinen Bemühungen, mit guten Ideen die schnelle Mark zu machen. Weil es damals ja noch minderwertige Reichsmark waren, wurde die sehr mangelhafte wirtschaftliche Verwertbarkeit des Erfindungsgeistes von Onkel Christof nicht so sehr tragisch genommen. „Er greift manchmal nach den Sternen“, pflegte Tante Luise zu ihrer Schwester Lioba zu sagen und lächelte milde dazu.
„Und manchmal greift er halt auch in Kuhscheiße“, nörgelte mein Vater, der immer mit halbem Ohr zuhörte. Es behagte ihm überhaupt nicht, dass er in Schömberg dank der Verkaufsaktivitäten seines Schwagers Christof monatelang bei allen möglichen und teilweise recht unpassenden Gelegenheiten scheinheilig auf seine persönlichen Erfahrungen mit dem „Blähungsverhinderungsrohr“ angesprochen wurde, für dessen Erprobung er sich in Verbindung mit einer garantierten fünfzehnprozentigen Erfolgsbeteiligung eine Woche als Testperson zur Verfügung gestellt hatte. Er musste auf seinen Ruf achten, schließlich war er hier in Schömberg einer der wenigen Beamten, somit eine Amtsperson, die man wegen der wahrzunehmenden hoheitlichen Aufgaben bei der Überprüfung aller Schnapsbrenner der Region in Bezug auf ihre Steuerehrlichkeit respektvoll den „Steuerwächter“ nannte.
So nach und nach zehrte die Serie von Onkel Christofs wirtschaftlich nicht ganz zufriedenstellenden Unternehmungen und Erfindungen nicht nur etwas an seiner ausgeglichenen, stets Optimismus ausstrahlenden Persönlichkeit, sondern — und das beunruhigte jetzt auch seine Gemahlin Luise — auch an seinem bescheidenen ererbten Wohlstand. Als kluger Kopf behielt er jedoch den Überblick und analysierte zunächst einmal die Situation.
„Siehst du, Josef“, erläuterte er seinem Schwager, der ihn insgeheim ob seiner Scharfsinnigkeit bewunderte, „bei den Leuten zählt halt nicht die Leistung, die man erbringt, sondern nur der Erfolg, den man erzielt.“
Er philosophierte noch eine Weile über diese Erkenntnis und leitete daraus kluge Folgerungen ab. Bei dieser Gelegenheit zog er auch etwas wehleidig Parallelen zu Leonardo da Vinci, dem wohl berühmtesten Erfinder und Universalgenie des Mittelalters, der bereits um 1500 herum heute so allgegenwärtige Vehikel wie Fahrrad, Auto und Flugmaschine ziemlich präzise angedacht und sogar konstruiert hatte, aber ebenfalls, wie Onkel Christof bei seinen Zeitgenossen, auf wenig Anerkennung oder gar auf totales Unverständnis gestoßen war.
Jedenfalls wollte er, Onkel Christof, von jetzt an ohne Umwege den direkten Erfolg suchen und somit auch automatisch die Anerkennung der Leute gewinnen. Erfindungen zu machen und auszuwerten erschien ihm jetzt plötzlich als Irrweg und reine Zeitvergeudung.
„Josef“, fragte er mit gedämpfter Stimme, „kann ich dir vertrauen?“
Sie waren allein, beide rauchten Pfeife und hatten einen Selbstgebrannten vor sich.
„Habe ich dich schon einmal enttäuscht?“
„Unsinn, aber weißt du, diesmal geht es um eine ganz große Sache, da kann verdammt viel für uns beide rausspringen...“
Er hob sein Glas und lächelte unwiderstehlich.
„Prost, alter Freund, auf ein gutes Geschäft!“
Josef kannte seinen Schwager. Nach der letzten Pleite mit dem Blährohr hatte er sich geschworen, Christofs Ideen ab sofort mit großer Vorsicht zu begegnen. Aber natürlich war er auch neugierig.
„Na ja“, sagte er bedächtig, „ein gutes Geschäft können wir alle gebrauchen. Kannst du mir mal genauer sagen, um was es geht?“
Jetzt war Christof in seinem Element.
„Die Sache ist absolut vertraulich“, sagte er. Seine Stimme war leise geworden und bekam einen verkäuferischen Unterton. „Ich habe da von höchster politischen Stelle Informationen erhalten. Das wird eine absolute Rakete. Bist du interessiert, ja oder nein?“
Es entstand eine längere Pause, in der Christof seinen Schwager fixierte. Schließlich nickte dieser wortlos mit dem Kopf.
„Dachte ich mir“, sagte Christof. „Ich wusste doch, du bist schlau genug, dir so eine Sache nicht entgehen zu lassen. Und du bist Gott sei Dank auch jemand, dem man vertrauen kann.“
Nachdem beide sich noch einige Male auf die Schultern geklopft hatten und die Schnapsflasche schon fast leer war, rückte Christof mit seinem Plan heraus. Er habe von einem verlässlichen Freund, der früher bei der Bank Deutscher Länder beschäftigt war und angeblich immer noch allerbeste Beziehungen zu Geldkreisen auch auf höchster politischen Ebene habe, ein hochbrisantes und topgeheimes Detail zu der noch im laufenden Jahr 1948 anstehenden Umstellung von Reichsmark auf die neue „Deutsche Mark“, abgekürzt D-Mark, erfahren. Onkel Christof zierte sich noch ein wenig, dann ließ er seine „Rakete“ steigen:
„Das Umtauschverhältnis Reichsmark zu D-Mark wird eins zu eins sein. Was sagst du nun?“
Josef war sprachlos, und Christof kam immer mehr in Fahrt. „Erfindungen sind Kokolores“, rief er, „diese Information wird uns reich machen.“ Und er musste Josef jetzt nicht mehr erzählen, wieso er seit gut einem Jahr alle Reichsmarkscheine, derer er habhaft werden konnte, in seinen Besitz gebracht hatte.
„Also Christof, wenn das stimmt.“, Josef war beeindruckt, insbesondere als ihm sein Schwager noch die Kopie einer dick mit „Streng vertraulich“ abgestempelten Gesprächsnotiz zeigte. Die Formulierung „Ersetzung der Reichsmark durch die D-Mark im Verhältnis eins zu eins“ war dort schwarz auf weiß zu lesen.
Christof erwies sich mal wieder als echter Freund, der auch anderen was gönnte. Dank seines Informationsvor-sprungs hatte er natürlich wesentlich mehr Reichsmark gehortet als sein Schwager, obwohl auch Josef von jetzt an die verbleibenden Monate gut nutzte, um seinen Bestand aufzubessern. Trotzdem versprach Christof ihm, den satten Gewinn nach dem Umtauschtag großzügig zu teilen, schließlich, so sagte er gönnerhaft, würde das auch für zwei reichen.
Die Währungsreform machte Fortschritte, und erst wenige Tage vor dem eigentlichen Umtausch sickerte auch bei weniger gut informierten Kreisen durch: Der Umtausch Reichsmark zu D-Mark wird im Verhältnis eins zu eins erfolgen.
Christof und Josef prosteten sich von dem Moment an nur noch zu und sortierten ihre riesigen Geldbündel. Dann kam die Einschränkung, die mächtig weh tat. Sie lautete wörtlich, und das war jetzt amtlich: „Am Währungsstichtag erhält jede natürliche Person vierzig D-Mark gegen Reichsmark im Verhältnis eins zu eins.“
Christof verfiel drei Tage in tiefe Depression. Er war mal wieder ganz nah dran gewesen, und schließlich hatte sich seine Information ja durchaus als wahr erwiesen. Eine Verschwörung.
Josef tauchte ein paar Tage unter, er war einfach nicht mehr da. Später sickerte durch, er sei bei einem der von ihm kontrollierten Schnapsbrenner in Deilingen ge-strandet.
Die beiden Damen des Hauses hatten natürlich alles haarklein mitbekommen. Sie sahen das Ganze noch am gelassensten.
„Stell dir vor, Luise, die beiden hätten wirklich soviel Geld kassiert. Ob das gut gegangen wäre?“
Und klammheimlich kicherten sie sogar und machten sich über ihre Finanzgenies lustig.