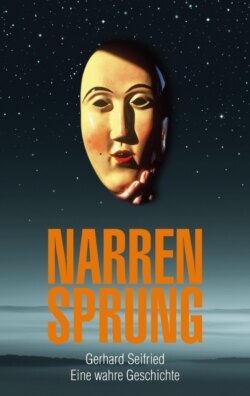Читать книгу NarrenSprung - Gerhard Seifried - Страница 5
3
ОглавлениеApril 1948, Osterferien. „Gehen wir zum Stausee, dort finden wir heute jede Menge Versteinerungen“, schlug ich meinen Kumpanen vor. Ein paar Tage zuvor waren heftige Regenschauer niedergegangen, es hatte dazu gestürmt, und bei solchem Wetter, das wusste jeder von uns, schwemmte das bewegte Wasser am linken Steilufer des Schömberger Stausees massenweise die für Schiefergesteine typischen dunklen Versteinerungen frei. Einige der Ammoniten hatten metallene Oberflächen und glänzten wie Gold. Ich erntete keine Begeisterungsstürme, heute war Faulsein angesagt. Wir lungerten alle im „Bunker“ herum und ließen uns die nach einem strammen Winter lang vermisste Frühlingssonne auf den Bauch scheinen. Alle, das waren neben mir noch Bernhard, der Stärkste und Älteste, Walter, der immer gern das letzte Wort hatte, dazu Dieter und Alfons und die blonde Gertrud, das Flüchtlingsmädchen, das seit letztem Sommer dazugehörte.
Gertrud war hübsch, mit gelbblonden Haaren, die schon von weitem leuchteten wie ein Weizenfeld im Sommer. Ich war insgeheim ein bisschen verliebt in sie. Selbst ihre Bewegungen waren irgendwie anders als bei den beileibe nicht hässlichen Schömberger Mädchen. Wenn man Gertrud anblickte, dann sah man zuallererst ihre großen blauen Augen. Sie zählte mit ihrer Mutter zu den sogenannten Einquartierungen, die 1945 und vor allem 1946, gleich nach dem Krieg, über Monate hinweg die Schömberger ganz schön auf Trab hielten. Einquartiert wurden ganze Familien, aber auch Einzelpersonen, die der Vormarsch der Roten Armee aus den deutschen Ostgebieten, vor allem aus Ostpreußen, vertrieben hatte. Für die Schömberger waren es eben „Flüchtlinge“, und dieses Wort hatte damals keinen guten Klang und bedeutete so etwas wie ein notwendiges Übel. Hinter vorgehaltener Hand sprachen die Leute schon auch mal von „Polacken“, die einem der verlorene Krieg beschert hatte, und das war natürlich gar nicht nett, denn diese Menschen — man sah es ihnen an -hatten eine schlimme Zeit hinter sich, und selbst die Kinder der Flüchtlinge hatten in den wenigen Monaten ihrer Vertreibung und Flucht zweifellos mehr mit ansehen und durchmachen müssen, als dies normalerweise einem Bewohner von Schömberg in seinem ganzen Leben passieren konnte.
Der Unmut in Schömberg rührte auch daher, dass bei Einquartierungen keinesfalls darauf gewartet wurde, ob sich etwa Besitzer von Häusern freiwillig meldeten, um Platz zur Verfügung zu stellen, nein, die Flüchtlinge wurden mir nichts dir nichts zwangseinquartiert, das heißt, das Gemeindeamt legte nach kaum nachvollziehbaren Regeln fest, wer in seinem Haus enger zusammenzurücken hatte für einen oder mehrere „Ostpreußen“. Es war eine vorübergehende Notmaßnahme, wie es hieß, ein sogenanntes Provisorium, und manche Schömberger mussten erfahren, wie lange so ein Provisorium tatsächlich dauern kann.
Gertrud gehörte zu den Flüchtlingen, denen es besonders schwerfiel, sich in Schömberg zurechtzufinden. Sie redete anfangs kaum und bewegte sich auch in der Schule so unauffällig, dass man sie fast gar nicht wahrnahm. „Ach ja, dat Kind hat ne janze Menge mitje-macht“, pflegte Gertruds Mutter zu sagen und zog ihr Töchterchen an sich.
Einige der Flüchtlinge verschwanden schon bald wieder, andere blieben länger, und ganz wenige wurden in Schömberg sesshaft und erlangten mit der Zeit Anerkennung. Es wurde ihnen dafür mehr Fleiß, Leistung und Standvermögen abverlangt, als dies bei den Einheimischen üblich war. Die fremde Sprache verlor sich allerdings nie ganz, und genau genommen blieb ein Flüchtling in Schömberg immer ein Flüchtling.
Gertrud und ihre Mutter blieben da. Die Mutter war fleißig, sie konnte gut nähen und fand eine Dauerbeschäftigung beim „Rager“, in der Trikotagenfabrik. Gertrud taute so nach und nach etwas auf, insbesondere nachdem sie mit ihrer Mutter Anfang 1948 eine eigene kleine Etagenwohnung auf dem Flügel bezogen hatte. Ein typisches Schömberger Mädchen wollte sie aber offensichtlich nicht sein, vielleicht fand sie auch nur nicht die passenden Freundinnen. Irgendwann im Sommer 1947 jedenfalls begann sie, ihr Interesse für die in etwa gleichaltrigen Jungen von der Flügelbande zu zeigen, vielleicht deshalb, weil sie deren raue Spiele und Drang nach Abenteuern mehr schätzte als Puppenspielen und Häkeln.
Zunächst wurde Gertrud ganz einfach ignoriert, wenn sie anscheinend gelangweilt und immer etwas unbeteiligt da auftauchte, wo sich auch die Flügelbande gerade aufhielt. Irgendwann hatten es die Jungen aber satt. Sie fürchteten, Gertrud könnte zum Beispiel herausfinden, dass sie sich sehr häufig in ihrem Bunker auf der Sägerei aufhielten - was verboten war -, dass sie sich sogar manchmal nachts trafen und heimlich rauchten und einiges mehr unternahmen, was nur sie etwas anging. „Man könnte sie einfangen und im Bunker martern,“ regte Walter an. Obwohl das natürlich eine verlockende Aussicht war, trauten sich die Jungen das ganz einfach nicht, weil Gertruds flotte Mutter inzwischen mit dem Xaver Faulhaber liiert war, der als recht jähzornig galt, und man schließlich nicht wissen konnte, wie er darauf reagierte, wenn das Töchterchen seiner Freundin zerzaust und heulend daheim auftauchen und Schauergeschichten erzählen würde.
Gertrud war zäh, und deshalb erreichte sie irgendwann, was sie wollte. Vielleicht hing es ja auch mit ihrem MIR zusammen. So nannte Gertrud den sehr schönen, etwa 4 Zentimeter breiten, flach geformten Rosenquarz-Halbedelstein, den sie immer, nahezu unsichtbar in die linke Hand geschmiegt, bei sich trug.
Wenn man sie nach dem MIR fragte, antwortete sie etwas einsilbig, dies sei ein ganz besonderer, schon viele Millionen Jahre alter Stein, den sie von ihrem im Russlandfeldzug vermissten Vater erhalten habe. Er würde ihr bei allem helfen, was auch immer passiere, und außerdem besitze ihr Vater den gleichen Stein, so dass sie auf diese Weise immer mit ihm verbunden sei. Wahrscheinlich hatte der MIR auch dafür gesorgt, dass Bernhard ihr an einem Nachmittag so ganz nebenbei erzählte, dass Mitglied der Flügelbande nur werden könne, wer in aufrechter Position in der Lage sei, mindestens zwei Meter weit zu pinkeln. Jedes andere Schömberger Mädchen hätte sich in dieser Situation kichernd aus dem Staub gemacht, nicht Gertrud.
„Mal sehen“, sagte sie kurz und trottete Bernhard hinterher.
Wir anderen hatten gegen diese Aufnahmeprüfung nichts einzuwenden, es wurde sofort ein geeigneter Platz auf der Sägerei ausgesucht. Gertrud pinkelte. Sie stellte sich dabei auf einen Bretterstapel, schob das Becken vor, drückte dann mit dem linken Zeigefinger (Gertrud war Linkshänderin) auf einen bestimmten Punkt zwischen den Beinen und - ssst - ein dünner Strahl schoss durch die Luft. Walter maß sofort nach - heilige Mutter Gottes, sie hatte trotz anatomischer Benachteiligung die zwei Meter geschafft. Na gut, das mit dem Bretterstapel war etwas geschummelt, aber alle waren sehr beeindruckt von der Vorstellung. Gertrud gehörte ab sofort dazu. Schließlich hatte eine weibliche Spielgefährtin im bigotten Schömberg auch Vorteile, man konnte sich mit einem gelegentlichen Blick unter Gertruds großen geblümten Rock von der weiblichen Anatomie einen Eindruck verschaffen, und in dieser Hinsicht zeigte sich das neue Bandenmitglied auch durchaus großzügig.
Der Bunker auf der alten Sägerei war der Ort, an dem sich die Flügelbande fast jeden Tag einmal traf. Man fühlte sich dort unbeobachtet und sicher und einfach gut. Mehr durch Zufall, bei einem unserer Streifzüge über das ausgedehnte Gelände der Sägerei, hatten wir den Bunker entdeckt. Natürlich war es kein echter Bunker aus Beton, denn auf der Sägerei - wie hätte das auch anders sein können - gab es nur Holz, dies aber in riesigen Mengen, das meiste davon als breite, 5 bis 10 Zentimeter dicke Holzscheiben, bis zu 3 Meter hoch gestapelt. Am äußersten Ende des Sägereigeländes, da, wo es sehr eng zuging und Holzstapel neben Holzstapel zum Austrocknen gelagert waren, hatten die Arbeiter wahrscheinlich aus Versehen vier der Stapel jeweils so im rechten Winkel zueinander gestellt, dass sich ein viereckiger Turm ergab mit fast 3 Meter hohen und etwa 70 Zentimeter dicken Holzmauern und einem recht geräumigen Innenraum von etwa 4 mal 4 Metern. Für uns war es „der Bunker“. Wir hatten sofort erkannt, was man alles damit anfangen konnte, und machten den Bunker „bewohnbar“, mit einem Ausguck ganz oben und versteckt angebrachten Bretterstufen, die bei Gefahr von innen eingezogen werden konnten. Der Innenraum ließ sich sogar mit einer alten Wagenplane, die Alfons bei seinem Vater „ausgeliehen“ hatte, wetterfest machen, kurzum, der Bunker war ein fantastischer Unterschlupf, nahezu unangreifbar, und - das Allerwichtigste - außer der Flügelbande wusste niemand von seiner Existenz.
Es war fast schon ein Ritual: Irgendwann begann Alfons die Literflasche mit sechsprozentigem Most kreisen zu lassen, einem Teufelszeug, das auch manch trinkfestem Erwachsenen schon mächtig zugesetzt hatte. Bernhard nahm einen kräftigen Schluck, dazu rülpste er betont männlich. Seine Erfahrungen mit einem ausgewachsenen Rausch und den Folgen waren noch frisch: Erst wenige Tage zuvor hatte die Bande im Bunker Dieters Geburtstag gefeiert, mit zwei statt wie üblich einer Flasche Most und dazu einigen Apfelsinen, für damalige Zeiten eine wahre Rarität, die man dem großem Bruder von Alfons zu verdanken hatte, der als Techniker in Nordafrika arbeitete. Außerdem gab es noch ein solides Stück Speck, das Walter seiner Mutter abgeluchst hatte. Mein Mitbringsel war ein Stück von einem Weichgummischlauch, etwas, was für die Flügelbande einen enormen Wert besaß, weil sich damit hervorragende Steinschleudern herstellen ließen. Von Gertrud kam eine Flagge aus Stoff, tiefblau, mit einem roten Pfeil diagonal nach oben gerichtet, dazu das Wort „Flügel“ und die sechs Initialen A, B, D, G, G, W in goldgelb. Die Flagge sah toll aus - Gertruds Mutter hatte ein Meisterstück geliefert - sie wurde sofort seitlich an einer Bunkerinnenwand befestigt, und jeder sagte, dass es genau das war, was noch gefehlt hatte.
Zu fortgeschrittener Stunde hieß es dann wie immer: „Gerhard, spiel uns was“, und ich zog meine Hohner-Mundharmonika Marke „Unsere Lieblinge“ heraus und spielte mit viel Tremolo das Lied von Lili Marleen, so wie es Lale Andersen mit ihrer einmaligen, tiefen Stimme für Landser aller Nationalitäten gesungen hatte. Eigentlich ein sehr melancholisches Stück, aber schließlich war der Krieg noch nicht lange vorbei, und lustige Lieder hatte man in den zurückliegenden Jahren in Schömberg mit seinen vielen Gefallenen und Vermissten recht wenige gehört. Melancholisch oder nicht, alle summten mit, und dazu gab es an diesem Tag noch ein wichtiges Thema: Die Rathausbande. Es hatte mal wieder massiv Ärger mit diesen schlimmen Kerlen gegeben. Sie waren alle ein bis zwei Jahre älter als meine Freunde und ich. Ihr grobschlächtiger Anführer, der Hasen-Karle, hatte den Ruf, dass er seinen Mut am liebsten bei deutlich Schwächeren unter Beweis stellte. Und seit Wochen -dafür gab es klare Anzeichen und Beweise - ging die Stoßrichtung dieser hinterhältigen Burschen in Richtung Flügelbande. Es war klar: Auf Dauer konnte man sich in dem kleinen Städtchen, in dem sich vieles auf den Straßen beziehungsweise im Freien abspielte, nicht aus dem Weg gehen. Es würde also irgendwann kra-
chen, und darauf musste man vorbereitet sein.
„Ganz klar“, sagte Bernhard, dessen Worten bei so wichtigen Dingen große Bedeutung beigemessen wurde „die müssen was aufs Dach kriegen, damit ihnen die Lust an so was gründlich vergeht.“
„So was“, das bezog sich auf den Nachmittag vor zwei Tagen. Die sechs von der Flügelbande waren im Fuchstälchen, einer bewaldeten tiefen Kerbe etwas außerhalb von Schömberg Richtung Dautmagen, „auf die Pirsch“ gegangen. In dem gar nicht so kleinen Tälchen mit seinen steil abfallenden Hängen an beiden Seiten gab es massenhaft Füchse, die sich während des Krieges, in dem sie über Jahre hinweg kaum bejagt wurden, ungestört hatten vermehren können. „Die Pirsch“ bestand darin, Fuchsbauten aufzuspüren, dann mit gewaltigem Getöse und Klappern die Füchse aus ihrem Bau herauszutreiben und zu versuchen, sie mit Lassos einzufangen
- was natürlich nie gelang, weil sich die mächtig flinken Füchse jedes Mal blitzschnell aus dem Staub machten. Dass es nie klappte war egal, Hauptsache, man hatte wenigstens einen Fuchs gescheucht und seinen Spaß gehabt. Natürlich war es verboten, auf diese Weise „auf Fuchsjagd“ zu gehen. Genaugenommen war es wohl das, was am meisten daran reizte.
An jenem Nachmittag im Fuchstälchen zischten plötzlich kleine Steine wie Geschosse durch die Luft. Das Geräusch war allen nur zu gut bekannt, das waren Steinschleudern. Alle stoben auseinander. Die kleinen, enorm schnellen Kiesel waren verdammt gefährlich. Ein hämisches Lachen, am Steilhang im Gebüsch knackten Äste, und man konnte noch einige Gestalten verschwinden sehen. Keine Frage, die Rathausbande hatte feige aus sicherem Hinterhalt zugeschlagen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Bernhard hatte es erwischt. Er saß benommen auf dem Boden, die Hand seitlich am Kopf, und zwischen den Fingern rieselte Blut herunter. Die Platzwunde seitlich an der Schläfe war nicht zu übersehen.
Alle stimmten Bernhard zu, dass etwas geschehen müsse.
„Auf eine Prügelei können wir es nicht ankommen lassen“, meinte Walter. „Die sind in der Überzahl, und Schwächlinge sind das auch nicht.“
„Man könnte versuchen, sie einzeln zu erwischen, einen nach dem anderen, dann haben die erst mal genug.“ Bernhard hatte einen Sinn für praktische Lösungen.
„Das schaffen wir bei einem oder, wenn’s gut geht, auch bei zwei. Von da an sind sie gewarnt und lassen sich nur noch zusammen blicken.“ Alle gaben Dieter recht, schließlich hatte er auch Geburtstag.
Bei dem Gedanken, dass die komplette Rathausbande plötzlich vor ihrem Bunker auftauchen könnte, war es allen doch mulmig geworden. Unwillkürlich schaute jeder durch die schmalen Sehschlitze zwischen den einzelnen Holzdielen des Bunkers. Gott sei Dank, nichts zu bemerken. Trotzdem, ab sofort würde man leiser
sein, man konnte ja nie wissen.
„Gertrud, was meinst du, wie hätten deine Freunde in Ostpreußen das gemacht?“, wollte ich jetzt wissen.
Gertrud hatte die ganze Zeit mit gerunzelter Stirn dagesessen. Sie bewegte unaufhörlich ihren MIR in der linken Hand und blickte voll konzentriert.
„Die Leute bei uns sagen: ,Einer Schlange muss man den Kopf abschlagen.‘ Der Kopf, das ist der Hasen-Kar-le. Den müssen wir schaffen, dann haben wir gewonnen. Die anderen allein machen gar nichts mehr.“
Alle dachten ein Weilchen nach. Was von Gertrud kam, hatte Hand und Fuß. Jetzt musste man sich nur noch die Einzelheiten ausdenken, dann war der Krieg oder zumindest die Schlacht gewonnen. Es kam wieder, Gertrud sei‘s gedankt, Stimmung im Bunker auf. Über die Einzelheiten, wie man diesen Hasenmelker ausschalten könnte, wurde man sich noch am gleichen Abend einig. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als Bernhard, immer noch mit Pflaster am Kopf, die zweite Flasche Most an den Mund setzte und den Rest mit einem mächtigen Zug leerte. Danach hatten wir allerdings recht viel Mühe, ihn aus dem Bunker herauszuhieven, und auch auf dem kurzen Weg zu seinem Elternhaus mussten Walter und Dieter den stark Schwankenden links und rechts stützen. Die beiden hörten noch, wie Bernhard von seiner Mutter mit lautem Gezeter in Empfang genommen wurde. Danach galt er zwei Tage als verschollen.
Die Schmerzen am Rücken waren immer noch da, die meiste Zeit gleichmäßig ziehend, manchmal auch penetrant bohrend. Es war jetzt genau eine Woche her, seit ich das Kruzifix am Himmel erblickt hatte, ich schaute immer mal wieder nach oben, so als könne es sich noch einmal zeigen. Aber offensichtlich hatte der Himmel das Kruzifix für immer verschluckt, und das war ja auch nur logisch, denn - so sagte ich mir - irgendwie gehörte es ja auch dorthin. Wer weiß, wie ich auf den Gedanken gekommen war, aber seit einiger Zeit hatte ich die fixe Idee, das Kreuz am Himmel sei für meine Schmerzen am Rücken irgendwie verantwortlich. Ein Kruzifix, das wusste ich natürlich aus dem Pfarrunter-richt des Dekan Lackner, hatte mit den Schmerzen Jesu zu tun, und weil ich offensichtlich der einzige war, der das Kruzifix gesehen hatte, war womöglich ein Teil der Schmerzen in dem Moment auf mich heruntergefallen, als das Kreuz wieder vom Himmel aufgesogen wurde. Jesus, Maria und Josef, das wäre immerhin eine Erklärung für meine Rückenschmerzen, und ich hatte sogleich fromme Märtyrer wie zum Beispiel den Heiligen Sebastian vor Augen, der als eine vielfach von Pfeilen durchbohrte Figur in der Schömberger Kirche rechts vorn am Altar stand und mild auf die Schömberger Sünder herabblickte. So ein bisschen fühlte ich mich in der Rolle eines Heiligen und Märtyrers schon geschmeichelt, meine Mutter Lioba hätte nicht schlecht gestaunt, und vielleicht wäre sie sogar stolz auf mich gewesen. In derlei tiefgründige Gedanken versunken, saß ich auf der niederen steinernen Gartenmauer an der Stirnseite des elterlichen Hauses in der Rottweiler Straße, der Nachbar Lander marschierte gerade mit seinem Fuhrwerk vorbei, seitlich hinter seiner als Zugpferd dienenden Kuh, gut gelaunt mit der Peitsche fuchtelnd. Auf dem vierrädrigen Leiterwagen saß mit baumelnden Beinen sein Weib neben einem riesigen Krug Most und dem Korb mit sicher ebenso üppigem Vesper und lachte breit und zufrieden. Schließlich war Frühling und herrliches Wetter dazu. Die Feldarbeit war nach dem langen harten Winter endlich wieder in die Gänge gekommen, und eigentlich - dachte ich mir - war dies so überhaupt nicht die Zeit für Märtyrer. Ich hatte ein paar herrliche Ferientage hinter mir. Für Jungen und Mädchen in meinem Alter, die man in Schömberg noch nicht für richtige Arbeiten heranholte, war das Leben hier fast wie im Paradies. Was konnte es Schöneres geben, als mit Freunden im Städtchen herumzustreifen, vom Viadukt aus in den Stausee zu pinkeln und sich verbotenerweise auf der Sägerei herumzutreiben.
Dass es dort nicht ungefährlich zuging, hatte ich allerdings erst wenige Tage zuvor am eigenen Leib erfahren. Zwei Tage bevor ich das Kruzifix erblickt hatte, stromerte die ganze Flügelbande wieder einmal auf der Sägerei herum. Es war Sonntag, man musste also nicht befürchten, von Arbeitern entdeckt zu werden. Wir hatten eine der alten schweren Eisenloren flottge-macht und aufs Gleis gesetzt, das als Transportlinie zum Ausgang hin diente. Damit rollten wir stundenlang die 50 Meter bis zur ersten Stellweiche, immer wieder hin und zurück, mit wechselnder Besatzung und teilweise in strammem Tempo. Schön war’s, allerdings musste man höllisch aufpassen, nicht einen Fuß unter die frei laufenden Räder aus massivem Eisen zu bekommen.
Gegen 3 Uhr nachmittags waren alle müde und nahmen einen der Bretterstapel als Ruhebank in Beschlag. Dazu griff sich jeder eines der zahlreich herumliegenden Abfallbretter und steckte es als Sitzfläche in einen Luftschlitz am Holzstapel, jeder in der Höhe, die ihm behagte. Mit dem Rücken an den Stapel gelehnt und baumelnden Beinen ließ es sich gut ausruhen, und wie immer begannen alle fünf im Takt leicht zu schaukeln, vor und zurück, vor und zurück. Diesmal ging es zum ersten Mal gründlich schief. Vielleicht war der etwas mehr als 3 Meter hohe Stapel in sich instabil, vielleicht hatten wir auch das Schaukeln übertrieben: Der Stapel bekam Übergewicht, kippte nach vorn und — niemand hatte damit gerechnet, deshalb reagierten alle zu spät -begrub die komplette Flügelbande unter sich.
„Wie schwer solche Bretter sind, weißt du erst, wenn du drunter liegst“, sagte später Alfons, der sich minutenlang nicht mehr rühren konnte und aus eigener Kraft nie mehr herausgekommen wäre.
„Heilandsack!“ Es jammerte, schnaufte und fluchte unter dem umgestürzten Stapel. Als erster befreite sich Dieter, dem wohl noch der weiteste Sprung nach vorn gelungen war. Mit seiner Hilfe kam Bernhard frei, und jetzt ging es schnell, nacheinander wurden Gertrud und Walter, danach Alfons und ich von unserer harten Zudecke befreit. Alle massierten sich mit schmerzverzerrtem Gesicht irgendwelche hinteren Körperteile, an denen sich schnell Blutergüsse bildeten. Ich selbst hatte eine Viertelstunde lang große Schwierigkeiten mit dem Gehen, da war so ein taubes Gefühl im linken Bein. Das gab sich zwar wieder, aber dafür stellten sich Schmerzen am Rücken ein, die einfach nicht weggehen wollten und mich in den Folgetagen quälten.
Alle schlichen bedrückt nach Hause. Wir bemühten uns, die blauen und roten Flecken daheim zu verbergen. Es war klar: Sollte sich unser Unfall erst einmal herumsprechen, wäre es das Ende des schönen Bunkerlebens auf der Sägerei. Dafür lohnte es sich schon einmal, die Zähne zusammenzubeißen.
Inzwischen waren zehn Tage vergangen. Ich war jetzt der Meinung, die Zähne lange genug zusammengebissen zu haben. Die Rückenschmerzen wollten und wollten nicht weniger werden, im Gegenteil. Es wurde langsam Zeit, meiner Mutter davon zu erzählen. Aber halt! Auf jeden Fall musste ich noch dabei sein, wenn es die Flügelbande dem Hasen-Karle heimzahlte. Wenn das erledigt war, so dachte ich mir, wollte ich der Mutter zwar von den Rückenschmerzen, nicht jedoch von dem Unfall auf der Sägerei erzählen. Sollte sie mich dann ins Bett stecken, war das zu verschmerzen, denn die Osterferien gingen jetzt bald zu Ende.
Der Plan, den die sechs von der Flügelbande ausgeheckt hatten, würde - natürlich immer vorausgesetzt, er funktionierte - das Ansehen und den Ruf des Hasen-Karle auf Jahre ruinieren und gleichzeitig seinen Anspruch zum Führen einer Straßenbande gewaltig in Frage stellen. Er sollte ganz einfach bis auf die Knochen blamiert werden.
Für die Ausführung des Attentates auf unseren Erzfeind Hasen-Karle brauchte es eine neutrale dritte Person, der das Opfer vertraute. Die Wahl fiel auf seine Tante väterlicherseits, die in der Nähe des Bahnhofs gleich beim Gasthaus Plettenberg wohnte. Die Lina war knapp sechzig und ledig. Ihr Neffe Karl, der am anderen Ende des sogenannten Städtchens wohnte, besuchte seine Patentante Lina von Zeit zu Zeit, und es war allgemein bekannt, dass dabei für ihn immer etwas Brauchbares heraussprang. Auf diese gute Beziehung der beiden zueinander wollte die Flügelbande einen wesentlichen Punkt ihres Planes aufbauen.
Schon Tage zuvor hatte Bernhard seiner älteren Schwester, die gegenüber dem Elternhaus des HasenKarle wohnte, einen rein verwandtschaftlichen Besuch abgestattet und dabei so ganz nebenbei einige wissenswerte Dinge in Erfahrung gebracht, so zum Beispiel dass der Karle zwar während der Wochentage, wie es sich gehörte, bei seinen Eltern wohnte. Am Wochenende jedoch übernachtete er fast immer in einer geräumigen Holzhütte, nur wenige Meter vom Elternhaus entfernt, in der auch ein Hasenstall untergebracht war. Der ganze Stolz des Hasen-Karle, daher auch sein Name, waren nämlich seine prächtigen, schneeweißen Angorahasen, deren Rammler weit über Schömberg hinaus bekannt und für Zuchtzwecke sehr begehrt war. Zwischen Karles Elternhaus und dem „Hasenstall“ erhob sich ein stattlicher, ständig frisch dampfender Misthaufen, dessen schiere Größe auf eine gewisse Wohlhabenheit von Karles Eltern schließen ließ.
Bernhards Informationen waren enorm wichtig für das Gelingen des Planes, denn man konnte jetzt ins Kalkül einbeziehen, dass der Karle jede Samstagnacht in seinem Hasenstall verbrachte. Für ihn hatte das den riesigen Vorteil, dass er für seine Eltern fast unkontrollierbar war und am Wochenende problemlos nächtliche Streifzüge unternehmen konnte, ohne sich — wie die Mitglieder der Flügelbande — teilweise recht mühsam von zu Hause davonschleichen zu müssen.
Am letzten Samstag in den Osterferien sollte das Unternehmen „Hasen-Karle“ steigen. Alle Sechs hatten sich schon Tage zuvor im Bunker einfache Masken aus Karton gebastelt, gespensterhaft schwarz-weiß bemalt, mit zwei Sehschlitzen und einem Gummizug. Die Masken — in Schömberg sagt man Larven dazu — waren meine Idee, denn „hinter so einer Larve bist du stärker, jeder respektiert dich“. Schließlich hatte ich schon
Erfahrungen mit Larven gesammelt. Erst zwei Monate zuvor, an der Fastnacht, hatte ich als einer der wenigen Halbwüchsigen einen „Fuchswadel“ mit echter Lindenholz-Larve tragen dürfen. Der wichtigste Grund für die Maskierung war allerdings, dass wir auf jeden Fall vermeiden wollten, von irgendjemandem erkannt zu werden.
Alle fanden sich am Samstag gegen 9 Uhr abends im Bunker ein. Walter brachte wie versprochen ein Fläschchen süßen, selbstangesetzten Holunderlikör mit. Dieter zog triumphierend ein Tütchen mit weißem Pulver aus seiner Hosentasche. Es war ein stark wirkendes Schlafpulver, etwas, was sein Vater als Inhaber der Konditorei Baier jeden Abend zum Einschlafen dringend benötigte, weil er schon in aller Frühe in der Backstube seine Geräte und Maschinen in Gang setzen musste und sich deshalb angewöhnt hatte, gegen 9 Uhr abends, wenn es überall noch lärmte, schlafen zu gehen.
Das Schlafpulver wurde vorsichtig in die Flasche gefüllt und das Ganze gut geschüttelt.
„Damit kannst du einen Wallach einen ganzen Tag lang ruhigstellen“, meinte Dieter sachverständig.
Das Infamste kam aber jetzt erst. Es war ein Zettel, auf dem mit krakeliger Schrift stand: „Lieber Karle, es soll Dir schmecken. Deine Lina.“ Der Zettel wurde per Bindfaden an der Flasche befestigt und flatterte im bereits kühlen Abendwind wie eine Fahne.
Die Flügelbande machte sich jetzt auf den Weg, wobei die Larven vorerst unter dem Hemd versteckt blieben. Es war davon auszugehen, dass Karle zu dieser Zeit noch unterwegs war, vermutlich in der Gegend des Marktplatzes, der sich bei jungen Männern großer Beliebtheit erfreute und den man in Schömberg den „Lalleplatz“ nannte. Kein Licht in der Hütte, überall äußerste Ruhe: Karle war noch nicht zu Hause, und so konnte das Fläschchen ohne Gefahr direkt vor die Tür von Karles Schlafgemach gestellt werden. Jetzt galt es nur noch zu warten. Alle sechs versteckten sich hinter einer nahen Mauer, den Hasenstall fest im Blick.
Wir mussten lange warten. Kurz vor Mitternacht begann Bernhard, der geradezu versessen darauf war, dem Hasen-Karle eins auszuwischen, leise vor sich hin zu fluchen.
„Ob der überhaupt noch kommt, vielleicht liegt er schon lange zu Hause im Bett, und wir sind die Deppen“, knurrte er, und alle wurden unruhig. Aber wir hatten Glück: Kurz nach Mitternacht kam der HasenKarle um die Ecke gestolpert, pinkelte noch einmal ergiebig an den Misthaufen und marschierte dann zur Tür. Die sechs hielten den Atem an und verfolgten gebannt jede Bewegung. Jawohl, er griff nach dem Fläschchen, drehte es herum, betrachtete es von allen Seiten und machte dann ein paar Schritte zurück in Richtung Straßenlaterne, um den Zettel besser lesen zu können. Heilige Mutter Gottes, war er etwa misstrauisch geworden? Nein, der Hasen-Karle schöpfte keinen Verdacht, warum sollte er auch — schließlich ließ ihm seine Tante Lina öfter mal was Gutes zukommen. Bedächtig entkorkte er das Fläschchen, roch daran, war’s wohl zufrieden und nahm zuerst einen kleinen und dann einen sehr kräftigen Schluck.
„Das dürfte reichen“, murmelte Dieter triumphierend, ,Jetzt müssen wir nur noch zehn Minuten warten.“
Der Hasen-Karle ging in sein „Wochenendhaus“, machte das Licht an und zog die Tür hinter sich zu. Es rumorte noch ein paar Minuten, dann tat sich absolut gar nichts mehr.
Nach zehn Minuten setzten wir unsere Larven auf. Zuerst pirschte sich Bernhard vorsichtig an die Hütte heran. Er spähte hinein und gab den anderen das Zeichen zum Nachkommen. Durch das kleine, halbblinde Fenster bot sich ein schönes Bild: Hasen-Karle lag auf einem schmalen Bett, voll angezogen, die Flasche, aus der er offensichtlich noch einen weiteren kräftigen Schluck genommen hatte, kullerte auf dem Boden herum.
Die Tür ließ sich ganz einfach öffnen, der Riegel innen war nicht vorgeschoben. Alle sechs huschten geräuschlos hinein und bauten sich vor dem Hasen-Kar-le auf. Testweise rüttelten sie an ihm, und für kurze Zeit riss er auch die Augen weit auf. Sie müssen ihm einen gehörigen Schrecken eingejagt haben, die sechs Gestalten mit ihren angsteinflößenden Larven. Jedenfalls jammerte der Karle kurz, versuchte ansatzweise
aufzustehen, was man natürlich zu verhindern wusste, und ergab sich dann in sein Schicksal. Seine Augenlider klapperten noch einige Male rauf und runter, dann schlief er wieder ein. In diesem Moment wusste die Flügelbande, dass sie gewonnen hatte. Buchstäblich durch die Larven hindurch konnte man erkennen, wie sich alle erleichtert angrinsten.
„Ausgeschissen“, grunzte Bernhard, und er hob dazu den Mittelfinger seiner rechten Hand hoch.
Jetzt kam Teil zwei des Planes. Eigentlich hatten wir vorgehabt, zuerst das Bett auf die höchste Stelle des riesigen Misthaufens zu stellen und danach mit vereinten Kräften den Karle dorthin zu schleppen. Weil es aber ein schmales leichtes Feldbett war aus dünnem Metallgestänge, ließ man den Karle gleich darauf liegen. Wir hoben das Bett samt unserem Erzfeind an den vier Ecken hoch, trugen es zur Tür hinaus, überquerten den kleinen Hof bis zum Misthaufen und setzten das Bett erst wieder ab, als die Mitte des immer noch dampfenden Misthaufens erreicht war. Am liebsten hätten wir in unseren Masken jetzt einen Freudentanz veranstaltet, zu schön war das Bild mit Bett und Karle hoch oben auf dem Misthaufen. Aber es gab noch eine letzte Kleinigkeit zu tun. Walter, der zu Hause selber Stallhasen hatte und deshalb wusste, wie man mit diesen Tieren, die ganz ordentlich zubeißen können, umzugehen hatte, schleppte nacheinander vier der schneeweißen, zappelnden Mümmelmänner mit den roten Augen am Genick herbei. Sie wurden mit einer 5 Meter langen Schnur am Bett festgebunden. Der Hasen-Karle sollte auch in dieser schwierigen Stunde mit seinen Lieblingen eng verbunden sein. Die possierlichen Tiere freuten sich offensichtlich über die neu gewonnene Freiheit und sprangen recht munter auf dem Misthaufen herum. Es war fast schon schade anzusehen, wie die Angorahasen in ganz kurzer Zeit ihre leuchtend weiße Farbe gegen das vulgär stinkende Braun des Misthaufens eintauschten.
Wir sahen dem Treiben noch einige Minuten zu. Alles war unter Kontrolle, und Gertrud hob stolz ihren MIR hoch. Geschafft. Wir malten uns jetzt genussvoll aus, was wohl morgen früh alles hier los sein würde, wenn die Nachbarn sich zur Sonntagsmesse aufmachten und das einmalige Spektakel entdeckten. Karles Eltern hätten allen Grund, sich zu Tode zu schämen, und das mit dem Schlafen im Hasenstall wäre für Karle sicherlich zu Ende.
Nach getaner Arbeit bewegten sich die sechs auf Schleichwegen Richtung Flügel, die Larven unter dem Hemd verstaut. Die Kirchturmuhr schlug jetzt viermal mit hellerem Ton für die ganze Stunde und danach einmal etwas stärker und dunkler. Es war 1 Uhr, auf den Straßen bewegte sich nichts mehr. Alle wuschen sich gründlich die Schuhe am Metallbrunnen vorm Café Baier, um die stinkenden, verräterischen Mistreste loszuwerden.
Es kam so, wie ich es vorhergesehen und auch befürchtet hatte: Als ich am nächsten Morgen meiner Mutter so ganz nebenbei sagte, mein Rücken würde wehtun, ließ diese sich auf keine weiteren Diskussionen ein und bestand auf sofortiger Bettruhe. Zuvor hatte sie natürlich meine Kehrseite eingehend inspiziert und geriet angesichts der zahlreichen Blutergüsse, verursacht durch die kantigen, schweren Bretter auf der Sägerei, völlig außer Fassung.
„Gerhard“, sagte sie streng, „das hast du doch nicht erst seit gestern. Was ist da passiert?“
„Das war beim Spielen vor ein paar Tagen.“
Meine Mutter würde Genaueres wissen wollen, so gut kannte ich sie. Ich musste mich jetzt entscheiden zwischen Lügen, Schwindeln oder die Wahrheit sagen. Lügen, das bedeutete die Hölle, Schwindeln war das Fegefeuer, und nur wer die Wahrheit sagt, kommt in den Himmel. So hatte es uns Dekan Lackner in der Schule erklärt.
Ich entschied mich für Schwindeln.
„Weißt du“, erklärte ich ihr vorsichtig, „wir waren im alten Ölschieferwerk. Da liegen Bretterstapel rum, auf einen davon bin ich geklettert. Dabei ist der Stapel umgefallen — zack lag ich unten, und auf meinem Rücken die ganzen Bretter. das hat verdammt wehgetan.“
Ich war jetzt erleichtert, schließlich hatte ich meiner Mutter in Sachen Bretterstapel die Wahrheit gesagt, ohne den Unfallort zu verraten. Ich handelte mit meiner Mutter noch aus, dass ich vorerst nicht ins Bett musste, sondern mein Krankenlager auf dem Sofa in der Wohnstube aufschlagen durfte - vom Sofa aus konnte man zwischendurch mal zum Fenster rausgucken und sehen, was draußen so alles los war. Der Dorfarzt Fri-cker würde erst morgen vorbeischauen, um mich zu untersuchen.
Liegen auf dem Sofa ist verdammt langweilig, vor allem wenn man an seine Freunde denkt, die bei diesem Wetter wahrscheinlich die Gegend um den Stausee herum unsicher machen und den Sieg über Hasen-Karle auskosten. Das Mittagessen musste ich liegend zu mir nehmen. Lioba hatte darauf bestanden, „so lange, bis ich weiß, was mit dem Buben los ist“.
Erst danach versammelte sich die ganze Familie in der guten Stube, in der nur zu ganz besonderen Gelegenheiten und vor allem bei Besuch gegessen wurde. Es gab heute nur EIN Gesprächsthema, das in ganz Schömberg rasend schnell die Runde gemacht hatte: die skurrile Geschichte vom Hasen-Karle, der - so erzählte es Rudi — stockbesoffen am frühen Morgen in seinem Bett liegend von Nachbarn auf dem elterlichen Misthaufen gefunden worden war, inmitten seiner mit Kuhscheiße zugeschmierten Angorahasen, für Schömberg ein ausgewachsener Skandal. Rudi klatschte sich immer wieder vor Vergnügen auf die Schenkel, es war hier schon vieles passiert, aber das war neu, und fast musste man den armen Karle bedauern, denn so ohne weiteres wür-de sich sein Vater diese Blamage nicht bieten lassen, insbesondere nachdem der Karle selbst bisher kaum zur Aufklärung beitragen konnte und wenig glaubwürdig von geheimnisvollen maskierten Männern sprach, die ihn überfallen hätten — wer sollte denn so was schon glauben.
Später hörte man noch, Karles Eltern hätten nach eingehendem Gespräch mit ihrem Sohn Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Es sei bereits der Ortsgendarm mit dem Fall betraut worden, wobei — so der erfahrene Polizist — die Höhe des Schadens nur schwer zu ermitteln sei.