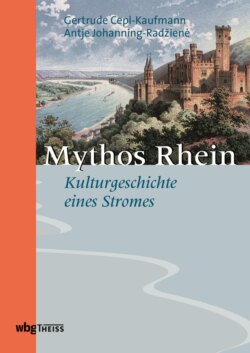Читать книгу Mythos Rhein - Gertrude Cepl-Kaufmann - Страница 10
Rheinische Burgen
ОглавлениеDer bis zum Investiturstreit vorherrschende theokratische Charakter der Königsherrschaft, der sein Pedant im Krönungsrecht und den Erzkanzlerwürden der höchsten Bischöfe hatte, fand seine vielleicht größte Ausprägung mit dem letzten Liudolfinger Heinrich II. (1002–1024), der 1014 in Rom zum Kaiser gekrönt wurde. Selbst seine politischen Entscheidungen wurden von kirchlichen Grundsätzen bestimmt, wie die so genannte Hammersteiner Affäre sichtbar macht. Der Konradiner Otto von Hammerstein hatte eine ihm nach kirchlichen Vorschriften zu nah verwandte Frau, Irmingard, geheiratet. Aufgrund der Verwandtschaft, die nach den kanonischen Bestimmungen die Ehe verbot, verfügte eine Kirchensynode die Trennung und die Exkommunikation. Diesem Beschluss wie auch dem königlichen Entscheid von 1018 folgten die Eheleute allerdings nicht. Erst durch die dreimonatige Belagerung der Burg Hammerstein durch kaiserliche Truppen wurde die Trennung gewaltsam erzwungen. Ob dieses Vorgehen Heinrichs II. nun wirklich auf religiöse Gründe zurückzuführen ist oder ob der Kaiser nicht vielmehr den zunehmenden Einfluss der aufsteigenden Konradiner, zu denen Otto I. gehörte, aufhalten wollte, bleibt ungeklärt. Die Belagerung der Burg allerdings zeugt von der Bedeutsamkeit, die ihr als Ausdruck des adeligen Selbstverständnisses zukam. Dies zeigt die Praxis, den Namen des Adelsgeschlechts mit dem der Stammburg zu verbinden und sich so im regionalen Herrschaftskontext zu identifizieren. Neben den Rhein als einer „Pfaffengasse“ tritt nun die Burg, die das sich zunehmend vergrößernde Gewicht des sich neu bildenden Dynastenadels gegenüber den Kooperationspartnern König und Kirche versinnbildlicht. Hatte der alte Adel, der bis ins 11. Jahrhundert die fränkisch-karolingische Tradition fortführte, entsprechend seines weit verzweigten Sippenverbandes ein breites Netz von Besitztümern und Machtbasen gespannt, so engte sich der Macht- und Güterradius zunehmend auf überschaubare regionale Zentren ein. Der Besitz der adeligen Familie setzte sich aus rechtlich heterogenen Anteilen zusammen. Neben den Grundherrschaften erwarben sie Grafen- und Vogteirechte, so dass sich insgesamt die Ausbildung feudaler Strukturen abzeichnete. Symbolisiert wurde die Macht- und Güterfülle der adeligen Familien durch die weithin sichtbare Burg, die seit dem 12. Jahrhundert nicht mehr im Tal, sondern auf den Höhen gebaut wurde. Waren die meisten der Burgen zunächst in königlicher Hand, nahm deren Zahl durch den Wechsel der Herrschaftshäuser und die üblichen Wahlgeschenke rasch ab. Lediglich die Burgen Boppard, Ingelheim, Oberwesel und Sinzig waren 1241 noch im Reichsbesitz. Nicht nur als Symbol der Macht und als Sicherung der Straßen und Handelswege, auch als Zollstationen waren die Burgen als Einnahmequelle äußerst attraktiv. Mit dem Aufstieg der Städte wurden sie zusehends Angriffsziel des Städtebundes, der sich gerade gegen die überhöhten Zölle zur Wehr zu setzen versuchte. Allein im Mittelrheintal wurden über vierzig Burgen gebaut, von denen heute nur noch wenige erhalten sind. So ist durch Zerstörungen von der Burg Rheinfels kaum ein Drittel des ursprünglichen Baus übrig geblieben (Abb. 3).
Burgen am Rhein
Burg Drachenfels bei Königswinter
Die Burg wurde um 1140 vom Kölner Erzbischof Arnold I. errichtet. Er überließ sie 1147 dem Bonner St. Cassiusstift, dessen Probst Gerhard von Are den Bau vollendete. 1176 wechselte die Burg in den Besitz der Herren von Drachenfels. Nach der Zerstörung wurde ein Wiederaufbau untersagt.
Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz
Die Festung entstand im 10. Jh. Erster Burgherr war der Konradiner Ehrenbert aus dem Geschlecht der Salier. Im 11. Jh. ging die Burg in den Besitz des Erzbischofs Poppo von Trier über, dessen Nachfolger Hillin sie zu einer Festung erweiterte. Diese wurde im 15. Jh. Nebenresidenz der Erzbischöfe von Trier und unter Erzbischof Richard von Greifenclau erneut ausgebaut. 1801 wurde sie durch die Franzosen gesprengt. Schließlich ließ Friedrich Wilhelm III. von Preußen 1817–1832 die heutige Anlage errichten.
Burg Gutenfels bei Kaub
In der ersten Hälfte des 13. Jh. errichtet, befand sich die erstmals 1257 urkundlich erwähnte Burg anfangs im Besitz der Familie der Falkensteiner. 1277 wurde sie kurpfälzisch. Ihren Namen erhielt die Burg, nachdem Landgraf Wilhelm von Hessen sie 1504 vergeblich belagert hatte. Nach Abbrüchen wurde die Burg 1889–1892 wieder aufgebaut.
Heimburg bei Niederheimbach
Die Heimburg wurde um 1290 als kurmainzische Trutzburg auf den Trümmern eines ehemaligen römischen Kastells errichtet. Sie diente im 13. und 14. Jh. der Erhebung des Rheinzolls. 1315 ließ Erzbischof Peter von Aspelt sie instand setzen. Von Ludwig XIV. wurde sie 1689 zerstört. Erst Hugo Stinnes ließ die Ruine im 19. Jh. wieder ausbauen.
Burg Katz bei St. Goarshausen (Neu-Katzenelnbogen)
Als Wehr- und Militärstützpunkt wurde die Burg um 1371 durch Graf Wilhelm II. von Katzenelnbogen errichtet. 1395 ließ sie Graf Johann von Katzenelnbogen zu einer Trutzburg erweitern. 1479 ging die Burg in den Besitz der Landgrafen von Hessen über. Im 18. Jh. wurde sie auf Napoleons Befehl gesprengt. Ferdinand Berg ließ die Burgruine mit Unterstützung der Architekten Schreiterer und Below 1896–1898 wieder zur Wohnburg ausbauen.
Marksburg bei Braubach (Markusburg oder Brauburg)
Die Burg, von den Grafen von Eppstein erbaut, wurde urkundlich 1231 erstmals erwähnt. 1283 ging sie in den Besitz der Grafen von Katzenelnbogen über und fiel 1479 an Landgraf Heinrich III. Nach weiteren Besitzerwechseln gelangte sie schließlich 1900 mit Zustimmung Kaiser Wilhelms II. in den Besitz der Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen (Deutsche Burgenvereinigung). Die Marksburg bei Braubach wurde als einzige der mittelalterlichen Höhenburgen nie zerstört.
Burg Maus bei St. Goarshausen (Deuernburg oder Thurnberg)
Um 1355 vom Trierer Erzbischof Boemund II., Graf von Saarbrücken, errichtet, war die Burg Residenz der Erzbischöfe Kuno von Falkenstein und Werner von Königstein. 1806 wurde die Burg zerstört. Anfang des 20. Jh. wurde die Burgruine durch den Kölner Architekten Gärtner wieder aufgebaut und 1926 erweitert.
Burg Reichenberg bei St. Goarshausen
Burg Reichenberg wurde um 1320 unter Graf Wilhelm I. von Katzenelnbogen begonnen, jedoch nie vollendet.
Burg Reichenstein bei Trechtingshausen (Falkenburg)
Vermutlich wurde die Burg im 11. Jh. gegründet, erstmals erwähnt findet sie sich 1213 in den Urkunden des Klosters Kornelimünster. Ihre Verwaltung lag seit 1213 zunächst in den Händen von Gerhard von Rheinbod, bis dieser die Burg 1214 an Philipp von Bolanden übergab. Durch Erbfolge fiel die Burg 1241 an Philipp von Hohenfels. Unter König Rudolf von Habsburg wurde sie niedergebrannt und gelangte in den Besitz des Pfalzgrafen Ludwig von Strengen. Nach weiteren Besitzerwechseln kaufte General Franz Wilhelm von Barfuß Burg Reichenstein und begann mit dem Ausbau. 1899 ließ Nicolaus Kirsch-Puricelli die Burg nach alten Plänen wiederherstellen.
Burg Rheinfels bei St. Goar
Zum Schutz des Rheinzolles wurde Burg Rheinfels 1245 von Graf Diether V. von Katzenelnbogen gegründet und im 16. und 17. Jh. von den Landgrafen von Hessen zum Wohnsitz und zur Festung ausgebaut. 1796/97 wurde die Burg gesprengt.
Burg Rheinstein (Vogtberg, Voitsburg)
Man vermutet, dass die Geschichte der Burg bis ins 9. Jh. zurückreicht. Im 11. Jh. war Burg Rheinstein im Besitz des Erzbistums Mainz. Im 12. Jh. fiel sie als Lehen an Kuno von Falkenstein und 1388 wieder an das Erzbistum Mainz. Nach mehreren Besitzerwechseln gelangte sie im 16. Jh. an die Familie von Wiltberg, bis schließlich Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen 1823 die Ruine erwarb. Er ließ sie unter den Architekten Claudius von Laussaulx und Friedrich Schinkel neu errichten.
Burg Sooneck bei Niederheimbach
Vermutlich im 11. Jh. erbaut, ist die Burg in der zweiten Hälfte des 12. Jh. als Besitz der Abtei Kornelimünster verzeichnet. 1290 wurde sie mit einem Bauverbot König Rudolfs von Habsburg belegt. Nach ihrer Zerstörung im Pfälzischen Krieg erwarben 1834 Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen und seine Brüder Carl und Albrecht die Ruine und ließen sie nach Plänen Karl Schnitzlers als Jagdburg wieder aufbauen. Seit 1918 ist Burg Sooneck im Besitz des Landes Rheinland-Pfalz.
Burg Stahlberg bei Bacharach
Wohl um 1200 entstanden, überließ der Kölner Erzbischof Conrad von Hochstaden die Burg 1243 dem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach zum Lehen. 1316 wurde sie von König Ludwig von Bayern an Erzbischof Balduin von Trier und König Johann von Böhmen verpfändet. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg teilweise zerstört und im Pfälzischen Erbfolgekrieg von den Truppen Ludwigs XIV. gesprengt. Seit 1912 ist die Ruine im Besitz des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz.
Burg Stahleck bei Bacharach
Die Entstehungszeit ist unbekannt, erstmals urkundliche Erwähnung findet Burg Stahleck 1135 unter Goswinvon Höchstadt. 1190 wurde die Burg von Kaiser Barbarossa seinem Bruder Konrad übertragen. 1214 fiel sie an Ludwig von Bayern. Französische Truppensprengten die Burg 1689 und ließen sie als unbewohnte Ruine zurück, bis Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen 1828 die Burg erwarb. 1909 ging sie in den Besitz des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz über.
Burg Stolzenfels bei Koblenz
Die Burg wurde in den Jahren 1242-1259 von Erzbischof Arnold von Isenburg als Festung ausgebaut und war später Residenz der Erzbischöfe Kuno und Werner von Falkenstein und Ulrichs von Trier. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde die Burg während der Belagerung von Koblenz durch die Franzosen niedergebrannt. Als Schenkung der Stadt Koblenz ging sie 1815 in den Besitz des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen über, der sie bis 1842 u.a. durch Friedrich Schinkel als Schloss ausbauen ließ.
Abb. 3: Eine der wohl heute noch größten Burganlagen am Mittelrhein ist die Burg Rheinfels bei St. Goar. Sie wurde 1245 von Graf Diether V. von Katzenelnbogen erbaut und ging nach dem Aussterben des Geschlechtes in den Besitz der Landgrafen von Hessen über. Wie die meisten Rheinburgen wurde sie im Kontext des Pfälzischen Erbfolgekrieges gesprengt und danach als Steinbruch genutzt. Hier eine Zeichnung von Wilhelm Schäffer (gen. Dilich), 1607/1608.
1245 ließ Graf Diether III. von Katzenelnbogen die Höhenburg in Spornlage errichten. Bis ins 17. Jahrhundert erfuhr sie zahlreiche An- und Umbauten. Einem Angriff des Städtebundes 1255/56 konnte sie standhalten. Nach einer Erhöhung des Rheinzolls durch Graf Diether III. von Katzenelnbogen rüsteten sechsundzwanzig Städte zum Kampf und belagerten die Burg über ein Jahr. Der auf der Zeichnung von Wilhelm Schäffer (Dilich genannt) zu sehende konisch ansteigende Bergfried in der Form eines Butterfassturmes, der heute nicht mehr erhalten ist, stammt aus der Bauphase unter Graf Wilhelm II. von Katzenelnbogen (1332–1385) im 14. Jahrhundert. Die Grafen von Katzenelnbogen, benannt nach der gleichnamigen Burg, die heute kurz Burg Katz genannt wird, waren es auch, die die gotische Bauphase der Burg Braubach, der heutigen Marksburg, veranlassten. Die Entstehungszeit dieser besterhaltenen Rheinburg kann nicht genau datiert werden, erwähnt wird sie zuerst 1231. Sie löste den alten Sitz der Edelfreien von Braubach – eine Talburg – ab, um dann im 13. Jahrhundert in den Besitz von Eberhard von Eppenstein zu wechseln, der den spätromanischen Palas bauen ließ. Auf die Bauphase unter den Grafen Katzenelnbogen ist die Gestalt des nun verschlankten Bergfrieds zurückzuführen, der mit dem zusätzlichen ‚Butterfaßaufsatz‘ eine Höhe von 39 Metern erhielt.
Neben der weltlichen Macht bediente sich auch die Kirche des repräsentativen Zeichens der Burg. Insbesondere die Bistümer Köln, Trier und Mainz konnten bald mit einem stattlichen Burgenbesitz aufwarten. So war Burg Rheineck ursprünglich eine Gründung von Pfalzgrafen, die Mitte des 12. Jahrhunderts in den Besitz der Kölner Erzbischöfe wechselte. Auch die Geschichte der Burg Stolzenfels ist mit der Kirche eng verknüpft. Als erste Trierer Befestigung am linken Rheinufer wurde sie unter Erzbischof Arnold II. von Isenburg (1242–59) gebaut. Sie arrivierte im 19. Jahrhundert zum Sammlungsobjekt des preußischen Königshauses, nachdem die Stadt Koblenz die zerstörte Ruine Kronprinz Friedrich Wilhelm geschenkt hatte. Karl Friedrich Schinkel errichtete das heutige Schloss als Sommerresidenz des Prinzen. Auch der Wiederaufbau der Burgruine Sooneck zum Jagdschloss ist der Burgenromantik des 19. Jahrhunderts zu verdanken. Burg Sooneck, ursprünglich ein Stiftungsgeschenk Ludwigs des Frommen an das Kloster Kornelimünster zu Beginn des 9. Jahrhunderts, wurde als Lehen des Mainzer Erzbischofs um 1350 nach einer Zerstörung neu gebaut, um schließlich in mehreren Bauphasen für das preußische Königshaus im 19. Jahrhundert wieder errichtet zu werden.
Nicht nur als Stiftungsgeschenke gelangten Burgen in Besitz der Bistümer, auch als Bauherr trat die Kirche in Erscheinung. So wurde Albert von Trier (1131–1152) zum Initiator der Trierer Burgenpolitik, die sich in Manderscheid, Neuerberg und Treis verewigte. Friedrich I. von Köln (1100–1131) ließ Rolandseck und die Wolkenburg errichten. Letztere bewährte sich vor allem in der Zeit der Kreuzzüge. Während der 1. Kreuzzug (1096–99) im Rheinland zu Judenpogromen unter dem Motto „Taufe oder Tod“ führte, konnte der Kölner Erzbischof Arnold I. (1138–1151) in der Zeit des 2. Kreuzzuges (1147–49) ‚seine‘ Juden in der Wolkenburg vor tätlichen Übergriffen retten. Mit Rolandseck dagegen, von dessen Ruine im 19. Jahrhundert lediglich der vielbesungene Rolandsbogen übrig geblieben war, verbindet sich Ferdinand Freiligraths Aufruf zum Wiederaufbau.
Das sich mit dem ‚Burgenbewusstsein‘ herausbildende territoriale Denken muss im Kontext der niedergehenden Grundherrschaft, dem damit verbundenen Verfall des feudal aufgebauten Ordnungssystems und der beginnenden „Kleinstaaterei“ im 13. Jahrhundert gesehen werden. Dieses kann einerseits als das Jahrhundert der Kölner Erzbischöfe Engelbert II. von Berg (1216–1225) und Konrad von Hochstaden (1238–1261) angesehen, andererseits muss es als Zeit der herrschaftlichen und zugleich territorialen Neuordnung bezeichnet werden. Zum Ausdruck kam dies 1288 in der Schlacht von Worringen. Bis 1250 bedeutete die Verleihung der Herzogswürde an die Kölner Bischöfe die Erweiterung des Einflussbereiches durch einen ausgedehnten, auf personale Beziehung bauenden Lehnsverband, der nicht mit einem Zuwachs von Rechten verbunden war, sondern lediglich die Einkünfte der Freien, Edlen und Grafen in der Diözese umfasste. Für diesen Machtbereich wurde der Begriff des episcopatus oder der terra Coloniensis prägend. Sobald in diese Lehnsbeziehung objektbezogene Interessen eindrangen, verlor das Lehnswesen an ordnungsstiftender Macht. Der sich abzeichnende Zusammenbruch dieses feudal aufgebauten Systems zeigt sich in der Schlacht bei Worringen, in der der Kölner Erzbischof Siegfried von Westerburg (1274–1297) auf der Fühlinger Heide vor den Toren der Stadt gegen die Koalition um Herzog Johann I. von Brabant, zu der die Grafen von Jülich, Berg, von der Mark, von Looz und Chiny sowie von Waldeck und Tecklenburg zählten, unterlag. Da fast alle seiner Gegner zugleich seine Vasallen waren, beendete die Schlacht nicht nur den Limburger Erbfolgekrieg, sondern kennzeichnete auch das Ende der hegemonialen Vormachtstellung der Erzbischöfe von Köln. Das personenbezogene, hierarchisch aufgebaute Lehnssystem wurde nun zugunsten eines territorialen Systems abgelöst, das auf die Abgeschlossenheit und Verstaatlichung selbständiger Gebiete zielte. Voraussetzung für diese Entwicklung war der Niedergang der Grundherrschaft, die dem rasanten Bevölkerungsanstieg nicht mehr gewachsen war. Vor allem durch die zumeist erbteilungsbedingte Zersplitterung der Grundherrschaften verloren sie ihre Vormachtstellung. Dadurch wirkte sich die zunehmende Parzellierung des Besitzes und der Rechte noch negativer aus. Die Besitztümer wandelten sich zu unübersichtlichen, kaum mehr zu koordinierenden Gebilden. Darüber hinaus entstand eine Freiheitsbewegung. Während sich die bestehenden personalen Abhängigkeiten zunehmend lösten, konnten Ostsiedlung und Urbanisierung den Wunsch nach Freiheit mehren, so dass die Polarität der Begriffe frei und unfrei zunehmend ins Wanken geriet. Dieser Territorialisierungsprozess manifestierte sich im Rheinland in der Herausbildung weniger Grafengeschlechter, die seit Mitte des 13. Jahrhunderts versuchten, ihren Besitz und ihre Rechte zu überschaubaren Ganzen umzuformen. Neben den Familien Heinsberg und Moers, die allerdings keine Grafenrechte besaßen, sind hier, außer dem Erzbischof von Köln, die Grafen von Jülich, Berg, Kleve und Geldern zu nennen. Ganz anders sah es dagegen im südlichen Rheinland aus, wo sich schließlich nur Kurtrier als Territorium etablieren konnte. Während sich die politische Orientierung der Grafschaft Luxemburg, seit 1354 Herzogtum, zunehmend aus dem Rheinland heraus verlagerte, konnten beispielsweise das Haus Manderscheid in der Eifel oder die Rhein-, Rau- und Wildgrafen keine größeren und maßgeblichen Territorien ausbilden.
Die Forcierung des Burgenbaus spielte neben den Stadtgründungen innerhalb dieses territorialen Formierungsprozesses eine wichtige Rolle, waren die Burgen doch zugleich Ausdruck und Kristallisationspunkt der gebildeten Distrikte. Den Aufstieg der Stadt mag die Tatsache anzeigen, dass Erzbischof Boemund von Trier 1291 sieben Orte seines Territoriums von König Rudolf I. von Habsburg zu Städten erheben ließ.
Damit ist der Übergang von „Pfaffengasse“ und Burgenpolitik, die das Gesicht des Rheinlands im frühen und hohen Mittelalter prägten und später das Grundmuster für das von ritterlichen Rheinburgen gesäumte romantische Bild des Stromes legten, zur Ausbildung stolzer Städte markiert. Das späte Mittelalter wurde das Zeitalter der Städte, die seit dem 5. Jahrhundert allein als Bischofssitze in Erscheinung getreten waren. In diesem Zeitabschnitt konnte sich nun auch am Rhein ein neuer Typus des Städtebewohners mit einem ihm eigenen Selbstverständnis herausbilden: der Bürger.