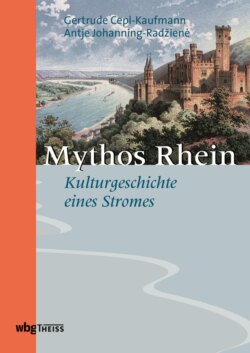Читать книгу Mythos Rhein - Gertrude Cepl-Kaufmann - Страница 8
Hochzeiten und Niedergänge Schon die Römer …
Оглавление„Der Rhein entspringt im Gebiet der Lepontier, die in den Alpen leben, und fließt mit reißender Strömung eine lange Strecke durch die Gebiete der Nantuaten, Helvetier, Sequaner, Mediomatricer, Tribocer und Treverer. In der Nähe des Ozeans teilt er sich in mehrere Arme, so daß viele große Inseln entstehen. Eine Vielzahl wird von wilden und barbarischen Völkern bewohnt, unter denen es einige geben soll, die nur von Fischen und Vogeleiern leben. Der Rhein mündet dann mit vielen Armen ins Meer.“1 Als reißenden Strom beschrieb Gaius Iulius Caesar den Rhein. Seine gewaltigen Wassermassen, seine Untiefen und Strudel erscheinen Furcht erregend und dienen als Folie für die Schilderung jener unbekannten Völker, die an seinen Ufern leben. Eine Kulturgeschichte des Rheins beginnt zwangsläufig mit der Eroberung Galliens durch Gaius Iulius Caesar in den Jahren 58–50 v. Chr. Der Gallische Krieg rückte den Rhein und die linksrheinischen Gebiete, die nunmehr als Germania inferior und Germania superior ein halbes Jahrtausend zum römischen Imperium gehörten, ins Bewusstsein der römischen Kultur. Es war der Beginn einer vielfältigen Beschäftigung mit dem Strom, dem Land und den Menschen, die sich in der differenzierten Schriftkultur und in den bildenden Künsten des Römischen Reiches niedergeschlagen hat.
Wie das vorangestellte Zitat Caesars aus „De bello Gallico“ belegt, richtete sich die Aufmerksamkeit zunächst auf die geographische Lage des Rheins, von seinem Ursprung in den Alpen bis hin zu seiner Einmündung ins Meer. Während Caesar hier das Mündungsgebiet des Stromes als vielarmig beschreibt, setzte sich jedoch mit Vergil die Vorstellung des Rhenus bicornis durch, die auch für die bildliche Gestaltung des Flussgottes und des Vater Rheins bedeutsam wurde und zum Eigennamen „Bicornis“ – Zweigehörnter – führte.
Neben seiner geographischen Bestimmung wurde insbesondere das Imponierende und Majestätische des Stromes hervorgehoben: seine Länge, seine Schnelligkeit und Wasserfülle. Bereits Asinius Pollio und nach ihm Strabon suchten die Länge des Rheins zu berechnen und ermittelten zwischen 3000 und 6000 Stadien, also eine Reichweite zwischen 550 und 1110 km, die der realen Dimension des Stromes von 12.000–13.000 km einschließlich der Krümmungen kaum gerecht wird. Die Wildheit seiner Strömung („violentia[m] cursus“2), seine Unbändigkeit („ferox“3) und die reißende Stromgeschwindigkeit („rapiditatas“4) werden in den Rheinbeschreibungen hervorgehoben. Als außerordentlich tief und breit5 schilderte Caesar den Rhein und Seneca richtete den Blick auf seine üppigen Wassermassen. Während die Größe des Rheins vor allem Bewunderung auslöste, wurde in zahlreichen Beschreibungen auch das Beängstigende des Stroms hervorgehoben. Insbesondere sein alpines Ursprungsgebiet, aber ebenso sein reißender Oberlauf mit Strudeln und Untiefen („gurgitibus Rheni fossam redundantem“6) und seine Eiseskälte wurden als schaurig und grauenerregend charakterisiert: „Squalidus – Rhenus“ heißt es bei Ovid7. Neben diesen Schilderungen zog der Rhein als Grenzgebiet und Streitobjekt die Aufmerksamkeit auf sich. Caesar suchte nach der Eroberung Galliens den Rhein als Grenze zu etablieren, was ihm allerdings nur teilweise gelingen sollte.8 Der Gallische Krieg wie auch Versuche, durch rechtsrheinische Besiedlung die Grenze des Imperiums abzusichern, hatten Völkerwanderungen zur Folge, die die germanischen Bevölkerungsanteile im römischen Imperium verstärkten und das römische Einflussgebiet auch auf rechtsrheinische Bezirke ausdehnte. Bis in die Zeit des Kaisers Augustus war das Gebiet westlich des Rheins als Aufmarschraum für die 12 v. Chr. beginnenden Germanenkriege angelegt. Ziel war es, die Reichsgrenze bis hin zur Weser und zur Elbe vorzuschieben, um so die rechtsrheinischen Gebiete zu befrieden.
Das linksrheinische Gebiet Galliens wurde zu einer gefährdeten Grenzregion, in der die Militärpräsenz ihre Spuren in der Verwaltungs-, Besiedlungs- und Sozialstruktur hinterließ. So wurde das Rheingebiet nach der Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr. in zwei Militärdistrikte, Ober- und Niedergermanien, unterteilt, an der Rheinfront Legionslager für römische Truppen angelegt. Während Xanten, Neuss, Köln und Bonn als römische Truppenlager entstanden, dienten Kalkar, Asberg oder auch Dormagen als Lager für Hilfstruppen. Sie wurden später Ausgangspunkte für die zivile Urbanisierung. Erst unter Tiberius, um 20 n. Chr., gab man die Versuche, auch rechtsrheinische Gebiete zu erobern, auf.
Die in den eroberten Gebieten ansässige Bevölkerung stand der Romanisierung zunächst skeptisch gegenüber. Bis ins 1. Jahrhundert, genauer gesagt bis zum Bataveraufstand 69/70 n. Chr., gab es Versuche der keltisch-germanischen Bevölkerung, ihre traditionelle Lebensweise und ihre Selbstverwaltung gegenüber den römischen Besatzern zu verteidigen. Mit der Umwandlung der Militärdistrikte in Provinzen, gegen 83/84 n. Chr., wurden die Gebiete Germania superior und inferior in die römische Provinzstruktur neben der bereits bestehenden Provinz Belgica mit der Hauptstadt Trier integriert. Der Vinxtbach trennte die beiden Provinzen, als deren mit Stadthaltern ausgestattete Hauptstädte Mainz und Köln fungierten.
In wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht bedeutete die Romanisierung dieser Provinzen die zunehmende Urbanisierung des Gebiets. Es profitierte von dem ausdifferenzierten und produktiven Wirtschaftssystem des Römischen Reichs, besonders in gewerblicher und agrarischer Hinsicht. Als Städte mit höchster Rechtsordnung, Coloniae genannt, entstanden im 1. Jahrhundert unter Kaiser Claudius Köln und Trier und unter Kaiser Trajan Xanten, deren Einwohner römisches Bürgerrecht besaßen. Daneben gewannen stadtähnliche Siedlungen (vici), deren Bevölkerung allerdings keine Bürgerrechte besaß, sondern lediglich den Rechtsstatus von ‚Fremden‘ (peregrini) genossen, an Bedeutung: so etwa Aachen und Nimwegen als Verwaltungssitze der civitates, in die sich die Provinzen gliederten, oder als Verkehrsknotenpunkte und Warenumschlagplätze wie etwa Maastricht, Jülich oder Koblenz. Als Orte der Verwaltung, der Produktion und des Handels trugen sie bereits städtische Züge. Die Landwirtschaft dagegen beschränkte sich auf Einzelhöfe (villa rustica), die das Land geradezu übersäten. Die Infrastruktur wurde zudem durch Straßenanlagen und Brückenbauten befördert. Insbesondere die Brückenbauten der Römer demonstrierten ihre kriegstechnische Überlegenheit gegenüber der ansässigen Bevölkerung. Während Letztere vor allem auf Flöße und Einbäume oder aber auf den wetterbedingten Eisgang über den Rhein zurückgreifen mussten, zeigten sich die Römer bereits im Gallischen Krieg als kunstfertige Brückenbauer, wie wir von Caesar erfahren: „Nachdem er so entschieden hatte, ließ er […] eine Brücke errichten. Da das Verfahren bereits bekannt und genau festgelegt war, war der Bau infolge des großen Eifers der Soldaten in wenigen Tagen vollendet“9 (Abb. 1).
Abb. 1: Nicht nur im Überqueren des Rheins waren die Römer überlegen, auch im Schiffsverkehr zeigten sie sich führend, wie das Neumagener Weinschiff veranschaulicht. Steinerne Zeugen der römischen Zeiten am Rhein finden sich in reicher Zahl vor allem als Grab- oder Denkmäler. Hier eine Kopie eines Kalksteinreliefs nach einem römischen Original aus dem 3. Jh. n. Chr.
Die noch im 1. Jahrhundert vorherrschenden Rechtsunterschiede zwischen der ansässigen Bevölkerung und den aus Italien und Innergallien zugezogenen römischen Bürgern wurden im Verlauf des 2. Jahrhunderts zunehmend nivelliert, was die soziale Mobilität beförderte und sicherlich zur zunehmenden Akzeptanz der römischen Kultur beitrug. Damit begann die Blütezeit der römischen Kultur am Rhein. Der wirtschaftliche und kulturelle Aufschwung, architektonisch repräsentiert in Prachtbauten, prägte die städtische Kultur. Daneben zeugen archäologische Funde der Kunst und des Kunstgewerbes wie Steinplastiken und -reliefs, Mosaiken, Keramiken und Gläser von der kulturellen und wirtschaftlichen Hochkonjunktur.
Die Christianisierung der römischen Provinzen am Rhein begann Mitte des 3. Jahrhunderts. Bis zu dieser Zeit wurden auch am Rhein offiziell die römischen Götter verehrt, vor allem Jupiter und Juno, Minerva und Roma und mit ihr der Kaiser. Das um 230–240 entstandene Dionysosmosaik, das noch heute im Römisch-Germanischen Museum in Köln zu bewundern ist, legt beredtes Zeugnis von der Präsenz der antiken Götterwelt ab. Daneben konnten sich auch östliche Gottheiten etablieren, die seit dem 1. Jahrhundert das religiöse Leben mitbestimmten – beispielsweise Mithras als Held einer verheißungsvollen Erlösungsutopie, die Fruchtbarkeitsgöttin Kybele oder die ägyptische Isis. Zugleich blieben einheimische Rituale wie der Matronenkult bedeutend. Auch der Rhein war in das rituelle Leben einbezogen noch bevor er sich in der römischen Flussgötterwelt etablieren konnte. So berichtet Caesar, dass am Rhein Frauen „aus den Wirbeln des Flusses, aus den Windungen und dem Getöse weissagten“10. Auch fand der Rhein als Rhenus bicornis Eingang in die römische Götterwelt.
Nach einer Ruhephase gewann der Fluss im 3. Jahrhundert als umkämpfte Grenze wieder Aufmerksamkeit. Die sich seit 230 n. Chr. abzeichnenden Unruhen gipfelten 256/57 in einem Einfall der Franken in Gallien. Er konnte zwar noch abgewehrt werden, doch verwies er bereits auf den beginnenden Niedergang der Blüte der römischen Kultur. Die Schaffung eines gallischen Sonderkaisertums (259–273) und zahlreiche Um- und Neustrukturierungen, die im Zuge der eingeführten Tetrachie unter Diokletian (284–305) die Hauptstadt der Gallia Belgica, Trier, sogar zur Kaiserstadt machten, führten zwar zu einer zeitweisen Stabilisierung am Rhein, dennoch konnte die kulturelle und wirtschaftliche Hochphase des 2. Jahrhunderts nicht mehr erreicht werden. Die Sicherung des Römischen Reiches, auch der Rheinfront, bedurfte finanzieller Mittel, und so führte Diokletian im Zuge seiner zahlreichen Neuordnungsmaßnahmen ein stark belastendes Steuersystem ein. Zur Kontrolle wurde die Bürgerfreiheit beschnitten und die Möglichkeiten zur sozialen Mobilität abgeschafft. Wie die Bauern erblich an ihre Scholle gebunden wurden, mussten auch Kinder anderer Berufsgruppen die Beschäftigung des Vaters weiterführen.
Allein die Friedenszeit unter Kaiser Konstantin (306–337) zeichnete sich als eine Phase der kulturellen Wiederbelebung ab. Zur Abschreckung unternahm er den Bruktererfeldzug und legte darüber hinaus Kastelle im rechtsrheinischen Gebiet an, um so die Grenze zu befestigen. In dieser Zeit bekam Köln seine erste, allerdings hölzerne Rheinbrücke, die die linksrheinische Stadt mit dem rechtsrheinisch gegründeten Kastell Divitia, dem heutigen Stadtteil Deutz, verband.
Auch Prachtbauten aus konstantinischer Zeit in der Hauptstadt der Belgica, in Trier, dem Regierungssitz Konstantins, zeugen von einer zeitweisen kulturellen Wiederbelebung. Sie zogen später, im 19. Jahrhundert, die Aufmerksamkeit der Rheinromantik auf sich. Ab 1816 ließ der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. die um 305 als Palastaula des Kaisers errichtete Basilika, die fälschlicherweise für ein authentisches frühchristliches Bauwerk gehalten wurde, zu einer dreischiffigen Basilika mit Querhaus umbauen. Auch das bereits um 100 n. Chr. errichtete 20.000 Zuschauer umfassende Amphitheater, die Porta Nigra, das im 2. Jahrhundert erbaute Nordtor der römischen Stadtmauer und die Kaiserthermen wurden mit finanzieller Hilfe des Kronprinzen im 19. Jahrhundert freigelegt und restauriert, um eine christliche Traditionslinie zur Römerzeit, insbesondere zu Konstantin zu ziehen.11 Trotz der konstantinischen Abwehrmaßnahmen konnten 355/56 wiederum Franken die Rheingrenze durchbrechen und Köln einnehmen. Dieser Feldzug wurde nur teilweise zurückgeschlagen, bewirkte aber die Auflösung römischer Verwaltungsorganisationen in den nördlichen Provinzteilen. Es begann nun die letzte Phase römischer Herrschaft am Rhein, geprägt von zahlreichen Einfällen der Franken. Eine Episode schließlich scheiternder Verteidigungsversuche ist die Vernichtung des um Worms gegründeten Burgunderreichs durch hunnische Reitersoldaten im Jahre 436, die sich im Nibelungenlied verewigt findet. Sie wurde Grundlage für die spätere Darstellung des Rheins als Hüter des Nibelungenhortes.
Bereits 406 fielen Alamannen, Sueben und Alaner über die Rheinbrücke bei Mainz ein und überrannten die Grenztruppen. Vereinzelte Garnisonen, die sich gegenüber dem Ansturm halten konnten, wurden abgezogen – ein Akt, der zusammen mit der Ablösung Triers als Residenzort zugunsten von Mailand bzw. Ravenna das schwindende Interesse an den Rheingegenden bezeugt. Das Ende der römischen Herrschaft manifestierte sich in der Übernahme Kölns durch die Franken im Jahre 459 – einem Aktionsbündnis germanischer Stämme bestehend aus den Altstämmen der Brukturer, der Chamaver, der Chattuarier und Amisvarier und den Neustämmen der Salier und Ripuarier. Von Köln aus stießen sie rheinaufwärts vor, um schließlich 480 auch den Moselraum zu erobern und aus dem römischen ein fränkisches Rheinland zu machen.
Der fränkische Herrschaftsbereich gliederte sich in Teilstämme, die von Königen regiert wurden, deren Macht religiös fundiert war. Am Rhein entstand das fränkische Teilreich Francia Rhinensis, Ripuarien, mit der Residenz Köln, der Civitas Agrippinensium, als Zentrum. Es konnte sich in den achtziger Jahren des 5. Jahrhunderts sogar bis zum Mittelrhein und zur Mosel ausdehnen.
Für die Folgezeit ist es allerdings nicht die Francia Rhinensis, die gestaltende Kraft am Rhein ausüben wird, vielmehr konnten fränkische Teilkönige der Salier aus dem Geschlecht der Merowinger im Nordosten Frankreichs einen Herrschaftsbereich ausbauen, der sich schließlich bis an den Rhein ausdehnte. Mit dem Sieg über Syagrius 486 legte Chlodwig I. die Grundlage für ein merowingisches Großreich. Er rottete die ripuarische Königsfamilie aus und ließ sich selbst in Köln zum König erheben. Am Ende der Herrschaft Chlodwigs (gest. 511) umfasste das Reich auch die Francia Rhinensis. Die neuen Herrscher übernahmen zunächst die von den Römern geschaffenen Strukturen, insbesondere in Hinblick auf die Verwaltung. Die begonnene Christianisierung des Rheinlands wurde schließlich mit der Taufe Chlodwigs durch den heiligen Remigius 497/8 in Reims fortgesetzt. Bereits in der Zeit des römischen Herrschaftszerfalls am Rhein konnten die Bischöfe ihren Einfluss über das Geistige hinaus in weltliche Belange ausdehnen. Die Taufe Chlodwigs legte nun aber den Grundstein für die das Mittelalter überdauernde Symbiose von weltlicher Herrschaft und katholischer Kirche.