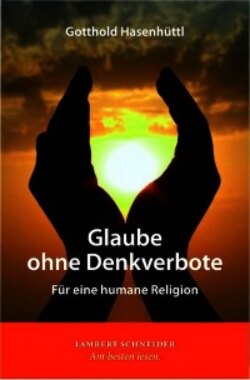Читать книгу Glaube ohne Denkverbote - Gotthold Hasenhüttl - Страница 13
6 Ist Glaube Verdummung des Menschen?
ОглавлениеReligionen weisen auf den Glauben als eine wichtige menschliche Grundhaltung hin. Das Wort „Glaube“ wird in der deutschen Sprache oft für ein unsicheres Wissen verwendet. „Ich glaube, dass morgen das Wetter wieder schön wird, aber ich weiß es nicht sicher.“ „Ich glaube, dass die Aktien steigen werden, aber ob es zutrifft, ist höchst ungewiss.“ Eine Vermutung ist aber im religiösen Sinne kein Glaube. In seinem Regierungsprogramm bezeichnet Benedikt XVI. als Glaube den Gehorsam, den der Mensch Gott und der Kirche gegenüber aufbringt.20 Da Gott die Wahrheit ist, muss ich freiwillig den geoffenbarten Wahrheiten zustimmen. Insofern ist der Glaube ein persönlicher Akt. Aber woher weiß ich, was eine „geoffenbarte Wahrheit“ ist? Durch die Offenbarung! Wer aber verbürgt sie? Es ist die Kirche. „Es ist nämlich die Kirche, die glaubt.“ Die Kirche, die hier gemeint ist, ist eine hierarchische Institution. Kann eine Institution glauben? Die Kirche ist die „Lehrmeisterin“.21 Der Glaube wird hier zu einem kirchlichen Akt und ist daher an die Hierarchie gebunden. Der Glaube ist also Gehorsam und Verstandes- und Willensunterwerfung unter die kirchlichen Machthaber. Die kirchliche Institution verbindet zwei Glaubenskonzeptionen miteinander. Gott ist eine Autorität, die bestimmte Glaubensinhalte offenbart, die zu glauben sind. Das ist das sog. instruktionstheoretische Glaubensmodell. Das sog. personalistische Glaubensmodell vertrat besonders das 2. Vatikanische Konzil. Gott offenbart seine Person und erschließt sich in Liebe. Wer auf diese Selbsterschließung Gottes antwortet, glaubt. Dadurch wird eine befehlende zu einer liebenden Autorität. Der Klammergriff auf den Menschen wird dadurch absolut. Diese göttliche Autorität legt verbindlich die kirchliche Autorität aus. Sehr klar expliziert dies Ignatius von Loyola: „Wir müssen […] immer festhalten: Ich glaube, dass das Weiße, das ich sehe, schwarz ist, wenn die Hierarchische Kirche es so definiert“,22 denn Gott und Kirche sind von gleichem Geist durchdrungen. So wird einem buchstäblich schwarz vor den Augen.
Dieser Autoritätsglaube hat eine geradezu dämonische Seite. Es ist das Herr-Knecht-Verhältnis, dem niemand entrinnen kann, der auf diese Weise glaubt. Der Jakobusbrief (2,19) polemisiert gegen diesen unethischen Glaubensgehorsam. Es gibt Menschen, meint er, die an einen solchen Gott glauben und sagen: Es gibt nur einen Gott. Nun gut, es mag sein, aber: „Die Dämonen glauben es auch und zittern.“ Wer glaubt, weil die Hierarchen diesen Glauben vorschreiben, hat einen dämonischen, teuflischen Glauben. Er nützt nichts, er schadet nur dem Menschen. Wer nicht vorschriftsmäßig glaubt, geht des Heils verlustig, die Hölle tut sich auf. Nicht Einsicht und Verstehen sind Glaubensnormen, sondern die demütige Unterwerfung. Obwohl durch einen solchen Glauben Ängste geschürt werden, werden sie zugleich abgebaut, da nur noch eine Autorität zu fürchten ist: die kirchliche. Wer ihr absoluten Glaubensgehorsam leistet, braucht sich nicht mehr um sein Schicksal zu sorgen, braucht nicht mehr nach dem „unerforschlichen Willen Gottes“ zu suchen, denn die kirchliche Autorität bietet den sicheren Weg an. Glaube wird zu einem totalen Abhängigkeitsverhältnis und das persönliche Geschick wird institutionell verwaltet. Um aber eine gewisse bindende Angst aufrechtzuerhalten, spielte die Beichtpraxis, die heute allerdings weitgehend verloren gegangen ist, eine entscheidende Rolle. Sie gipfelt in den „Jagdszenen aus der Seelsorge“, die sich auf den Sexualbereich beziehen. Dieser ist besonders geeignet, Angst (vor allem bei Frauen, wie ich es selbst im Beichtstuhl erfahren habe) zu erzeugen.
An diesem Unterwerfungsglauben, der sich immer stärker in der Geschichte der Kirche ausgebreitet und zugleich Entlastungsfunktion hat (denn der Priester oder Vorgesetzte nimmt mir die eigene Entscheidung ab), ist die franziskanische Bewegung nicht ganz unschuldig. „Sie machten keinen Unterschied zwischen gerechter und ungerechter Vorschrift, weil sie der Meinung waren, dass alles, was angeordnet wurde, dem Willen des Herrn entspreche.“23
Glaube wird zum Kadavergehorsam, er ist blind. Wohin diese Autoritätshörigkeit führt, können wir am Eichmanngehorsam ablesen, der Millionen Juden den Tod brachte. Vorexerziert wurde dies durch eine Kirche der Intoleranz, die in ihrer Geschichte Millionen von „Ungläubigen“, „Ketzern“ und „Hexen“ auf ihrem Gewissen hat. Dies gilt auch für andere Religionen, die Menschen um ihres Glaubens willen verfolgen (z.B. der Islam), oder weltliche Diktaturen, die ihre Ideologie als Glauben verstehen, dem man sich zu unterwerfen hat. Ein ideologischer Glaube wird immer nur durch Angst, Furcht und Zittern aufrechterhalten.
Ist also Glaube Verdummung und nur rationales Wissen heilsam? Neben dem Begriff des Glaubens als Wahrscheinlichkeit und Autoritätshörigkeit gibt es ein anderes Glaubensverständnis, das nicht einfach Wissen ist, sondern auf eine andere Dimension des Menschseins hinweist, die sich in Kunst, Literatur, Liebe, Freundschaft, Güte und Vertrauen ausdrückt.
Philosophen sprechen vom „Seinsvertrauen“, das dem Menschen eigen ist. Er ist nicht nur auf Gegenstände hin gepolt, nicht nur auf Umwelt, wie die Tiere, sondern auf Welt, auf das Ungegenständliche, auf das ganze Sein hin. Nicht Haben, sondern Sein heißt die Parole für die Menschheit, um gedeihen zu können. Geist meint Beziehungsein auf das Andere, meint sich selbst nicht abschließen und alles andere ausschließen, sondern sich auf ein Du und auf die Welt als ganze zu beziehen. Daher konstituiert sich das Menschsein in Beziehungen wie Freundschaft, Liebe und Vertrauen. Damit stehen wir bei dem Begriff, den die Religionen Glaube nennen. Er ist die grundlegende Offenheit, das Aufnehmen des Anderen als Anderen, eben das Leben aus Beziehung und nicht aus Habgier.
Was dieses Vertrauen in den Menschen bedeutet, wie es alle Grenzen von Recht und Ordnung sprengt, wie alle Begründung und aller Gerechtigkeitswahn versiegen, wird in der Erzählung des Obstgärtners von A. Tschechow sichtbar. In einer Stadt, so erzählt er, ließ sich ein Mensch nieder, der andere heilte. Ja, er liebte die Menschen und grenzte sich dadurch von allem Bösen ab. Eines Tages wurde er ermordet. Der Mörder war bald gefunden und er sollte zum Tode verurteilt werden. Mit Schweiß auf der Stirn rief der Richter: „Nein! Wenn ich ungerecht urteile, so mag Gott mich strafen, aber ich schwöre, er ist unschuldig! Ich kann den Gedanken nicht zulassen, dass sich ein Mensch finden konnte, der es wagte, unseren Freund zu töten! Ein Mensch ist nicht imstande, so tief zu sinken! […] einen solchen Menschen gibt es nicht […]“ Und die Menge rief: Lasst ihn frei! Der Mörder wurde freigelassen und kein Mensch bezichtigte den Richter der Ungerechtigkeit. „Und Gott, so sagte meine Großmutter, verzieh um dieses Glaubens an den Menschen willen allen Bewohnern des Städtchens ihre Sünden,“ Tschechow schließt die Erzählung: „Mag der Freispruch den Bewohnern des Städtchens Schaden bringen, aber urteilen sie selbst, welchen wohltuenden Einfluss dieser Glaube an den Menschen auf sie hatte. Der Glaube bleibt doch nicht tot, er fördert echte Gefühle in uns und veranlasst uns, jeden Menschen zu lieben und zu achten. Jeden! Und das ist wichtig.“24 Dieser Glaube überwindet das „Aug um Aug“, er transzendiert den Vergeltungsgedanken und lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute (Matthäus 5,45).
Die menschliche Grundhaltung, die damit gemeint ist, ist das Vertrauen. Es erlischt auch dann nicht, wenn es zutiefst enttäuscht wird. Der Glaube an den Menschen verurteilt nicht und spielt nicht Gott. Glaube ist die Kraft der Vergebung und nicht der Vergeltung. Durch das vergebende Vertrauen wird das Rechts- und Gerechtigkeitsprinzip abgelöst. Glaube ist nicht Gewalt und Zwang, sondern Entlassung in Freiheit. Das schließt nicht aus, dass ein „Rechtsstaat“ Menschen vor zerstörerischen Menschen schützt. In Diktaturen und religiösen Systemen ist der Mensch meist schutzlos ausgeliefert. Vom Vertrauen sollen uns diese institutionellen Mächte nicht abbringen. Eine grundlegende Dimension des Menschseins würde verlorengehen. Statt Vertrauen würde Misstrauen, statt Glaube Angst gesät. Ohne Vertrauen ist Liebe unmöglich. Darum setzt die jesuanische Botschaft mit der Forderung ein, Glauben und nicht Angst zu haben.
Im Alten Testament wird von Glaube gesprochen, wenn Menschen Erfahrungen und Ereignisse mit Gottes Gegenwart in Verbindung bringen. Der Mensch mit seiner ganzen Existenz sagt „Amen“, d.h., er glaubt. Auf die Gegenständlichkeit, auf Besitz und Macht ist kein Verlass. Sieht der Mensch das ein, dann lebt er von einer anderen Dimension, nämlich der des Glaubens. Glaube im Alten Testament heißt nicht an Gott glauben, sondern in den Ereignissen des Lebens eine Erfahrung zu machen, die Vertrauen weckt und die Bedeutung der Gegenwart Gottes hat. Ähnlich versteht das Neue Testament den Glauben. Für den synoptischen Jesus ist es charakteristisch, dass der Begriff „Glaube“ immer ohne Objekt, ohne Gegenstand gebraucht wird. In diesem Sinne kommt der Glaube an Gott nicht vor. Nie sagt Jesus: „Dein Glaube an Gott hat dir geholfen“, nie: „Deine Treue zum Gesetz hat das Heil erwirkt.“ Auch an Jesus glaubt man nicht. Immer heißt es nach einer Wunderheilung, nach einer Sündenvergebung, nach einer seelischen Gesundung: Dein Glaube hat dir geholfen!
Indem der Leidende vertraut, nicht hoffnungslos ist, obwohl er sich in einer hoffnungslosen Situation befindet und trotzdem beziehungsbereit ist, in diesem Sinne „an den Menschen“ glaubt, wird sein Heil offenbar. Vertrauende Beziehung eröffnet einen neuen Lebensraum. Jesus konnte offenbar, anders als die Gesetzeslehrer, Vertrauen wecken. Nie bindet er jedoch die Geheilten an sich. Glaube an die Person Jesu ist nicht heilsnotwendig. Jesus selbst schickt die vom Leid erlösten Menschen mit der Aufforderung nach Hause, zu schweigen. Jesus, gerade als Mensch, erschließt für diese den Glauben an den Menschen. In diesem Sinne ist der Glaube „an Jesus Christus“ erforderlich. Jesus selbst wird zum Verkündigten. Er ist der lebendige Hinweis auf Vertrauen ohne Furcht und Angst. Vertrauen wird aber keineswegs immer belohnt, sondern kann, wie bei Jesus, tödlich sein. Aber Vertrauen und Glaube machen den menschlichen Menschen aus. Glaube versetzt Berge, auch wenn das Tal der Tränen bleibt. Vorurteile abzubauen, in Not nicht zu verzweifeln, Hoffnung zu haben, auch wenn Mächte und Gewalten uns bedrohen, heißt glauben. Jesu Aufruf zum Glauben meint, dass wir angstfreie, beziehungsfähige Menschen werden sollten, die trotz allem Anschein „an den Menschen“ glauben, menschlich vertrauen. Ein Christ, der die frohe Botschaft des Glaubens hört, wird nicht auf eine Lehre, auf einen bestimmten Inhalt verpflichtet, sondern paradigmatisch auf die Lebensform Jesu.
Paulus stellt dem Glaubenden den religiösen Menschen mit seinen Werken gegenüber. Werke sind das, was machbar ist, was wir durch Leistung haben können. Warum hat dies keinen Heilswert? Weil alles Werken Versuch einer Selbstbegründung ist. Menschliches Leben wird nicht durch Selbstsuffizienz und Leistung sinnvoll, sondern durch die vertrauende Beziehung, indem wir uns auf die Welt einlassen und nicht dem Wahn der Askese oder des Egoismus verfallen. Indem wir uns in die Welt, in die Verantwortung für den Mitmenschen begeben, zeigt sich die Dimension, die wir Glauben nennen. Glaube ist nicht „zu haben“, er ist Seinsvertrauen, ist Beziehung auf den Anderen/das Andere. In diesem Bereich ist „Nähe Gottes“, wie Jesus sich ausdrückt. Paulus führt uns Abraham vor Augen. Er verstand zuerst den Glauben als Autoritätshörigkeit, als er seinen Sohn Isaak Gott opfern wollte. Im Verständnis der damaligen Religionen, vor allem im phönizischen Umfeld, war die Erstgeburt für Gott zu schlachten. Aber den religiösen Inhalt, Gott fordert die männliche Erstgeburt, lehnt Abraham ab. Der wahre Glaube wird nicht durch einen solchen Gott, sondern durch Mitmenschlichkeit bestimmt. Nur ein Gott, der den Menschen bejaht, ist Gott. Glaube ist Leben und nicht Mord. Glaube ist in diesem Sinn ewiges Leben. Das meint Jesus, wenn er von diesem oder vom „Paradies“ spricht. Die Liebe ist die einzige Wirklichkeit, die mit der Vergänglichkeit nicht identisch ist. Inhalt des Glaubens sind daher nicht Dinge, die wir für wahr halten, weil sie irgendeine Autorität (Moses, Jesus, Mohammed) verkündet hat. Der Christ glaubt und vertraut nur der Liebe. Das Glaubensbekenntnis, das Christen in der Kirche sprechen, ist nicht eine Festlegung auf bestimmte Inhalte, sondern ein Glaubenssymbol; lateinisch heißt es treffend: „symbolum fidei“.
Symbole wollen auf etwas aufmerksam machen und Hinweise auf wichtige Dinge des Lebens geben. Sie sind nicht die Sache selbst, aber dienen dazu, das Gemeinschaftsleben zu erleichtern. Aussagen können den Glaubensvollzug verdeutlichen, dürfen aber niemals mit dem Glauben identifiziert werden. Geschieht dies, wird der Glaube zu einem unsicheren Wissen oder zur Autoritätshörigkeit degradiert. Daher kann sich der christliche Glaube mit unterschiedlichen Aussagen verbinden und kann nicht auf eine bestimmte Aussage absolut fixiert werden. Alle Glaubensausdrücke, alle Glaubenssymbole sind relativ und können nur zu bestimmten Zeiten, in bestimmten geschichtlichen Situationen Wert und Sinn besitzen. Die jesuanische Forderung nach Umkehr (metanoia) unseres Lebens meint diese Lebendigkeit des Glaubens, die sich nicht durch Glaubensgesetze in Ketten legen lässt.
Ist also der Glaube beliebig? Keineswegs! Der Inhalt des Glaubens ist die Nächsten- und Feindesliebe. Daher sagt Johannes, dass die Liebe die Furcht austreibt, und wer noch immer in Angst vor Gefahren und Autoritäten lebt, der ist in der Liebe nicht vollkommen und ist daher im Glauben schwach. Die Liebe erlangt grundlegende Bedeutung, da Leben andernfalls nicht glücken kann. Sie kann der Christ auch mit dem Wort „Gott“ ausdrücken. Denn Gott ist Liebe, sonst nichts. Nicht im Sinne eines vorhandenen Seienden, sondern nur als Sinngebung des sinnlosen Lebens. Liebe ist nicht blind, sondern verstehend. Daher ist im Glauben nichts Absurdes. Glaube, der in der Liebe wirkt, hat nicht nur die praktische Dimension des Einanderliebens, sondern ist verstehende Reflexion über den Lebensvollzug selbst. Daher hat er eine theoretische Dimension, die aufzeigt, wieso Glaube praktisch sinnvoll ist.
Glaubenssymbole kann man wissen, kennen und studieren. Ihr Wert ist, Einsicht über das Leben zu gewinnen. Liebe kann daher in Symbole aufgeschlüsselt werden, wie Gott, Jesus Christus, Gemeinschaft, ewiges Leben, Erlösung, Heil und Unheil usw. Aber wie Paulus sagt (1 Korinther 13), kann ich alle Erkenntnis besitzen und die Welt verbessern, aber alles bleibt bruchstückhaft. Auch die tiefste geistige Einsicht ist begrenzt und findet ihr Ende. Sie mag wichtig sein und den Menschen helfen; Bedeutung aber hat sie nur, wenn sie die Liebe fördert. Das Wissen, wie der Glaube ohne Liebe, ist „Teufelswerk“, weil er Menschen zugrunde richtet. Wissenschaftsgläubigkeit und Autoritätshörigkeit sind Aberglaube. Christen sollten mit dem Aberglauben brechen, umkehren und im Glauben durch die Liebe ihr Leben gestalten. Glaube als Beziehung kann nicht wie das Wissen Gegenstände produzieren. Daher spricht man vom „Geschenk“ des Glaubens oder auch von der „Gnade“.
Glaubensinhalte sind nie endgültig. Glaube richtet sich nicht auf Lehrsätze und Dogmen, die Leitplanken sein können, die auf Gefahren aufmerksam machen. Christlicher Glaube gründet nicht auf Schrift, auf Tradition oder auf kirchlichem Lehramt. Das Lehramt und die Traditionen können gefährlich werden, aber auch hilfreich sein. Eine Tradition, die die historische Asche aufbewahrt, ist leblos, nur als „lebendiges Feuer“, das sie weiterträgt, ist sie sinnvoll. Ein Lehramt kann ein Dialogpartner sein, aber niemals Norm, die im Gewissen bindet. Christlicher Glaube ist als Entscheidung für den Menschen absolut. Norm und Inhalt findet der Christ paradigmatisch in Jesus Christus. Glaube ist Verzicht auf Herrschaft über den Menschen, auf Ausbeutung und daher die Haltung der Geschwisterlichkeit. Glaube und Verstehen sind eins. Christlicher Glaube ist Leben in Vertrauen und in der Hoffnung, dass Liebe besser ist als alles andere und sie das letzte Wort über unser Leben hat. Glaubhaft ist nur Liebe. Daher sieht der Christ in ihr die Sinnerfüllung des Lebens und bezeichnet sie als eine erfahrbare Wirklichkeit, als „Gott“. Christlicher Glaube bezieht sich jedoch auch wesentlich auf Jesus Christus. Menschen, die ihr Leben an der Existenzform Christi orientieren, werden seit fast 2000 Jahren Christen genannt.