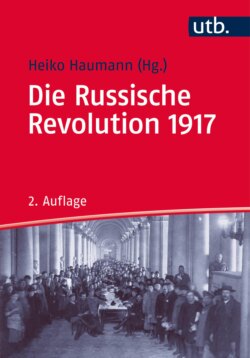Читать книгу Die Russische Revolution 1917 - Группа авторов - Страница 11
Lebenswelten im Zarenreich
Ursachen der Revolution von 1917
Heiko Haumann
Оглавление„Mein Vater, das stimmt, war wirklich ein Bauer, und ich hier in weißer Weste, gelben Schuhen. […] Nur dass ich reich bin, viel Geld habe, aber wenn man sich’s genau überlegt, dann bleibt der Bauer eben Bauer“, sagt der Kaufmann Ermolaj A. Lopachin in Anton P. Čechovs 1903 geschriebener Komödie „Der Kirschgarten“.1 Er ist so reich geworden, dass er das Gut samt Garten kaufen kann, auf dem sein Großvater und sein Vater noch Leibeigene waren, „wo man sie nicht mal in die Küche gelassen hat“ und er selbst als halber Analphabet im Winter barfuß herumlaufen musste. Die Herrschaftsverhältnisse haben sich umgekehrt. Zweihundert Jahre lang hatten die adligen Gutsbesitzer über „lebende Seelen“ geherrscht und auf deren Kosten gelebt – eine Anspielung auf Nikolaj V. Gogol’s berühmten Roman „Tote Seelen“ von 1842, der als Kritik am Leibeigenschaftssystem gelesen werden konnte. Manche Leibeigene, wie der Diener Firs, haben die frühere Ordnung derart verinnerlicht, dass sie die 1861 erfolgte Befreiung als „Unglück“ empfinden. Jetzt aber kann der „Garten Russland“ neu bewirtschaftet werden, „neues Leben“ geschaffen werden.
Lopachin, der aus der Leibeigenschaft aufgestiegene Unternehmer, steht nicht zufällig im Mittelpunkt dieses Theaterstückes. Bedeutende Industrielle zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten sich in ihm wiedererkennen. Traditionell übten Bauern auf dem Land Nebengewerbe aus. Die dörfliche kustar’-Industrie umfasste kleine Handwerksbetriebe ebenso wie große Gerbereien, Leinenwebereien oder Schnapsbrennereien.
Einigen Bauern, häufig Altgläubigen, gelang es namentlich in der Moskauer Region, riesige Textil- und Nahrungsmittelfabriken zu errichten. Zusammen mit einer Anzahl Adliger und Kaufleute bildeten sie den Typus des „Moskauer Unternehmers“: Dieser betonte das „echt Russische“, lehnte ausländische Elemente und auch Auslandskapital [<<17] Seitenzahl der gedruckten Ausgabe ab und strebte eine Eigenfinanzierung seiner Firma an. Er fühlte sich durchaus als „Herr“. Maksim Gor’kij lässt in seinem Čechov gewidmeten Roman von 1899, „Foma Gordeev“, den Kaufmann Majakin auf den „Adel, die Beamten und allerhand andre, die nicht zu uns gehören“, herabsehen, obwohl sie noch „kommandieren“. „Wer ist aber heutzutage der eigentlich Mächtige unter den Menschen? Der Kaufmann ist im Staate der Mächtigste, denn er hat die Millionen!“2 Kulturell orientierten sich diese Unternehmer häufig am adligen Lebensstil.
Die „Moskauer“ kritisierten die staatliche Industrialisierungsstrategie, weil diese die Produktionsmittelindustrie begünstigte. Nach der Jahrhundertwende führte dies manchen „Moskauer“ folgerichtig in eine gemäßigte Opposition zur Regierung, nach der Revolution von 1905 dann in Parteien, die Änderungen des Wirtschaftskurses verlangten. Darüber hinaus förderten sie Wohlfahrtseinrichtungen oder als Mäzene die Künste. Mit prachtvollen Bauten prägten sie das moderne Stadtbild. Ihre Verbindung von geschäftlichem und gesellschaftlichem Engagement brachte sie dazu, nach der Februarrevolution von 1917 die Provisorische Regierung zu unterstützen, teilweise sogar als Minister.
Einen anderen Typus bildete der „Petersburger Unternehmer“. Dieser stammte in der Regel nicht aus der Bauernschaft, sondern hatte als Staatsbeamter, Ingenieur oder Techniker seine Berufslaufbahn begonnen. Charakteristisch war eine Tätigkeit als „Manager“ oder leitender Angestellter in Aktiengesellschaften und Banken. Er befürwortete eine Fremdfinanzierung der Riesenbetriebe in den Bereichen des Brenn- und Rohstoffwesens, der Metallindustrie und dabei vor allem der Rüstungsindustrie durch Auslandskapital und Staatsaufträge. Entsprechend eng sah seine Verflechtung mit dem Staatsapparat aus, zumal ihn die staatliche Politik begünstigte.
Selbstverständlich traten diese Unternehmertypen nicht nur in den beiden Metropolen des Zarenreiches auf, und selbstverständlich gab es auch andere Formen des Unternehmertums in Russland. Sie verdeutlichen aber besonders gut die Möglichkeiten sozialen Aufstiegs, die Vielfalt der Verhaltensweisen und Lebensformen sowie die Zusammenhänge von wirtschaftlicher Aktivität und politischer Orientierung. Obwohl die Unternehmer zahlenmäßig nur eine kleine Schicht darstellten, stieg ihr Einfluss stetig.
Zahlreiche Bauern verließen ihre Dörfer, um in ländlichen oder städtischen Industriezentren als Arbeiter ein besseres Leben zu suchen. Der überwiegende Teil der [<<18] Industriearbeiterschaft kam vom Land. Dieser Zuzug in die Stadt war an sich gar nicht so einfach. Die „Bauernbefreiung“ von 1861 hatte zwar die persönliche Freiheit aus der Leibeigenschaft gebracht, nicht aber die Freizügigkeit. Die Dorfgemeinde, die obščina , musste die Erlaubnis geben, wenn jemand wegziehen wollte. Auf diese Weise sollte die Steuerkraft des Dorfes, für die die obščina solidarisch haftete, erhalten bleiben. Ebenso wurde beabsichtigt, eine Verarmung der Stadtbevölkerung durch eine Massenzuwanderung von Arbeitskräften, die weder hätten beschäftigt noch angemessen untergebracht werden können, zu verhindern. Doch die seit den 1880er-Jahren rasch anwachsende Industrie verstärkte die Hoffnungen auf ein höheres Einkommen außerhalb der Landwirtschaft und damit auch die Bereitschaft der Dorfgemeinden, etliche Bewohner gehen zu lassen: Meistens behielten diese „Bauern-Arbeiter“ ihren Landanteil und damit das Recht, jederzeit – zu Saisonarbeiten oder zur eigenen Sicherheit in Notfällen – wieder zurückkehren zu können. Dafür zahlten sie ihre Steuern weiter und schickten auch, wenn möglich, zusätzlich Geld, so dass sich insgesamt die finanzielle Situation im Dorf verbessern konnte. Die Bewirtschaftung des Landes übernahmen Angehörige.
Die Erwartungen, in den Städten ein schöneres Leben als in den Dörfern zu finden, erfüllten sich allerdings häufig nicht. Lange Arbeitszeiten von zwölf Stunden, die bis 1913 allmählich auf zehn Stunden sanken, oft schwierige Arbeitsbedingungen und eine strenge Arbeitsdisziplin, deren Verletzung hohe Strafen nach sich zog, wurden im Durchschnitt mit einem verhältnismäßig niedrigen Lohn entgolten. Die Lebenshaltungskosten lagen hingegen sehr hoch. Besonders erbärmlich waren die Wohnverhältnisse. Vielfach wurden Männer und Frauen in Baracken oder riesige Schlafsäle gepfercht. Daneben gab es zahlreiche „Schlafgänger“, die lediglich ein Anrecht auf eine Schlafstelle besaßen und diese sich noch mit einem zweiten Mieter teilen mussten, der ihren Platz einnahm, während sie arbeiteten. In den Slums herrschten katastrophale hygienische Zustände, verbreiteten sich Alkoholismus, Prostitution und Kriminalität. Allein in St. Petersburg fielen 1908 14.000 Menschen einer Choleraepidemie zum Opfer.
Abb 1 Dieser Arbeiterschlafsaal mit hölzernen Pritschen in der Moskauer Textilfabrik „Trechgornaja“ galt seinerzeit als modern, weil er hell, luftig und gut beleuchtet war. Fotografen: Édouard und Auguste de Jongh, um 1898. [Bildnachweis]
Wie in anderen Ländern versuchten auch in Russland die Arbeiterinnen und Arbeiter, wenigstens etwas an „Eigen-Sinn“ unter den drückenden Verhältnissen zu retten. Unternehmer klagten immer wieder über Bummelei und „Schwänzen“, über Krankmeldungen und raschen Arbeitsplatzwechsel. Die größte Hilfe, in den Betrieben und städtischen Lebensbedingungen zurechtzukommen, stellten genossenschaftliche Organisationen dar: die arteli, in denen sich „Bauern-Arbeiter“ zusammenschlossen, sowie Landsmannschaften. Diese vermittelten den Zuwandernden – überwiegend waren es junge Männer – eine Arbeitsstelle und eine Wohnung, handelten oft den Lohn aus, standen bei auftretenden Alltagsproblemen zur Seite und zeigten sich bei Arbeitskämpfen [<<19] solidarisch. Darüber hinaus gelangten über die Landsleute Nachrichten von der Stadt ins Dorf und umgekehrt. Ein Informations- und Kommunikationsnetz entstand, das seinesgleichen suchte und in den späteren Revolutionen eine wichtige Rolle spielte.
So wie die „Bauern-Unternehmer“ in gewissen Verhaltensweisen Bauern blieben – Fedor M. Dostoevskij nannte den Kaufmann einmal einen „verdorbenen Bauern“3 –, so streiften „Bauern-Arbeiter“ nicht ohne weiteres bäuerliche Gepflogenheiten ab. Heiratstermine richteten sich oft immer noch nach kirchlichen Traditionen oder nach [<<20] landwirtschaftlichen Erfordernissen: Während der Fasten-, der Aussaat- und der Erntezeit wurde auch in der Stadt selten geheiratet. Eine ganze Reihe von Arbeiterfamilien hielt sich Hühner, Schweine oder Schafe – mit unvorstellbaren Folgen für die Hygiene unter den beengten städtischen Wohnverhältnissen. Das Rollenverständnis von Mann und Frau spiegelte häufig das patriarchalische bäuerliche Muster. In Ess- und Trinksitten, in Begriffen von Ehre und Gerechtigkeit, in religiösen Gewohnheiten und bestimmten Bräuchen drückten sich dörfliche Überlieferungen aus. Wenn etwa ein Vorgesetzter, der sich unbeliebt gemacht hatte, von Arbeitern in einem Schubkarren, einen dreckigen Sack über den Kopf gestülpt, herumgefahren wurde, so erinnert dies an rituelle Rügebräuche aus dem Dorf.
Dort veränderten sich nach der „Bauernbefreiung“ die Zustände zwar langsam, teilweise aber doch tiefgreifend. Die Bauern genossen zunächst einmal, abgesehen von der persönlichen Freiheit, wenig Vorteile durch die Agrarreform. Ihre Dienstleistungen an die Gutsbesitzer blieben erhalten, mussten jetzt allerdings vertraglich geregelt werden. Das Land, das sie bisher bewirtschaftet hatten, sollten sie kaufen; der Staat gewährte 80 Prozent der Summe als Darlehen. Trotzdem konnten sich das zahlreiche Bauern nicht leisten. Sie wählten den „Bettelanteil“ – ein Viertel des bisherigen Landes –, für den sie nichts bezahlen mussten und der sie zugleich von allen Verpflichtungen gegenüber den Gutsherren löste. Wem es nicht gelang, zusätzlich Land zu pachten oder zu kaufen, konnte jetzt kaum existieren. Viele Bauern standen schließlich schlechter da als vor 1861. Ein Großteil empfand die Folgen der Befreiung als Unrecht: Nach wie vor waren sie davon überzeugt, dass das Land eigentlich ihnen gehöre und die Adligen es ihnen geraubt hätten. Zwar galt ihnen Zar Alexander II. als „Befreier“. Aber je deutlicher es wurde, dass der Zar letztlich nicht auf ihrer Seite stand, desto stärker musste seine Autorität ins Wanken geraten.
Trotz der Nachteile, die die Agrarreform mit sich brachte, erwiesen sich die Bauern als erstaunlich anpassungsfähig. Sie nutzten die Möglichkeiten, die sich ihnen nun boten, und wandten sich in Konfliktfällen an die neu ernannten Friedensrichter – eine bald schon wieder wegen angeblich zu großer Bauernfreundlichkeit aufgehobene Institution – oder klagten vor den jetzt eingerichteten regionalen Gerichten bei Familien-, Besitz- und Erbstreitigkeiten. Frauen versuchten auf diesem Wege, sich gegen materielle Benachteiligung, Prügel und sexuelle Gewalt zu wehren. Die dörfliche Selbstverwaltung in der obščina wurde intensiv wahrgenommen. Diese setzte sich seit 1864 in regionalen Parlamenten fort, den zemstva oder „Landschaften“, eine Art Landtag. Die Haushaltsvorstände in den Dörfern, die das Entscheidungsgremium der obščina bildeten, waren hier neben den Grundbesitzern außerhalb der Dorfgemeinden sowie Städtern vertreten. Das komplizierte Wahlverfahren sicherte allerdings das Übergewicht [<<21] des Adels. Die Befugnisse der zemstva umfassten insbesondere das Steuerwesen, die Armen- und Krankenfürsorge, die Förderung von Handel und Industrie namentlich durch eine Verbesserung der Infrastruktur, das Schul- sowie das Gefängniswesen. Bauern beteiligten sich stärker als erwartet an diesem neuen Selbstverwaltungsorgan und arbeiteten dort mit liberal oder sozialistisch eingestellten Fachleuten zusammen, mit Wirtschaftsexperten, Statistikern, Lehrern und Ärzten. Schnell stieß dies auf den Widerstand von Teilen des grundbesitzenden Adels. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts beschränkte die Regierung dann die Rechte der zemstva wieder, gliederte sie stärker in die Staatsverwaltung ein und bevorzugte mit einem neuen Wahlrecht die nichtbäuerlichen Grundbesitzer noch mehr als zuvor.
Auch in der Landwirtschaft selbst zeigte sich die Mehrheit der Bauern als äußerst flexibel. Der wenig kapitalintensive bäuerliche Familienbetrieb konnte sich auf die wirtschaftlichen Wechsellagen und die neuen Marktbedingungen unerwartet gut einstellen. Bei erheblichen regionalen Differenzierungen scheint gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine leichte Verbesserung der bäuerlichen Landwirtschaft eingetreten zu sein. Aber sie blieb anfällig für Krisen und Missernten, zumal nur die wenigsten Bauern nennenswerte Überschüsse erwirtschaften konnten. Zwar lieferten die Bauern, teilweise durch Steuerdruck erzwungen, zunehmend mehr Getreide und sonstige Lebensmittel in die Städte und an den Staat, der mit dem Export Devisen für seine Industrialisierungspolitik erhalten wollte. Wenn jedoch etwa eine extreme Dürre die Ernte weitgehend vernichtete, waren kaum Rücklagen vorhanden, und es kam – wie 1891/92 – zu einer furchtbaren Hungersnot. Das größte Strukturproblem in den Dörfern, das auch politischen Zündstoff in sich barg, blieb die Landarmut bei wachsendem Bevölkerungsdruck. Die Bauern konnten kaum davon profitieren, dass zahlreiche Kleinadlige nach 1861 ihr Land verkauft hatten. Meist waren Großgrundbesitzer die Nutznießer gewesen. Als nach 1900 Teile des Adels versuchten, ihren Landanteil auf Kosten der Bauern auszudehnen, stießen sie in den Dörfern auf entschiedenen Widerstand. Die Anzeichen mehrten sich, dass die Bauern nicht mehr bereit waren, das Vorgehen der Agrarier, der Großgrundbesitzer, und die staatliche Politik, die diese begünstigte, einfach hinzunehmen.
Abb 2 Während der „Zeit der schlechten Wege“ im Frühjahr und Herbst, der rasputica, versinkt das russische Dorf regelmäßig im Schlamm. Diese Ansicht des Dorfes Smolencevo, die vermutlich nach der Revolution von 1917 aufgenommen wurde, zeigt nicht nur Verhältnisse, wie sie auch für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts typisch waren, sondern zugleich den Versuch, durch eine Befestigung der Wege eine Verbesserung der Zustände zu erreichen. Schottermaterial war Mangelware. Fotograf unbekannt. [Bildnachweis]
Die wirtschaftlichen Verhältnisse seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts brachten auch eine soziale Differenzierung im Dorf mit sich. Während ein Teil der Bauern ärmer wurde, gelang einigen der Aufstieg in eine – oft labile – Wohlhabenheit: Sie verfügten über ein bisschen mehr Land, über eine Kuh oder ein Pferd mehr, über die eine oder andere Arbeitskraft mehr als der Durchschnitt. Hin und wieder verstanden sie es auch, mit dem Geld besser umzugehen und durch Kredit- und Wuchergeschäfte ihr Vermögen anzuhäufen. Abschätzig galten sie den meisten Bauern als „Kulaken“. [<<22] Wörtlich bedeutet dies „Fäuste“ und meinte hier Menschen, die auf unsaubere Weise ihr Besitztum geschaffen hatten und andere peinigten. In den Dorfgemeinden und in den zemstva gaben sie oft den Ton an. Damit waren viele Bauern unzufrieden.
Abb 3–11 „Typen“ der russischen Gesellschaft: ein Straßenkehrer, ein Fest im Dorf – vermutlich eine Hochzeit –, eine Kutschfahrt im Schnee und Schlamm, ein Bauer mit Kind beim Pflügen mit dem Hakenpflug, Szenen auf dem Markt und dem Basar, Transport landwirtschaftlicher Geräte mit Kamelen in Mittelasien, eine hölzerne Mühle bei Omsk oder Wolga-„Strolche“. Unter der Bezeichnung „Types russes“ oder „Types de Russie“ erschienen um 1900 in Russland umfangreiche Postkartenserien mit vermeintlich typischen Volks- oder Berufsgruppen des Zarenreichs. Dahinter stand die Vorstellung, einen „kollektiven Körper“ der „Anderen“ und „Fremden“ konstruieren zu können, von dem sich das eigene Selbstverständnis absetzen konnte. „Typenfotografien“ waren weitverbreitet in kolonialistischen Darstellungen, aber auch im heimatlichen Umfeld etwa zur Abgrenzung von angeblich „rückständigen“ Bevölkerungsgruppen. Erst bei genauerer Analyse der einzelnen Postkarten wird deutlich, dass es sich nicht um spontane Alltagsaufnahmen vor Ort handelte, sondern um Studioinszenierungen, die im fernen Moskau, St. Petersburg, Deutschland oder Schweden gedruckt und umständlich an den Ursprungsort zum Verkauf zurücktransportiert wurden. Dieser Produktionsprozess, die Zirkulationsgeschichte sowie die Bild- und Textseite machen die Postkarten zu einer komplexen, außerordentlich lohnenswerten historischen Quelle. [Bildnachweis] [<<24]
Seit Ende des 19. Jahrhunderts sorgte die Ansichtskarte für eine Erweiterung der fotografischen Möglichkeiten und länderübergreifend für eine völlig neuartige Form der Kommunikation. Erschwinglich für breite Bevölkerungsschichten, konnte sie mit kurzen Grußbotschaften aus fast allen Winkeln des Globus verschickt werden und erlaubte so die Aneignung eines Stückchens „Welt“ in den heimischen Wohnstuben. Die Bildseite der Fotopostkarten hatte vielfach nicht nur illustrativen Charakter, sondern transportierte – wie Fotografien allgemein – „Ansichten“, dabei auch Vorurteile und Stereotypen: In den multiethnischen Imperien wie dem Zarenreich oder der Habsburgermonarchie dokumentierten die Abbildungen oft ethnische Differenz, in der Russischen Revolution, den Weltkriegen und dem Kalten Krieg dienten sie vielfach der Propaganda. Fotografien – und mit ihnen die Fotos auf der Ansichtskarte – sind „gemacht“ und nicht einfach ein Abbild der Wirklichkeit. Als historische Quelle fristete die Postkarte lange Zeit ein Schattendasein; sie galt meist nur eingefleischten Sammlern als aufbewahrungswürdig. So verdankt unser Buch seine Postkarten der Sammelleidenschaft der privaten Sammlerfamilien Radzievsky und Gribi.
Jenseits der standardisierten Massenware mit vermeintlich beliebiger Motivik und aussagearmen formelhaften Kurzmitteilungen offenbart sich in diesem kleinen Kommunikationsmedium eine durchaus wichtige historische Quelle, die bei kritischer Betrachtung vielerlei Aufschlüsse zu geben vermag – nicht zuletzt über Lebenswelten. Die Bildseite dokumentiert die Ansichten des Fotografen, des Künstlers oder Auftraggebers, gleichzeitig lässt sie Rückschlüsse auf den Geschmack und die Absichten, eventuell auch Wahrnehmungen des Senders oder der Senderin zu. Zusätzliche Auskünfte geben die Textbotschaften, die hier aber nicht berücksichtig werden konnten.
Die für dieses Buch verwendeten Ansichtskarten wurden in erster Linie aufgrund ihrer Motivik ausgewählt. In manchen Fällen können sie als einmalige Dokumentation verschwundener Lebenswelten gelten. So kommen in ihnen Straßenansichten, Berufsgattungen, Gegenstände, Kleidungen, gesellschaftliche Normen, Rituale, Armut, Selbst- und Feindbilder zum Vorschein, die über andere historische Quellen nur ansatzweise oder gar nicht mehr rekonstruierbar sind. Die Bildwelten, die auf den gemalten wie auch den fotografierten Karten zu erkennen sind, verweisen stets auch auf die Sinnwelten ihrer Schöpfer. Diese hatten eine nicht zu unterschätzende Definitions- und Deutungsmacht: Sie wählten ihre Sujets aus, inszenierten aufwendig spontan wirkende Straßenaufnahmen, sie retuschierten, montierten und kolorierten. Besonders deutlich wird dies bei den „Typenbildern“. [<<25]
Überlieferte Bräuche, Gewohnheiten und Einstellungen trafen sich mit neuen Einflüssen aus den Städten und Industriezentren. Als sich aber die traditionellen Werte aufzulösen begannen, ging dies mit Orientierungslosigkeit und Unruhe einher. So berichteten zeitgenössische Beobachter nach der Jahrhundertwende zunehmend über gewalttätiges chuliganstvo von Jugendlichen in den Dörfern, über Hooliganismus und Rowdytum. Dies verband sich mit anderen Gewaltformen im Dorf, die vielfach ein Erbe des Leibeigenschaftssystems waren. Bauern hatten sich oft nur mit Gewalt gegen Übergriffe der Adligen wehren können. Nun waren sie vielfach enttäuscht, dass das politische System nicht stärker auf ihre Wünsche und Bedürfnisse einging. Ihre [<<23] Eigentumsvorstellungen sahen sie häufig am besten durch Selbstjustiz geschützt, die etwa bei Pferdediebstählen schnell in Lynchjustiz übergehen konnte. Gewalttätigkeit, auch gegen den Nachbarn, die eigene Frau oder das eigene Kind, war durch jahrhundertelange Prägungen zur Gewohnheit geworden, nicht zuletzt schließlich Folge von Trinkorgien an Kirchen- und Erntefesten. „Ja, es war schrecklich, mit ihnen zu leben, aber sie waren doch Menschen, sie litten und weinten wie Menschen, und in ihrem Leben gab es nichts, wofür man keine Rechtfertigung oder Entschuldigung gefunden hätte. Da war ihre schwere Arbeit, von der ihnen in der Nacht der ganze Körper weh tat, die grausamen Winter, die dürftigen Ernten, die Enge. Und keine Hilfe“, heißt es in Čechovs Erzählung „Die Bauern“ von 1897.4
Neben der Gewalt gab es jedoch auch Fürsorge und Organisationskraft, Frömmigkeit und Gemeinschaftsbewusstsein, Ehrbegriffe und Gerechtigkeitssinn, Liebe und Zärtlichkeit. Lev N. Tolstoj etwa schilderte dies in seinen Werken. 1902 veröffentlichte er die Lebensgeschichte einer Bäuerin. Von den Eltern mit einem ungeliebten Mann verheiratet, fasst die Frau mit der Zeit doch eine Zuneigung zu ihm und folgt ihm sogar, als er nach einem Kuhdiebstahl zur Verbannung verurteilt wird, nach Sibirien.5 Viele Bauern wurden nach wie vor von nichtkapitalistischen Vorstellungen geprägt. Dies zeigt sich etwa in Forderungen, die 1906 an das russische Parlament gestellt wurden: Der Staat möge so viel Land zuteilen, dass es unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten „für die Deckung durchschnittlicher Bedürfnisse an Versorgung, Wohnung, Kleidung sowie für die Zahlung der Abgaben ausreicht“.6
Der Adel war ebenfalls, wie alle anderen sozialen Gruppen, keine geschlossene Einheit. Sehr viele Kleinadlige waren verarmt und lebten dürftig wie die Bauern oder auf Kosten von reichen Verwandten, soweit es ihnen nicht gelungen war, im Staatsdienst oder in der Wirtschaft eine auskömmliche Stellung zu finden. Manche ehemaligen Grundbesitzer nutzten nach der Agrarreform von 1861 die neuen Möglichkeiten, ihr Land und die ihnen zustehenden Verpflichtungen ablösen zu lassen, und wandten sich [<<26] der Geldwirtschaft und dem Kapitalismus zu. Ein Teil von ihnen wurde zu wohlhabenden Unternehmern, vertrat liberale Anschauungen und arbeitete in den zemstva mit.
Andere waren bestrebt, ihre Gutswirtschaft nach kapitalistischen Prinzipien zu führen. Einige sahen sich dabei als „reumütige“ Idealisten, die die Schäden der Leibeigenschaft an den Bauern wiedergutmachen wollten. Tolstoj ließ schon 1856, also noch vor der Agrarreform von 1861, einen solchen Gutsbesitzer seine Ziele darlegen: „Auf diese einfache, empfängliche, unverdorbene Volksklasse einwirken, sie von der Armut befreien, ihnen Wohlstand geben und Bildung vermitteln, die ich glücklicherweise besitze, sie von ihren Fehlern und Schwächen zu heilen, deren Wurzel Unwissenheit und Aberglaube sind, die Sittlichkeit entwickeln, sie das Gute lieben lehren … Welch eine glänzende, glückliche Zukunft!“7 Die Bauern verweigerten sich allerdings einer derartigen „Zivilisierung“.
Eine Reihe der Großgrundbesitzer, namentlich in den fruchtbaren Gegenden Südrusslands, war Nutznießer der „Bauernbefreiung“. Sie vergrößerten auf Kosten der Bauern wie der Kleinadligen ihren Landbesitz, verpflichteten sich die Bauern durch Regulierungsverträge oder Anstellungen als Landarbeiter und produzierten Getreide sowie sonstige Erzeugnisse für die Städte und den Export in das Ausland. In der Regel blieben sie in ihren traditionellen Denk- und Verhaltensweisen verhaftet und pflegten einen aufwendigen Lebensstil. In vielen literarischen Arbeiten wird der Landadlige als jemand geschildert, der „nie etwas tat“ und seine Tage in „glückseligem Müßiggang“ verbrachte.8
Nur wenige adlige Großgrundbesitzer investierten ihre Gewinne in die Industrie. Damit verschärften sie eines der Strukturprobleme der russischen Industrialisierung: den Mangel an Kapital. Eigentlich war genügend Vermögen in Russland vorhanden, das als Kapital hätte verwendet werden können, aber es konnte nicht mobilisiert werden. Freiwillig gaben es jene Adligen nicht. Und an eine progressive Einkommenssteuer, die den Reichen Geld für die Gemeinschaftsaufgaben genommen hätte, traute sich die Staatsspitze nicht heran. Trotz ihrer angesichts der Industrialisierung schwindenden wirtschaftlichen Bedeutung übten namentlich die Agrarier nach wie vor politisch einen hohen Einfluss aus. Zar Nikolaj II. umgab sich mit adligen Ratgebern. Gegenüber „bürgerlichen“ Fachkräften blieb er misstrauisch, auch wenn er [<<27] sich häufig Anforderungen der Industrie beugen musste, um Russlands Großmachtposition nicht zu gefährden.
Abb 12 Freizeitvergnügen am zarischen Hof in Carskoe Selo. Fotograf: Karl E. von Hahn, 1902. Hahn hatte ein Fotostudio in Carskoe Selo, war einer der beliebtesten Hoffotografen und unterwies die gesamte Zarenfamilie im Fotografieren. [Bildnachweis]
Der zarische Hof in der Hauptstadt St. Petersburg oder in der zweiten Metropole Moskau lebte in einer Welt, die nichts gemein hatte mit der Welt der Bauern und Arbeiter und sich auch wenig um deren Nöte kümmerte. Der Zar stand gemäß der zeitgenössischen Begrifflichkeit dem „Volk“ gegenüber. Dazwischen bewegte sich die „Gesellschaft“, das waren die Besitzenden und Gebildeten. Diese Großgruppen waren gewiss nicht einheitlich, sondern in sich zergliedert und in ihren Anschauungen gespalten. Und doch lässt sich an den Gegensätzen und Verbindungslinien zwischen ihnen deutlich machen, wie das zaristische System zusammengehalten wurde und wie es schließlich auseinanderbrach.
Dazu müssen auch die Probleme der über einhundert Nationalitäten und ethnischen Gruppen im Vielvölkerreich Russland berücksichtigt werden. Wiederum stoßen wir auf die strukturelle Vielschichtigkeit des Landes. Hier seien nur wenige Beispiele [<<28] genannt. Nicht zuletzt aufgrund der Konflikte mit der Zarenherrschaft hatte sich in den Regionen Polens, die durch die Teilungen des früheren Reiches zwischen 1772 und 1815 nach Russland eingegliedert worden waren, ein starkes Nationalbewusstsein ausgeprägt. Nach dem Scheitern der Aufstände von 1830 und 1863 konzentrierte sich die Nationalbewegung darauf, die Wirtschaftskraft des Landes zu erhöhen und die Bildung zu verbessern, um auf diese Weise ihre Position gegenüber der zarischen Regierung zu stärken. Ihr Bemühen um eine größere Geschlossenheit der eigenen Reihen führte allmählich zu einer Ausgrenzung der nichtethnischen und nichtkatholischen Polen, etwa der Juden.
In der Ukraine beriefen sich nationale Gruppen – häufig Angehörige der intelligencija, die anfangs vorwiegend aus dem niederen Adel und der Geistlichkeit stammten – auf die Tradition der freien Kosaken-„Republiken“, der Hetmanate. Allerdings trafen sie nur auf schwache Resonanz in der mehrheitlich aus Bauern bestehenden ukrainischen Bevölkerung. Für sie war die Lösung sozialer und wirtschaftlicher Probleme dringender. Aus den sozialen Gegensätzen zwischen ukrainischen Bauern, polnischen und russischen Gutsbesitzern, jüdischen Händlern, russischen Beamten und Unternehmern sowie russischen Arbeitern lassen sich unmittelbar weder ethnische noch konfessionelle Konflikte ableiten. Neben dem Judentum hatte der Katholizismus der Polen Platz, während Russen wie Ukrainer der orthodoxen Kirche angehörten. Unter den Ukrainern fand zudem insgeheim immer noch die von der zarischen Regierung verbotene Unierte Kirche Anhänger, die im Ritus den Orthodoxen, im Glauben jedoch den Katholiken folgte. Erst allmählich – nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Unterdrückung seitens der zaristischen Behörden – konnten die Träger der nationalen Idee Fuß fassen, wenngleich bis zum Ersten Weltkrieg keine Massenbewegung entstand. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen ließen es – trotz vielfältiger Verflechtungen – auch nicht zu, mit ihren Gesinnungsfreunden unter den Ukrainern Österreichisch-Galiziens eine einheitliche Bewegung zu bilden.
Eine andere Form zeigte sich bei den Bergvölkern des Kaukasus, die immer wieder bewaffnet gegen die Russen Widerstand leisteten und sich dabei auf ihre alten Freiheiten und ihre Vergangenheit beriefen.
Noch kaum berührt von einer Nationalidee waren die zahlreichen Nomadenstämme im asiatischen Teil Russlands. Bei anderen Ethnien begann sich eine nationale Identität tastend herauszubilden. In den muslimischen Regionen entfalteten sich Reformbewegungen, die einen grenzüberschreitenden Austausch mit muslimischen Zentren außerhalb des Imperiums und entsprechende Netzwerke befürworteten.
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts strebte die zarische Politik – anders als zuvor – danach, als Antwort auf soziale Konflikte und sich ausbreitende National [<<29] bewegungen die unterschiedlichen politischen Strukturen in den verschiedenen Gebieten zu vereinheitlichen, eine Russifizierung voranzutreiben und einen großrussischen Nationalismus zu fördern. Autonomierechte wurden aufgehoben, die zaristische Bürokratie griff vermehrt in regionale Verwaltungsstrukturen ein, in den Schulen wurde der Russischunterricht verstärkt, Nichtorthodoxe sahen sich in ihrer Religionsausübung zunehmend behindert. Über die Industrialisierung und den Bau eines umfangreichen Schienennetzes, insbesondere der Transsibirischen Eisenbahn, erfolgte eine mit wirtschaftlicher Ausbeutung verbundene Kolonisierung bisher kaum kontrollierter Räume im Osten des Reiches. Als sich dort dann russische Siedler niederließen, um die Gegenden zu erschließen und zugleich eine „zivilisatorische Mission“ zu erfüllen, kam es vor allem in Zentralasien in wachsendem Maße zu Zusammenstößen mit den Nomaden, die ihr Land behalten und ihre traditionelle Kultur bewahren wollten.
Ein einheitliches Nationalbewusstsein im zarischen Imperium konnte auf diese Weise nicht geschaffen werden. Im Gegenteil verstärkten sich die Spannungen, die leicht in offene Auseinandersetzungen umschlagen konnten. Der Zar und die Autokratie, die formal unumschränkte Selbstherrschaft, bildeten das einzige Band, das das Land zusammenhielt. Bei den Völkern mit einer starken Nationalbewegung, die sich von Russland lösen wollten, hatte es sich bereits gelockert, ebenso bei den sozial benachteiligten Gruppen. Unter den ethnischen Russen unterstützte die Führung der orthodoxen Kirche die Autokratie, mit der sie eng verbunden war. Um die widerstreitenden Kräfte innerhalb der konservativen Kreise zusammenzuhalten und zugleich das „Volk“ wieder enger an den Zaren zu binden, förderten Mitglieder der Staatsspitze den Antisemitismus als Integrationsideologie. „Der Jude“ galt als Gegner, weil er alles in ihren Augen Negative der „Moderne“ – ganz gleich, ob Kapitalismus, Liberalismus oder Sozialismus – nach Russland gebracht habe.
Juden in größerer Anzahl lebten im Russischen Reich erst seit der Annexion von Gebieten im Westen, insbesondere seit den Teilungen Polens. Kleinere Gruppen wohnten im Kaukasus – die „Bergjuden“ – und in Zentralasien. Seit Ende des 18. Jahrhunderts bis in den Ersten Weltkrieg hinein durften die Juden in Westrussland, von einigen Ausnahmen abgesehen, ihren „Ansiedlungsrayon“ – einen breiten Streifen von Litauen bis zum Schwarzen Meer – nicht verlassen. Während des 19. Jahrhunderts wurden sie mehr und mehr diskriminiert. Auf diese Weise wollte der Staat sie von ihrer traditionellen Kultur abbringen, „zivilisieren“ und dann „integrieren“. Nur während der Reformzeit unter Zar Alexander II. schien sich eine Wende zum Besseren anzubahnen. Nach seiner Ermordung 1881 zerschlugen sich jedoch alle Hoffnungen. Vielerorts wurden russische Bauern und Kleinbürger mit der Behauptung, Juden stünden hinter dem Terroranschlag, zu gewalttätigen Ausschreitungen – Pogromen – aufgehetzt. [<<30] Dieses Muster wiederholte sich immer wieder in den folgenden Jahrzehnten, verstärkt durch die in konservativen Kreisen propagierte Judengegnerschaft.
Mehr und mehr Juden zweifelten deshalb an der Möglichkeit einer Integration. Die meisten gaben ihre Kultur nicht auf. Andere orientierten sich an nationalistischen oder sozialistischen Ideen. Persönlichkeiten wie Šlojme Zanvil Rapoport, der sich als Schriftsteller Semën Akimovič An-skij nannte, brachten den Zwiespalt zwischen Altem und Neuem zum Ausdruck. Er schrieb Erzählungen, Romane und Dramen in Russisch und Jiddisch, engagierte sich politisch als Sekretär Petr L. Lavrovs in der Sozialrevolutionären Partei, dann im Jüdischen Arbeiterbund. Unersetzliche Schätze jüdischen Volkslebens sammelte er durch Expeditionen in den „Ansiedlungsrayon“. Sein Ziel war es, in der Begegnung von Kulturen die jüdische Tradition mit den neuen Lebenswelten zu verbinden und dadurch eine neue Tradition und ein neues Volksbewusstsein zu schaffen. Er sah sich „an der Grenze zwischen zwei Welten“,9 zwischen Russisch und Jiddisch, Juden und Slaven, Juden und Christen, Mystik und Rationalismus. Nicht zufällig thematisierte sein bekanntestes Werk, das Drama „Dibuk“ („Der böse Geist“) mit dem Untertitel „Zwischen zwei Welten“, in dem er eine alte jüdische Legende verarbeitete, ein ruheloses Wesen zwischen Toten und Lebenden, das „neue Wege“ suchte.10
Die Vielfalt der Lebenswelten und die unterschiedlichen Interessen der Akteure konnten von den zarischen Regierungen immer weniger angemessen aufgegriffen und in eine überzeugende Politik umgesetzt werden. Erschwert wurden alle Bemühungen zusätzlich durch die Integration des russischen Imperiums in das Weltsystem. Russland besaß keine Kolonien außerhalb des Reiches – dafür kolonisierte es in den eigenen Regionen –, aber befand sich dennoch politisch, militärisch, ökonomisch und kulturell in globalen Verflechtungen, mit denen es sich auseinandersetzen musste. Die Erschließung des Raumes – namentlich durch die Eisenbahnen, aber auch durch neue Kommunikationsmedien wie Telegrafie und Post – diente als Teil der Kolonisierung der Festigung des Reiches und folgte zugleich militärstrategischen Überlegungen, machtpolitischen Interessen sowie dem Anschluss an den Weltmarkt und den „Weltverkehr“, erweiterte jedoch auch die Raumerfahrung zahlreicher Men [<<31] schen.11 Desgleichen wiesen die Migrationsströme – etwa Einwanderungen aus asiatischen Gebieten und Auswanderungen von Polen, Muslimen sowie Juden – auf die Eingliederung Russlands in internationale Vernetzungen hin. Als Imperium stand das Zarenreich in außenpolitischen Bündnissystemen und strebte nach Bewahrung seiner Großmachtstellung, nach der Festschreibung von Interessengebieten und nach machtpolitischer Expansion, die den Wunsch nach Ausweitung von wirtschaftlichen Marktbeziehungen einschloss. Damit war es von internationalen Konflikten betroffen.
Eine Reaktion darauf ist auch in Russlands Beitrag zum Völkerrecht zu sehen: Die Landkriegsordnung und die Einrichtung einer Schiedsgerichtsbarkeit, die 1899 in der Friedenskonferenz von Den Haag verabschiedet wurden, gingen nicht zuletzt auf russische Initiative zurück. Die Konzeptionen hatte der liberale Jurist Fedor F. Martens entworfen. Sie stellten einen bedeutenden Versuch dar, ein neues globales System zur Verhinderung von Kriegen und zumindest zur „Humanisierung“ der Kriegsführung zu schaffen. Eine entschiedene Abrüstung oder eine grundlegende Abwendung von einem durch militärische Stärke geprägten Denken blieben allerdings nach wie vor in weiter Ferne. Von der Einbindung in das kulturelle Weltsystem zeugten vielfältige Kontakte der Schriftsteller und Künstler, ein wachsender Austausch von Theaterkonzeptionen und Kunstausstellungen oder auch eine Internationalisierung des Sports, etwa mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Stockholm 1912.
Die internationale Verflechtung beeinflusste wesentlich die Wirtschaftspolitik. So gewann eine Industrialisierungskonzeption die Oberhand, die der Förderung der Produktionsmittelindustrie durch den Staat mittels Aufträgen und Heranziehung von Auslandskapital uneingeschränkten Vorrang gab, nicht zuletzt, um den Eisenbahnbau und die militärische Rüstung voranzutreiben. Dass schließlich am Vorabend des Ersten Weltkrieges rund die Hälfte der Neuinvestitionen aus dem Ausland kam, zeigt beispielhaft das Ausmaß der internationalen Verbindungen. Doch eine entschlossene und geradlinige Umsetzung der Konzeption gelang nicht. Die Richtungskämpfe zwischen „Petersburger“ und „Moskauer“ Unternehmern sowie zwischen Industriellen und Agrariern, die sich auch in Auseinandersetzungen innerhalb des Staatsapparates niederschlugen, verwässerten die entsprechenden politischen Maßnahmen. Die strukturelle Vielschichtigkeit Russlands führte zu einem „verkrüppelten Kapitalismus“.12 [<<32]
Nach der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verschärften sich die Widersprüche und Gegensätze wegen einer für den Getreideexport ungünstigen weltwirtschaftlichen Konjunktur sowie sich zuspitzender sozialer Konflikte in Industrie und Landwirtschaft. Hinzu kamen Unruhen unter Nationalitäten und Studierenden sowie Versuche oppositioneller Bewegungen, sich insbesondere über die zemstva auch legal zu organisieren. Zusätzlichen Druck brachten außenpolitische Probleme, die mit der Expansion des Russischen Reiches in die Mandschurei zusammenhingen. Sie gipfelten 1904/05 im Krieg mit Japan. Die zarische Regierung erhoffte sich einen schnellen Sieg, um damit von den inneren Schwierigkeiten abzulenken, musste jedoch eine demütigende Niederlage hinnehmen. Dieser Prestigeverlust verstärkte die Unzufriedenheit im Land. Zudem führte der Krieg zu Versorgungsengpässen bei der Zivilbevölkerung.
Die Vereinigung der russischen Fabrikarbeiter St. Petersburg, die unter Leitung des ursprünglich regierungsfreundlichen Priesters Georgij A. Gapon stand, verlangte eine Verbesserung der materiellen Lage und mehr Mitsprachemöglichkeiten. Im Dezember 1904 streikten die Arbeiter der Putilov-Werke in St. Petersburg. Als die Betriebsleitung auf ihre Forderungen nicht einging, kam es zu einer Radikalisierung. Die Arbeiter – unterstützt von Sozialrevolutionären, Sozialdemokraten und Liberalen – beschlossen, Bittschriften zu verfassen und sie dem Zaren zu überreichen. Die zentrale Petition, die rund 150.000 Menschen unterschrieben, war in respektvollem, aber doch deutlichem Ton gehalten: „Wir, Arbeiter und Bewohner der verschiedenen Stände St. Petersburgs, unsere Frauen und Kinder und hilflosen Greise und Eltern kommen zu Dir, Herrscher, und suchen Gerechtigkeit und Schutz. Wir sind zum Bettler geworden, man unterdrückt uns, belastet uns mit unerträglicher Arbeit, man schmäht uns, man erkennt uns nicht als Menschen an, man behandelt uns als Sklaven, welche ihr bitteres Los ertragen und schweigen müssen. Wir haben geduldig ausgehalten, aber man treibt uns immer weiter in den Abgrund der Armut, der Rechtlosigkeit und der Unwissenheit, uns erstickt Despotismus und Willkür und wir ersticken. Herrscher, wir haben keine Kraft mehr. Die Grenze der Geduld ist erreicht. Für uns ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Sterben besser ist als die Fortsetzung der unerträglichen Qualen.“ Für unbedingt notwendig hielten die Bittsteller die Erklärung der Menschenrechte, die Einberufung einer Verfassunggebenden Versammlung, die Verantwortlichkeit der Minister vor dem Volk – statt wie bisher nur vor dem Zaren –, eine Amnestie für die Verbannten, Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungs- und Rechtswesens, des [<<33] Steuer- und Finanzsystems sowie grundlegende Änderungen in der Arbeitsverfassung, darunter die Einführung des Acht-Stunden-Tages, einen angemessenen Arbeitslohn und Mitspracherechte der Arbeiter in den Betrieben.13
Am 9. Januar 1905 zogen die Demonstranten friedlich mit ihren Bittschriften zum Winterpalais. Sie trugen Zarenbilder und Ikonen mit sich. Die Offiziere der Wachmannschaften waren jedoch angesichts der Menschenmenge überfordert und gaben den Schießbefehl. Panik entstand, weit über einhundert Tote waren zu beklagen. Dieser „Blutsonntag“, dem am 16. Januar in Warschau ein zweiter folgte, löste eine Streikwelle aus, die in eine revolutionäre Massenbewegung überging.
Bis zum Herbst 1905 weitete sich die Revolution über Russland aus. Fast alle oppositionellen Kräfte, von gemäßigten Liberalen bis zu radikalen Sozialisten, verbanden sich, um Demokratie, soziale Verbesserungen und Rechte für die nationalen Minderheiten zu erreichen. Die Bewegung gipfelte im Oktober in einem Generalstreik, den ein Rat, ein Sowjet, leitete. Drucker und Eisenbahner legten die Kommunikationsnetze des Reiches lahm und nutzten sie für ihre eigenen Zwecke. Der Zar und seine Regierung mussten mehr und mehr zurückweichen. Als der Zar jedoch mit seinem Oktobermanifest eine gesetzgebende Duma, ein Parlament, ankündigte, begann die Geschlossenheit seiner Gegner zu bröckeln. Die Arbeiterschaft, die sich vermehrt in Sowjets organisierte, kämpfte weiter und ging im Dezember in Moskau sogar zum bewaffneten Aufstand über. Dieser wurde blutig niedergeschlagen. Eine Vereinigung mit rebellierenden nationalen Gruppierungen und mit der erst jetzt erstarkenden Bauernbewegung gelang nicht. Unter Einsatz aller Gewaltmittel konnte die Regierung Schritt für Schritt wieder Herrin der Lage werden. Die verschiedenen Strömungen im „Volk“ waren nicht zusammengeflossen, und die Verbindung zur „Gesellschaft“ – zu den Gebildeten und Besitzenden – hatte sich als brüchig erwiesen. Dadurch, dass ein Teil der Liberalen auf die Seite des Zaren übergegangen war, entstanden nun sogar eine tiefe Kluft und Misstrauen gegenüber dem Verhalten der „Gesellschaft“.
Auffallend war das Verhalten vieler Soldaten. Einzelne Truppenteile stellten sich auf die Seite der Aufständischen oder meuterten und gingen später doch wieder gegen die Streikenden vor. Manchmal kam es zu mehrfachem Seitenwechsel. Offenbar waren dafür weniger politische Anschauungen ausschlaggebend, sondern die Orientierung an der jeweiligen Autorität. Dieses Schwanken deutete an, wie brüchig die an den Zaren gebundene Ordnung geworden war. [<<34]
Trotz des Scheiterns der Revolution war das Machtgefüge nicht mehr das gleiche wie vorher. Am 23. April 1906 verordnete der Zar die „Grundgesetze“, eine Verfassung, durch die ein Zweikammersystem mit dem Reichsrat als Oberhaus und der Duma als Unterhaus geschaffen wurde. Die Duma erhielt Rechte bei der Aufstellung des Staatshaushaltes und in der Gesetzgebung. Die Wahlen zur ersten Duma bescherten den Parteien, die das zarische System unterstützten, eine vernichtende Niederlage. Der Zar löste deshalb das Parlament sofort wieder auf. Als die Wahl zur zweiten Duma ein ähnliches Ergebnis brachte, entschloss sich der Zar 1907 zu einem Staatsstreich, indem er nicht nur die erneute Auflösung verfügte, sondern zugleich ein neues Wahlgesetz erließ. Dieses begünstigte die Konservativen in einer Weise, dass sie zwangsläufig die Mehrheit in den folgenden Dumas erringen mussten. Die „eingeschränkte Autokratie“ hielt sich offenbar für stark genug, sich bei Bedarf über die Verfassung hinwegzusetzen. So war die Zeit zwischen 1905 und 1917 von widersprüchlichen Tendenzen gekennzeichnet: Leichten Fortschritten bei den Mitspracherechten des Parlaments, bei der Stärkung liberaler Elemente und bei der Politisierung der Bevölkerung standen Versuche entgegen, diese Entwicklung zu blockieren und den früheren Zustand wiederherzustellen.
Nachdem der Schock über den Verlauf der Revolution von 1905 überwunden war, verbreitete sich in weiten Kreisen der Bevölkerung durchaus eine Aufbruchstimmung. Immer mehr Menschen waren bereit, sich zu engagieren, für Reformschritte zu kämpfen, der Autokratie weitere Zugeständnisse abzuringen, ohne sich durch Unterdrückungsmaßnahmen einschüchtern zu lassen. Was sich schon im 19. Jahrhundert in vielen Städten und Regionen gezeigt hatte, setzte sich nun in zunehmendem Maße fort. Vereine, Gesellschaften und Klubs schossen überall aus dem Boden und vernetzten sich vielfach. Menschen aus unterschiedlichen Schichten ergriffen die Initiative, um benachteiligten sozialen Gruppen zu helfen, Missstände in der Gesellschaft zu beseitigen, Analphabetentum, Alkoholismus und Kriminalität zu bekämpfen. Universitätsprofessoren stellten sich mutig und selbstbewusst staatlichen Aktionen gegen aufbegehrende Studierende entgegen. Juristen und Ingenieure bildeten Fachorganisationen, die Pläne für die Zukunft erörterten, und verstanden sich als Teil der internationalen Gemeinschaft. Die russische Kultur erreichte in vielen Bereichen eine neue Blüte. Innerhalb der intelligencija kam es zu einer intensiven Diskussion über die Perspektiven des Landes und über das eigene Verhalten, entweder die Revolution zu unterstützen oder den Wandel über eine Erneuerung von innen her zu suchen. Strömungen einer religiösen Sinnsuche wurden spürbar, in denen sich manchmal messianistische mit sozialistischen Ideen verbanden und die selbst innerhalb der orthodoxen Kirche Resonanz fanden. Ein breitgefächertes Parteiensystem bildete sich aus. Es enthielt alle [<<35] Schattierungen von reaktionären, nationalistischen und antisemitischen Gruppierungen bis hin zu aufstandsbereiten Sozialisten. Durch die Diskussionen in der Duma wie in der Öffentlichkeit – es herrschte eine beschränkte Pressefreiheit – differenzierten sich die Parteien in verschiedene Fraktionen oder gar Abspaltungen.
In der Regierung und im Staatsapparat blieben die öffentlichen Aktivitäten durchaus nicht ohne Resonanz. Reformanregungen wurden hin und wieder aufgegriffen. Auch des drängendsten Problems, der Agrarfrage, nahm sich die Regierung an. Mit mehreren Gesetzen versuchte sie seit Ende 1906, eine wirtschaftlich kräftige bäuerliche Oberschicht zu schaffen, den Einfluss der obščina zu mindern sowie die überschüssige Dorfbevölkerung nach Sibirien und Zentralasien umzusiedeln, soweit sie nicht Arbeit in der Industrie fand. Erfolge waren nicht zu übersehen, erfüllten aber bis zum Ersten Weltkrieg noch nicht die Erwartungen. Zudem zeigten sich neue Probleme: Die nach Osten wandernden Kolonisten gerieten in Konflikte mit den Einheimischen, und der industrielle Aufschwung vollzog sich, trotz einer gewaltigen Dynamik seit 1908, nicht schnell genug, um eine Beschäftigung größerer Massen von Arbeitskräften aus den Dörfern zu ermöglichen. Weitergehende Maßnahmen scheiterten ohnehin am Widerstand beharrender Kräfte.
In vielen Bereichen kam es nach der Niederschlagung der Revolution sogar zu einer Gegenbewegung der Konservativen, die Reformen – etwa in der Arbeitergesetzgebung – wieder rückgängig machten. In der Wirtschaftspolitik verstärkte sich der Zickzackkurs zwischen den verschiedenen Interessen der Industriellen und Agrarier. Beide standen zwar in einem Bündnis mit dem Staat, um das System gegen eine neue Revolution zu sichern. Doch zugleich blockierten sie sich gegenseitig, wie es sich auch in anderen Politikfeldern offenbarte. Außenpolitische Konzeptionen schwankten zwischen einer aggressiven Vertretung der Großmachtrolle und einer friedensbewahrenden Politik, um alle Kraft den innenpolitischen Problemen zuwenden zu können. Intrigen am Hof und Einflüsse solcher Persönlichkeiten wie des „Wundertäters“ Grigorij E. Rasputin, der die Bluterkrankheit des Thronfolgers zu heilen versprach, prägten das Bild der Staatsspitze. Die Handlungsfähigkeit der Regierung nahm zusehends ab. Zugleich radikalisierten sich die Gegner des Systems. Die neu in die Städte zuwandernden „Bauern-Arbeiter“ gingen mehr und mehr auf die Seite der Revolutionäre über. 1912 setzten umfangreiche Streiks ein. Die Wellen von Unruhen, Arbeitsniederlegungen und Protestdemonstrationen erreichten 1913 einen bisher nicht gekannten Höhepunkt und rissen bis 1914 nicht mehr ab.
Der Erste Weltkrieg unterbrach ab August 1914 diesen neuen Aufschwung der Arbeiterbewegung. Die russische Führung war in ihrer Haltung zunächst nicht einheitlich gewesen. Doch schließlich hatte sich die Kriegspartei durchgesetzt. Sie wollte [<<36] Serbien in seinem Konflikt mit Österreich-Ungarn nicht im Stich lassen, aber auch die Position Russlands im internationalen Kräftefeld verbessern. Mit seinen Alliierten Frankreich und Großbritannien stand Russland nun gegen die „Mittelmächte“ Österreich-Ungarn und Deutschland. Weite Kreise der Bevölkerung hofften in patriotischer Begeisterung, dass Russland rasch siegen und als wichtigstes Kriegsziel die freie Durchfahrt durch die Dardanellen erreichen werde. Vernichtende Niederlagen in der Anfangsphase, namentlich gegen die deutschen Truppen in Ostpreußen, und dann die hohen Opferzahlen sowie die lange Kriegsdauer verschlechterten jedoch die Stimmung bei den Soldaten wie in der Zivilbevölkerung. 1916 stabilisierte sich zwar die militärische Lage. Dennoch kam es nicht zu einem Umschwung in der öffentlichen Meinung. Stattdessen wuchs die Entfremdung vom Zaren, der 1915 den Oberbefehl über die russischen Truppen übernommen hatte, und von der politischen Ordnung, die er repräsentierte.
Abb 13 Auf dieser in Frankreich gedruckten Ansichtskarte präsentiert sich Zar Nikolaj II. als Feldherr von Gottes Gnaden. Die Aufnahme entstand vermutlich in seinem Hauptquartier bei Mogilev im September 1915: Als Oberbefehlshaber schwört er mit einer kleinen Ikone in seiner rechten Hand kniende Soldaten auf den Krieg ein. Fotograf unbekannt. [Bildnachweis]
Die schon zuvor erkennbaren Tendenzen verschärften sich. Nach wie vor verstand die Wirtschaftspolitik die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landes nicht zu nutzen. Die Rüstungsproduktion blieb zumindest bis 1916 weit hinter den Anforderungen zurück, die der „industrielle Krieg“ mit seinem Schwergewicht auf Technik und Material stellte.14 Dass sie sich dann stabilisierte, ging auf Kosten derjenigen Branchen, die Güter für die Zivilbevölkerung herstellten. Aufgrund der Überlastung brach die Wirtschaft, von wenigen Bereichen abgesehen, 1917 zusammen. Auch die Lebensmittelversorgung wurde immer schlechter. Der Mangel an Arbeitskräften auf dem Land wirkte sich nachteilig aus, mehr jedoch das planlose Regierungshandeln. Weder eine schwankende Preispolitik, die die Interessen der Gutsbesitzer begünstigte und zu Spekulation und Engpässen führte, noch eine kaum zu verwirklichende Zwangsablieferung von Getreide, wie sie im Dezember 1916 verkündet wurde, konnten Abhilfe schaffen.
Abb 14 Auch Frauen sollen „alles für den Krieg“ geben, wie die Losung dieser Postkarte lautet. Zugleich enthält sie die Aufforderung, die Kriegsanleihe zu 5 ½ Prozent Zinsen zu zeichnen. Illustrator unbekannt. [Bildnachweis]
Eine wirksame Lenkung der Kriegswirtschaft gelang nicht: Regierung, Unternehmer und Agrarier schafften es weder allein noch zusammen, eine planmäßige Organisation aufzubauen. Stattdessen verstärkten sich die gegenseitigen Blockaden. Privatinteressen von Unternehmern und Agrariern hatten hohen Einfluss. Ökonomische Möglichkeiten und politische Organisationskraft kamen immer weniger zur Deckung. Schwerwiegende Folgen sollte es haben, dass sich eine beträchtliche Zahl „Moskauer“ Unternehmer, die in politischer Opposition zum Zarismus gestanden hatten, wirtschaftlich integrieren ließ, um höhere Profite zu erzielen. Dieser Übergang eines weiteren Teils [<<37] der „Gesellschaft“ auf die Seite des Zaren erschütterte nicht nur das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und Standfestigkeit dieser Unternehmer, sondern vertiefte die Kluft zum „Volk“. Das System war in eine Sackgasse geraten.
In der Duma hatten nur die linken Parteien gegen den Kriegseintritt protestiert. Bald spaltete sich aber auch die Arbeiterbewegung quer durch die verschiedenen Gruppen in „Landesverteidiger“ oder „Patrioten“ und „Internationalisten“ oder „Defätisten“. Die kompromisslose Ablehnung des Krieges durch die Bolschewiki – den radikalen Flügel der Sozialdemokratie –, deren Dumaabgeordnete Anfang 1915 zu lebenslanger Verbannung verurteilt worden waren, verschaffte ihnen zunehmend Anklang unter Teilen der kriegsmüden Bevölkerung.
Die oppositionellen Kräfte in der Duma, mit Ausnahme der Sozialisten, versuchten, durch einen Zusammenschluss im „Progressiven Block“ 1915 die Grundlage für eine politische Wende zu schaffen. Sie forderten liberale Reformen sowie eine personelle Erneuerung der Regierung, die das Vertrauen des Volkes haben und deshalb dem Parlament verantwortlich sein müsse. Doch diese Organisation der „Gesellschaft“ war ähnlich wie andere Zusammenschlüsse in sich nicht einig, scheute ein Bündnis [<<38] mit den Linken und fürchtete Massenaktionen. Verschwörungen zur Absetzung des Zaren wurden geplant, aber nicht verwirklicht. Hingegen suchten Zar und Regierung den Ausnahmezustand während des Krieges zu nutzen, um ihre Stellung zu stärken. Letztlich mangelte es aber auch ihnen an Entschlusskraft. Mehr und mehr ging ihre Autorität verloren. Als am 1. November 1916 die Duma nach zweimonatiger Pause zusammentrat, hielt Pavel N. Miljukov, der Führer der liberalen Konstitutionell-Demokratischen Partei, eine Anklagerede gegen das Regime. Nach jedem Fehler, den er aufzählte, stellte er die rhetorische Frage: „Ist es Dummheit, oder ist es Verrat?“
Ein Aufstand von Nomadenstämmen in Zentralasien Mitte 1916 machte deutlich, wie schwach die Kräfte, die das Imperium im Innern zusammenhielten, geworden waren. Er wurde blutig niedergeschlagen. Der Fraktionsvorsitzende der Partei der [<<39] Trudoviki, Aleksandr F. Kerenskij, fragte während einer Dumasitzung am 13. Dezember 1916, wie die zarische Regierung das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915 als „Verbrechen gegen die Menschheit und Zivilisation“ oder die deutschen Kriegsverbrechen in Belgien 1914 in ähnlicher Weise verurteilen könne, wenn sie selbst derart gewaltsam handele. Das sei eine „Schande“ für Russland, schallte es ihm aus der Duma entgegen.15 Vom Anspruch des Zarenreiches, eine „zivilisatorische Mission“ mit ihrer Kolonisierung des Landes zu erfüllen, war nichts mehr übrig geblieben.
Doch nicht nur in der Duma rumorte es. Die dortige Kritik an der Regierung und am Zarenhof erhöhte die Erregung in der Öffentlichkeit. Die wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Nahrungsmittelknappheit, die spürbare Unzufriedenheit unter den Bauern und die zunehmenden Spannungen in der Arbeiterschaft fachten sie weiter an. Seit Herbst 1916 gewannen Streiks und andere Massenaktionen wieder an Umfang und Schärfe. Die Arbeiterschaft radikalisierte sich zusehends. Diese Alarmzeichen nahmen die Regierung und ein Großteil der „Gesellschaft“ nicht ernst genug. Ende Januar 1917 ließ die Regierung führende Arbeitervertreter verhaften und meinte, damit genug Stärke gezeigt zu haben. Aber sie konnte den Widerstand gegen ihre Politik nicht mehr aufhalten. [<<40]
1 Anton Čechov: Der Kirschgarten. Komödie in vier Akten. Übersetzt und hg. von Peter Urban. Zürich 1973, 9–10, folgende Zitate 54, 40, 38.
2 Maxim Gorki: Foma Gordejew. Eine Beichte. Das Werk der Artamonows. Hg. von Helene Imendörffer. München 1978, 112.
3 Das Zitat heißt im Original: „mužik porčenyj“. Swetlana Geier übersetzt m. E. nicht ganz zutreffend mit „dummer Bauer“: Fjodor Dostojewskij: Die Brüder Karamasow. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Frankfurt a. M. 2006, 508. Vgl. hingegen Fjodor M. Dostojewskij: Die Brüder Karamasow. Aus dem Russischen übertragen von Hans Ruoff und Richard Hoffmann. München 1978, 424.
4 Anton Tschechow: Die Bauern. Deutsch von Hertha von Schulz. In: ders.: Meistererzählungen. Hg. von Wolf Düwel. Berlin 1984, 390–428, hier 427.
5 Leo Tolstoi: Ein Schicksal. Erzählung. Der Schwägerin Leo Tolstoi’s Frau T. A. Kuzminskaia von einer Bäuerin diktiert und von ihm durchgesehen und korrigiert. Übersetzt und hg. von C. Salomon. Zürich 1924.
6 Zitiert in: Stefan Plaggenborg: Bauernwelt und Modernisierung in der ausgehenden Zarenzeit. In: Aufbruch der Gesellschaft im verordneten Staat. Russland in der Spätphase des Zarenreiches. Hg. von Heiko Haumann und Stefan Plaggenborg. Frankfurt a. M. u. a. 1994, 138–164, hier 146.
7 Leo N. Tolstoj: Der Morgen eines Gutsbesitzers. In: ders.: Sämtliche Erzählungen. Hg. von Gisela Drohla. 2. Band. Frankfurt a. M. 1990, 9–75, hier 68.
8 Hier in Ivan A. Bunins autobiografischem Roman: Iwan Bunin: Das Leben Arsenjews. Eine Jugend im alten Russland. Aus dem Russischen von Georg Schwarz. Frankfurt a. M. 1982, 12. Bunin entstammte allerdings einer Kleinadelsfamilie.
9 Zitiert in: Annette Werberger: Grenzgänge, Zwischenwelten, Dritte – Der jüdische Schriftsteller und Ethnograf S. Anskij. In: Transversal 5/1 (2004) 62–79, hier 68.
10 An-ski: Der Dibbuk. Dramatische jüdische Legende in vier Bildern. Hg. von Horst Bieneck. Frankfurt a. M. 1989, Zitat 51. Leider greift diese neue Übertragung von Salcia Landmann und Horst Bienek teilweise stark in den ursprünglichen Text ein.
11 So wertete der zarische Finanzminister Sergej Ju. Vitte die Transsibirische Eisenbahn als „Weltverkehrsstraße“: S. J. Witte: Erinnerungen. Berlin 1923, 35.
12 Heiko Haumann: Kapitalismus im zaristischen Staat 1906–1917. Organisationsformen, Machtverhältnisse und Leistungsbilanz im Industrialisierungsprozess. Königstein 1980, 69, 152, im Anschluss an Karl Marx, der 1847 vom „verkrüppelten Entwicklungsgang der deutschen Bürgerklasse“ sprach (Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Band 4. Berlin 1969, 346).
13 Quellen zur Geschichte Russlands. Hg. von Hans-Heinrich Nolte, Bernhard Schalhorn und Bernd Bonwetsch. Stuttgart 2014, 252–254.
14 Jörn Leonhard: Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs. München 2014, 425.
15 Jörn Happel: Die Schande Russlands: Globale Perspektiven auf den Aufstand in Zentralasien 1916. In: Globalisierung imperial und sozialistisch. Russland und die Sowjetunion in der Globalgeschichte 1851–1991. Hg. von Martin Aust. Frankfurt a. M., New York 2013, 182–203, hier 187, 189.