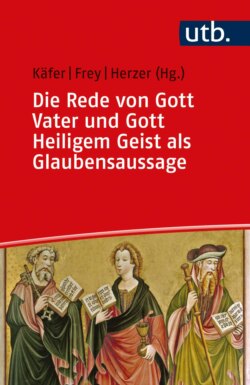Читать книгу Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage - Группа авторов - Страница 31
1.3 Die Verbindung von ekklesiologischer und christologisch-hoheitlicher Referenz der Vater-Metapher
ОглавлениеWenngleich die Vorstellung von der Gottessohnschaft der Glaubenden durch ihre jüdische Tradition als prioritär zu denken ist, setzen die frühesten christlichen Schriften die hoheitliche Gottessohnschaft Jesu jedoch bereits ebenfalls voraus und bringen sie in einen Zusammenhang mit der Gottessohnschaft der Glaubenden. Es lässt sich also von frühester Zeit an bereits eine Verbindung von ekklesiologischer und christologisch-hoheitlicher Referenz der Vaterschaft Gottes erkennen.
Bereits in den paulinischen Briefen basiert die Vaterschaft Gottes gegenüber den Glaubenden auf seiner Vaterschaft dem Gottessohn gegenüber. Paulus macht deutlich, dass die Anrede Gottes als abba nur durch die Sendung des Sohnes und die Aufnahme des Geistes geschehen kann. So heißt es in Gal 4,4–6: »(4) Als aber die Erfüllung der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, (5) damit er die unter dem Gesetz freikaufe, damit wir die Sohnschaft empfangen. (6) Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft: ›abba, Vater‹.« Der Geist (Christi)[19] ermöglicht die Partizipation am |97|Göttlichen, die sich in der Konstitution der Vater-Kind-Beziehung konkretisiert, die hier wie ein Rechtsakt als Empfang der Sohn- bzw. Kindschaft (υἱοθεσία) beschrieben wird. Die Glaubenden werden vom göttlichen Vater auf der Basis der Sendung des Sohnes wie bei einer Adoption als Kinder angenommen. Der Geist gibt ihnen die Stimme, Gott ebenso wie Jesus als abba-Vater anzurufen. Möglicherweise rekurriert Paulus hier bereits auf eine frühe Tradition des Vatergebets, in dem Jesus Gott explizit als Vater anspricht (Lk 11,2: »Vater«) und die Jünger und Jüngerinnen lehrt, dies ebenso zu tun (Mt 6,9: »Vater unser«).[20]
Ähnlich, aber doch radikaler formuliert dies der Verfasser des Johannes-Evangeliums. Auch hier erscheint Christus als Vermittler der Gotteskindschaft der Glaubenden, nun aber nicht mehr im Rahmen eines rechtlichen Aktes. Die programmatischen Eingangsverse des Evangeliums beschreiben zunächst, dass der von Gott kommende Christus-Logos einem Teil der Schöpfung, nämlich denjenigen Menschen, die ihn »aufgenommen haben«, »denen, die an seinen Namen glaubten«, die Bevollmächtigung gab, »Kinder Gottes zu werden« (τέκνα θεοῦ γενέσθαι, Joh 1,12). Diese werden nun weiterhin gekennzeichnet als »die, die nicht aus menschlichem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind« (ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν, Joh 1,13). In Joh 3 legt Jesus im Gespräch mit Nikodemus dar, wie dieses »aus Gott Gezeugtwerden« zu denken ist: als ein »von oben«/»von neuem« (Joh 3,3)[21] bzw. »aus Wasser und Geist« (ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, Joh 3,5) Gezeugtwerden. Auch hier wieder vermittelt der Geist die Kindschaft; das Wasser referiert vermutlich auf das Taufgeschehen als Aufnahme des neuen Kindes in die Familie Gottes.[22] Das Johannes-Evangelium formuliert mit den Lexemen »aus Gott« bzw. »von oben/von neuem Gezeugtwerden« (Joh 3,3) den Neuanfang Gottes mit den Menschen in semantischer Radikalität, die das »grundlegende Anders-Sein«[23] dieses Lebens unter dem Aspekt der Partizipation am Göttlichen und |98|damit an der Hoheit in den Blick nimmt.[24] Bei Johannes wird die zuvor auf Jesus konzentrierte Aussage der göttlichen Herkunft also nun auch auf die Glaubenden übertragen:[25] Sie sind als Kinder Gottes durch das »Gezeugtwerden« in eine genealogische Relation zu Gott als Vater gestellt und damit partizipieren sie zugleich an der Erhöhung. Die Gefahr einer Gleichstellung der Glaubenden mit dem einzig »leiblichen« Gottessohn, dem inkarniertern Christus-Logos,[26] ist dennoch nicht gegeben: Dieser unterscheidet sich durch seine Prä- und Postexistenz bei Gott, seine Inkarnation und die im Evangelium ausgeführte Wesens- und Wirkeinheit mit dem Vater von den anderen Gotteskindern, die aber dennoch »aus Gott gezeugt« sind.
Der Verfasser des 1. Petrusbriefs parallelisiert die Vaterschaft Gottes gegenüber Jesus und gegenüber den Glaubenden ebenfalls (1 Petr 1,3: »Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns entsprechend seiner großen Barmherzigkeit neugezeugt hat«) und verwendet für die Vaterschaft Gottes den Glaubenden gegenüber das der johanneischen Semantik vom »von oben/von neuem Gezeugtwerden« (ἄνωθεν γεννάομαι) sehr nahestehende Lexem ἀναγεννάομαι (»neu gezeugtwerden«) für die Glaubenden (1,23; vgl. auch 1,3).
Die Metaphorik des »von oben« bzw. »von neuem Gezeugtwerdens« wird hier noch weiter ausgestaltet, insofern hier die Glaubenden mit neugeborenen Kindern auch bzgl. ihrer Glaubensreife verglichen werden, die mit dem Wort Gottes wie mit »unverfälschter, geistiger Milch« (2,2) gefüttert werden.
Das Bewusstsein der Verbundenheit mit Gott (und Christus) in der familia dei spiegelt sich nicht nur in der Tatsache, dass die Vater-Bezeichnung das Vater-Gebet epikletisch einleitet, sondern auch darin, dass die Rede von Gott als Vater der Christinnen und Christen ihren festen Platz im Eingang frühchristlicher Briefe gewinnt.[27] Die |99|Benennung Gottes als Vater erfolgt praktisch in allen brieflichen salutationes, fließt aber auch in Eulogien und Danksagungen ein. So lobt der Verfasser des 1. Petrusbriefs Gott als Vater. Und so gilt auch der Dank für die Glaubensfestigkeit der Gemeinde, Gott-Vater in Kol 1,3 und 1,12–14: Der Verfasser dankt Gott-Vater, »der euch dazu bereitet hat, Anteil am Los der Heiligen im Licht zu haben. (13) Er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe gestellt, (14) in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden.«