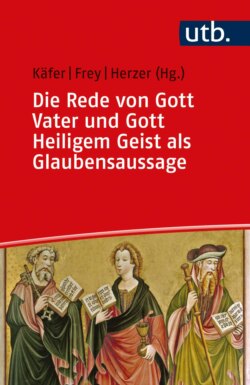Читать книгу Die Rede von Gott Vater und Gott Heiligem Geist als Glaubensaussage - Группа авторов - Страница 34
3. Die Vater-Bezeichnung Gottes im frühchristlichen Ritus und in weiteren Schriften des frühen Christentums
ОглавлениеDie Etablierung der Vater-Bezeichnung in den frühen christlichen Gemeinden über Verkündigung, Vater-Gebet und Taufe legen auch weitere Texte aus den ersten Jahrhunderten nahe. So zeigt etwa die früheste erhaltene Kirchenordnung aus dem 2. Jahrhundert, die Didache, dass die Taufe auf den »Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes« im frühchristlichen Ritus Aufnahme gefunden hat.[43] Hier heißt es in 7,1–3: »Betreffs der Taufe: Tauft folgendermaßen: Nachdem ihr vorher dies alles mitgeteilt habt, tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes in lebendigem Wasser! Wenn dir aber lebendiges Wasser nicht zur Verfügung steht, taufe in anderem Wasser! Wenn du es aber nicht in kaltem kannst, dann in warmem! Wenn dir aber beides nicht zur Verfügung steht, gieße dreimal Wasser auf den Kopf im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes (εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος).«[44] Da auch weitere frühe christliche Texte diese trinitarische Formel belegen, lässt sich annehmen, dass die Taufe auf den Namen des Vaters (und des Sohnes und des Heiligen Geistes) – zumindest in Syrien, woher vermutlich auch das Mt-Evangelium stammt – bereits vor 100 n. Chr. verbreitet gewesen sein dürfte.[45] Im 2. Jahrhundert wurde dann auch anderenorts trinitarisch getauft.[46] Während des Taufaktes wurden also die Namen des Vaters, des Sohnes und |107|des Heiligen Geistes über dem Täufling ausgerufen, der Täufling dem Vater als göttlichem Herrn und metaphorischem »Vater« zugeordnet und damit die Vater-Bezeichnung als die grundlegende Bezeichnung Gottes für das christliche Gottesverhältnis institutionalisiert.[47]
Abgesehen vom Taufritus, mit dem vermutlich auch ein Bekenntnis des Täuflings zum »Vater« verbunden war, etabliert sich die Vater-Metapher für Gott aber am intensivsten über das Gebet im Gedächtnis der Christen und Christinnen: Die nach Mt und Lk von Jesus angemahnte Verwendung des Vater-(unser-)Gebets in einer der Mt-Fassung sehr nahen Version lässt sich ebenfalls anhand der Didache belegen. Nach Did 8,2–3 sollten Christinnen und Christen das Gebet »Vater unser, der du bist im Himmel […]« dreimal am Tag beten.
Aber auch andere Gebete der Didache verweisen auf Gott als Vater: Bei der Eucharistie, die am Herrentag gefeiert wurde (14,1), wird ebenfalls dem Vater gedankt: »Wir danken dir, unser Vater, für den heiligen Weinstock Davids, deines Knechtes […]. Wir danken dir, unser Vater, für das Leben, das du uns offenbart hast durch Jesus, deinen Knecht« (9,2–3). Und nach der Sättigung wird ein weiteres Mal gebetet: »Wir danken dir, heiliger Vater, für deinen heiligen Namen, den du in unseren Herzen hast Wohnung nehmen lassen« (10,2); auch im Dank für das Salböl erscheint die Vater-Anrede (10,8).[48] Zur Institutionalisierung und zur Aufnahme der Vater-Metaphorik in das theologische Gedächtnis der Christen und Christinnen trug allerdings besonders das Vater-Gebet bei.[49] Von den frühen Kirchenvätern wurde es auch aufgrund seines Inhalts sehr geschätzt, in dem etwa Tertullian eine »kurze Zusammenfassung des ganzen Evangeliums« sah,[50] und für Cyprian war das Vater-Gebet ein »Kompendium der himmlischen Lehre«.[51]
Aber nicht nur im Rahmen von Bekenntnis- und Gebetstexten, auch in den apokryphen Evangelien und in weiteren apokryphen Schriften wird die Vater-Bezeichnung besonders innerhalb der |108|Jesus-Logien weitertradiert. In den apokryphen Evangelien, aber auch in der Epistula Apostolorum ist die Vater-Bezeichnung im Munde Jesu fest etabliert. Im Thomas-Evangelium ist »Vater« die häufigste Gottesbezeichnung. Die Glaubenden sind die »Erwählten des lebendigen Vaters« (EvThom 50).[52] Jesus versteht sich als aus dem Vater hervorgekommen, »der (stets) mit sich eins ist« (61). Das Königreich wird nun explizit zum »Königreich des Vaters« (57; 76; 96–99; 113 – vgl. Mt 26,29). In anderen apokryphen Texten fehlt die Vater-Bezeichnung für Gott allerdings völlig, wie etwa im Protevangelium des Jakobus. Doch auch in weiteren Kindheitsevangelien wird sie kaum verwendet, was damit zusammenhängen dürfte, dass Joseph hier verstärkt als Vater erscheint, wenngleich er kaum als solcher bezeichnet wird. Des Weiteren finden sich hier nun Reflexionen über den Vater-Namen wie etwa im EvPhil 11a: »Die Namen, die den Weltmenschen mitgeteilt werden, verursachen eine große Irreführung. Denn sie wenden ihren Sinn weg vom Feststehenden (und) hin zu dem Nichtfeststehenden. So erfaßt, wer (den Namen) ›Gott‹ hört, nicht das Feststehende, sondern er erfaßt das Nichtfeststehende. Ebenso verhält es sich auch mit (den Namen) ›Vater‹, ›Sohn‹ ›Heiliger Geist‹.«[53]
Die Schriften der Apostolischen Väter belegen alle die Vater-Bezeichnung, jedoch auf sehr unterschiedliche Art und Weise:[54] Der erste Clemens-Brief verwendet achtmal die Vater-Bezeichnung für Gott, wobei er den Vater jeweils durch Adjektive und Appositionen näher charakterisiert. Der Vater wird mit dem Schöpfer parallelisiert (1 Clem 19,2; 35,3; vgl. auch 61,2), er ist heilig (35,3), barmherzig (23,1; 29,1) und gut (56,16) und verteilt Wohltaten (19,2; 23,1). Auch als Erzieher ist er gut und voller Erbarmen (56,16). Durch die Nachahmung des Vaters wird der Glaubende vor dem Vater Gefallen finden (61,2). Der Vater ist der Vater vor allem in Bezug auf die Glaubenden, die sich zu ihm mit dem »Vater«-Ruf bekehren (8,3), die ihn als Vater anbeten (29,1). Nur in 7,4 wird er als Vater Christi benannt. Dennoch ist die herrscherliche Seite Gottes für 1 Clem sehr viel wichtiger; dies zeigt neben der Verwendung von δεσπότης auch |109|die Ersetzung der Vater-Bezeichnung in der Gnaden- und Friedensformel im Briefpräskript durch παντοκράτωρ θεός. Insofern bestimmt auch die eigentlich herrscherliche Qualität Gottes seine Vaterschaft: Diese Vaterschaft gründet nicht in der Tatsache, dass er der Vater Jesu Christi ist, sondern darin, dass er der δεσπότης ist (56,16). »Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, wird zum Vater der ganzen Schöpfung, weil er der δεσπότης ist.«[55] 1 Clem lässt die Vater-Bezeichnung also vor dem Hintergrund eines stark herrscherlich bestimmten Gottesbilds zurücktreten.
Die Ignatianen weisen hingegen eine kontinuierliche Institutionalisierung der Vater-Bezeichnung auf. Neben der Gattungsbezeichnung θεός ist πατήρ die häufigste Gottesbezeichnung der Briefe. Dabei erscheint in den Briefpräskripten und in den Schlussgrüßen die asyndetische Form θεὸς πατήρ wie bereits in den kanonischen Briefen. Meist ist hier jedoch nicht Gott als »unser Vater« thematisiert,[56] sondern als Vater Jesu Christi.[57] Hier findet sich nun auch die Bezeichnung Christi als »Sohn des Vaters« (υἱὸς τοῦ πατρός, IgnRöm Präskript). Im Briefkorpus bevorzugen die Ignatianen die absolute Form ὁ πατήρ; auch hier ist zumeist die Vaterschaft Gottes gegenüber Christus angesprochen. Dieser Vater ist der »höchste« und er ist treu (IgnRöm Präskript; IgnTrall 13,2). Die Vater-Sohn-Metapher dient nun als Vorbild des als »Einheit« (ἑνότης) beschriebenen Verhältnisses der Gemeinde zu ihren Vorgesetzten (IgnEph 4–5; vgl. IgnMagn 1,2; 3,1). Die »Einheit« von Vater und Sohn (vgl. auch IgnRöm 3,3: Der Sohn ist »im« Vater) soll in der »Einheit« von Bischof und Gemeinde ihr Spiegelbild finden. Die Vater-Metapher wird so auf den Bischof übertragen (IgnMagn 3,1; 6,2; IgnTrall 3,1), die Intimität des Vater-Sohn-Verhältnisses damit auch auf das Verhältnis von Glaubenden und Bischof projiziert, wobei auch Christus als Sohn nun vorbildlichen Charakter für die Glaubenden annimmt: Wie Christus seinen Vater nachgeahmt hat, soll nun die Gemeinde Christus bzw. den Bischof nachahmen (IgnPhld 7,1; IgnSm 8,1). Die Gemeinde wird als Bauwerk (IgnEph 9,1) bzw. Pflanzung (IgnTrall 11,1; IgnPhld 3,1) des Vaters verbildlicht. Die Kirche in Rom kann nun sogar als πατρώνυμος bezeichnet |110|werden, d.h., sie ist Trägerin des Namens des Vaters (IgnRöm Präskript) oder die Gemeinde »Gottes, des Vaters« (IgnPhld Präskript; IgnSm Präskript). Auch in den Ignatianen lassen sich liturgische Elemente erkennen: IgnRöm 2,2 fordert die Glaubenden auf, dem Vater zu singen, und in 7,2 mag ein Taufbezug vorliegen, wenn es heißt: »[Es] ist lebendiges und redendes Wasser in mir, das innerlich zu mir sagt: Auf zum Vater!«[58] Theologisch wertet die Vater-Bezeichnung daher vor allem Ignatius aus, der durch den Vergleich des Bischofs mit dem Vater die Vater-Sohn-Metaphorik (in Aufnahme paulinischer Gedanken) auf das Verhältnis der Gemeinde zu ihrem Vorgesetzten überträgt und durch den Gedanken der »Einheit« füllt.
Während das Vater-Sohn-Verhältnis in den Briefen des Barnabas und Diognet zwar vorausgesetzt, jedoch nicht weiter thematisiert wird, rekurriert der zweite Clemens-Brief stark auf die Logientradition unter Bevorzugung der Texte, die – wie besonders das Mt-Evangelium – vom »Willen des Vaters« sprechen (2 Clem 8,5; 9,11; 10,1; 14,1). Im Gegensatz zu den toten Göttern ist der Vater nun der »Vater der Wahrheit«. Diese Bezeichnung dürfte der Rede vom »wahren Gott« im Unterschied zu den Götterbildern wie sie etwa in 1 Thess 1,9 vorliegt, entsprechen.[59]
Die Vater-Bezeichnung Gottes etabliert sich also sowohl durch den rituellen Gebrauch als auch durch die Schrifttradition bereits in den ersten christlichen Jahrhunderten konsequent und wird schließlich auch durch die trinitarischen Diskussionen weiter festgeschrieben. In Auseinandersetzung mit paganen Kritikern wird auch die Rede vom Vater als »Schöpfer« wichtiger, der etwa bei Irenäus wiederholt als πατὴρ τῶν ὅλων erscheint.[60]