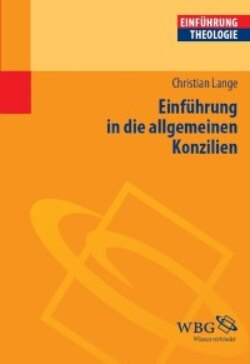Читать книгу Einführung in die allgemeinen Konzilien - Группа авторов - Страница 9
3. Der Bischof (episkopos) als Garant für den wahren Glauben
ОглавлениеDie unterschiedlichen Ämter in den frühen Gemeinden
Die im Canon des Neuen Testamentes überlieferten Briefe belegen, dass es zunächst verschiedene Formen der Gemeindestruktur gegeben hat. Die einen Gemeinden, die sich wohl eher am Modell der jüdischen Synagoge orientierten, wurden von Ältesten (presbyteroi) geführt. Solche Ältesten (presbyteroi) erwähnen beispielsweise der zu den katholischen Briefen gezählte Jakobusbrief (Jak 5,14) wie der Erste Petrusbrief (1Petr 5,1). In den Briefen des Apostels Paulus werden demgegenüber jedoch unterschiedliche Gaben (charismata) genannt. Zum Beispiel spricht der Apostel im Römerbrief von der prophetischen Rede, dem Dienen, dem Lehren oder dem Trösten (Röm 12,5–8). Paulus erwähnt jedoch auch bereits einen Vorstehenden (Röm 12,8); und im Ersten Brief an die Korinther legt er dar:
„So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer. Ferner verleiht er die Kraft, Wunder zu tun, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede“ (1Kor 12, 28–29).
Die Theorie von der Tradition
Wie das Beispiel des so genannten Ersten Clemensbriefes nahelegt, scheint am Ende des ersten Jahrhunderts die Idee von der ‚Tradition‘ (traditio) aufgekommen zu sein, die ihren Ausdruck im Bischof (episkopos) als Leiter und Vorsteher der Ortsgemeinde gefunden hat. Hierzu wird in dem gewöhnlich auf das Jahr 96 n. Chr. datierten und ab dem vierten Jahrhundert einem römischen Bischof mit dem Namen Clemens zugeschriebenen Schreiben ausgeführt:
„Die Apostel empfingen die Frohe Botschaft für uns vom Herrn Jesus Christus; Jesus, der Christus, wurde von Gott gesandt. Christus kommt also von Gott, und die Apostel kommen von Christus her; beides geschah demnach in schöner Ordnung nach Gottes Willen. Sie empfingen also Aufträge, wurden durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus mit Gewissheit erfüllt und durch das Wort Gottes in der Treue gefestigt, zogen dann mit der Fülle des Heiligen Geistes aus und verkündeten die Frohe Botschaft von der Nähe des Gottesreiches. So predigten sie in Stadt und Land und setzten ihre Erstlinge [tas aparchas] nach vorhergegangener Prüfung im Geiste zu Bischöfen [episkopous] und Diakonen [diakonous] für die künftigen Gläubigen ein“ (vgl. [1–2], S. 76–79).
In Abgrenzung zu rivalisierenden Gruppen nahmen die Gemeinden also nun an der Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert offenbar für sich in Anspruch, in der Nachfolge Jesu zu stehen und den Glauben unverfälscht weiterzugeben. Die Apostel hätten diesen nämlich vom Herrn selbst empfangen und ihren Erstlingen (aparchas) als Nachfolgern übertragen. Durch diese Weitergabe (traditio) war demnach gewährleistet, dass die Bischöfe (episkopoi) an allen Orten als Nachfolger der Apostel die gleiche Botschaft verkündeten, die ihnen Jesus selbst aufgetragen hatte.
Ignatius von Antiochia
Im zweiten Jahrhundert vertiefte Ignatius, den Eusebius in seiner Kirchengeschichte als zweiten Bischof von Antiochia in Syrien zählt (GCS 9, S. 236), diese Theorie von der Tradition (traditio) auch im östlichen Raum. In einem Brief an die Gemeinde in Smyrna legte Ignatius dar:
„Folgt alle dem Bischof, wie Jesus Christus dem Vater, und dem Presbyterium wie den Aposteln; die Diakone aber achtet wie Gottes Gebot! Keiner tue etwas ohne den Bischof, soweit es die Kirche betrifft. Nur jene Eucharistie werde als gültig anerkannt, die unter der Leitung des Bischofs oder eines von ihm Beauftragten stattfindet. Wo immer der Bischof erscheint, dort soll auch die Gemeinde sein, gleichwie dort, wo Jesus Christus ist, auch die katholische Kirche ist“ (vgl. [1–3], S. 210–211).
Zwar ist unklar, ob Ignatius in seinen Briefen einen Ist-Zustand beschreibt oder ein Idealbild für die Zukunft zeichnet, doch wird für ihn der Bischof (episkopos) zum Symbol für die Einheit der allumfassenden, der katholischen Kirche.
Irenaeus von Lyon
Zur allgemeinen Anerkennung verholfen hat dieser Theorie von der Tradition (traditio), die er um die Lehre von der bischöflichen Sukzession (successio) erweitert hat, jedoch um das Jahr 180 der Bischof Irenaeus von Lyon (Lugdunum) in seinem Werk „Gegen die Häresien“ (Adversus Haereses). In diesem führt Irenaeus näher aus:
„Darum ist die Tradition der Apostel auf der ganzen Welt offenkundig. Alle Menschen, welche die Wahrheit sehen wollen, können sie sich in jeder Kirche anschauen. Und wir können die Bischöfe aufzählen, die von den Aposteln in den einzelnen Kirchen eingesetzt wurden, und deren Nachfolger bis in unsere Zeit“ (FC 8/3, S. 28–29).
Die Theorie von Tradition und Sukzession
Der aus Kleinasien stammende Irenaeus spricht also davon, dass die Tradition (traditio) der Apostel auf der ganzen Welt verbreitet sei. Sie könne in jeder einzelnen Ortskirche (ecclesia) angetroffen werden, da die Apostel in diesen Ortsgemeinden Bischöfe (episcopi) eingesetzt hätten, denen wiederum Bischöfe nachgefolgt seien. Dadurch entwickelte der in Gallien lebende Grieche die Lehre von der Sukzession (von Lateinisch succedere = „nachfolgen“). Die ununterbrochene Abfolge (successio) von Bischöfen (episcopi) stellte für ihn sicher, dass die Lehre der Apostel (traditio) unverfälscht weitergegeben worden sei. Daher gebe es in der allumfassenden Kirche (ecclesia catholica) auch nur ein und denselben Glauben (FC 8/1, S. 204–205). Dieser könne auf der ganzen Welt angetroffen werden (FC 8/1, S. 200–201). Wer von diesem abweiche, sei ein Spalter, ein Schismatiker, oder, noch schlimmer, ein Häretiker (FC 8/4, S. 206–207).