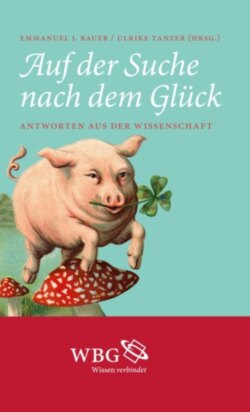Читать книгу Auf der Suche nach dem Glück - Группа авторов - Страница 8
Vorwort – Das Glück der Suche nach dem Glück
ОглавлениеGlück ist ein Thema, das jeden Menschen angeht. Denn es gehört zum Menschen, dass er versucht, glücklich zu sein. Er kann in gewissem Sinn gar nicht anders, als in allen seinen Lebensvollzügen danach zu streben, Glück zu finden. Auch wenn dies natürlich nicht immer bewusst und direkt geschieht, ist es doch die tiefste und umfassendste Antriebskraft des Menschen. Alles, was wir sind, was wir denken, fühlen und tun, schöpft im Letzten seine Energie, Dynamik und Orientierung aus dem erhofften Glück. Dies geschieht allerdings auf je eigene Weise. Denn Glück ist primär eine subjektive Kategorie, eine Wirklichkeit, die jeder und jede mit anderen Worten, Bildern und Eindrücken beschreibt. Gerade deswegen ist das Glück aber auch ein ewig junges Thema. In diesem Sinn zählt der Literaturkritiker und Philosoph Ludwig Marcuse das Glück zu den Sehnsüchten, die nicht altern.1 Jeder Mensch, jede Generation muss sich neu der Frage stellen und Wege und Möglichkeiten des Glücks in der je eigenen Situation und Zeit suchen. So verwundert es nicht, dass das Glück von Beginn an ein zentrales Thema der Philosophie war. Die Eudaimonia, das Erfülltsein vom guten Dämon, von einem guten Lebensgeist, stand im Mittelpunkt des Nachdenkens der Griechen über den Menschen, seine Welt und sein Leben. Und heute ist es nicht viel anders. Wir erleben einen neuen Glücksboom. Die Buchhandlungen quellen förmlich über von philosophisch-psychologischen und spirituellen Werken über das Glück oder die Kunst des guten Lebens, nicht zu übersehen auch die populärwissenschaftlichen und esoterischen Ratgeber mit ihren Anleitungen zum Glücklichsein. Seit einigen Jahren bieten manche Schulen sogar Glück als Unterrichtsfach an, in dem die Kinder Zufriedenheit, Selbstsicherheit und seelisches Wohlbefinden lernen sollen. Das Glück ist an der Jahrtausendwende zum Modethema geworden – auch in den Wissenschaften. Die sogenannte Glücksforschung, in der heute neben der Philosophie die Biologie, Psychologie, Soziologie, Kulturanthropologie, Staats- und Wirtschaftstheorie besonders intensiv tätig sind, hat in den letzten Jahren einen großen Aufschwung erlebt.
Die immer wieder aufflammende Aktualität der Glücksthematik hat mehrere Gründe. Abgesehen davon, dass die Frage nach dem Glück jeden existentiell angeht, ist es vor allem die Tatsache, dass sich das Glück – wie jedes andere große existentielle Thema des Menschen – nur schwer fassen lässt. Es weist zugleich subjektive und objektive Faktoren auf. Es ist eine Wirklichkeit, die vor allem emotionale, aber auch kognitive Dimensionen umfasst. Es hängt von gesellschaftlichen, aber auch von individuellen Einflüssen ab. Es ist im Letzten etwas Unverfügbares, etwas Nicht-Machbares, und doch zugleich etwas, zu dem der bzw. die Einzelne einen wesentlichen Beitrag leisten muss. Glück will gesucht werden, damit es sich einstellt, und kann doch nicht erzwungen werden. Glück ist eine äußerst komplexe Sache, hat seine eigenen Gesetze und erscheint manchmal doch wieder als etwas letztlich ganz Einfaches.
Die Beiträge dieses Buches wollen der vielfältigen und im Kern doch wieder sehr schlichten Wirklichkeit des konkreten Glücks auf die Spur kommen. Wenn das Streben nach Glück eine Eigenschaft des Menschen als Menschen ist, dann betrifft und fordert dessen Realität den ganzen Menschen in allen seinen Lebensbereichen. Es gilt, die verschiedensten Orte, an denen die Menschen ihr Glücklich- oder Unglücklich-Sein im Alltag erfahren, sowie die diversen Rahmenbedingungen für die Möglichkeit und die unterschiedlichen Facetten der Wirklichkeit des Glücks näher zu beleuchten. Kurz gesagt, es sollen Orte und Lebenskontexte der Erfahrung von Glück beschrieben, individuelle, strukturelle und soziale Bedingungen des Glücks benannt und nicht zuletzt anthropologische Dispositionen und konkrete Wege zum Glück aufgezeigt werden.
Dabei erscheint es sinnvoll, zuallererst der philosophischen und existentiellen Frage nachzugehen, was Glück überhaupt bedeutet. Wir alle wissen, dass Glück nicht gleich Glück ist. Worin auch immer für den einzelnen Menschen Glück besteht, grundsätzlich kann man wohl mit Aristoteles sagen, es muss sich um eine menschliche Wirklichkeit handeln, also eine Wirklichkeit und Art der Erfüllung, die dem Wesen und der Existenzweise des Menschen entspricht und damit auch weitgehend in seiner Verantwortlichkeit und seiner Art zu leben liegt. Diese Annahme ist nicht unumstritten. Die antiken Menschen gingen lange Zeit davon aus, das Glück des Menschen hänge ausschließlich oder überwiegend von der Gunst oder Ungunst der Götter ab. Und in der Tat, das Glück scheint zu allen Zeiten wesentlich vom Schicksal abzuhängen, wobei es zweitrangig ist, ob eine göttliche Macht oder die bestimmten Gesetzen folgenden Kräfte der Natur oder der Zufall als Ursache schicksalhafter Fügungen angenommen wird. Welche Rolle kommt in diesem Kräftespiel dem einzelnen Menschen zu? Hat der Mensch überhaupt die Möglichkeit, sein Glück zu beeinflussen, und wenn ja, welchen Beitrag kann, oder besser gesagt, welchen Beitrag muss der Mensch selbst zu seinem Glück leisten? Sowohl die philosophische Anthropologie als auch die empirische Psychologie warten hier mit überraschenden Antworten auf. Voraussetzung dafür, diesen Fragen seriös auf den Grund zu gehen, ist allerdings die Differenzierung zwischen verschiedenen Formen des Glücks, wie sie in vielen nicht-deutschen Sprachen auch in verschiedenen Begriffen für das Glück zum Ausdruck kommt. Eine bestimmte Art von Glück kann man haben, eine andere Art von Glück lässt sich nur erleben und verwirklichen.
Im Kontext der Überlegung, wie weit das Glück im Einflussbereich des Menschen liegt, stellt sich auch die grundsätzliche Frage, ob Glück unter den Bedingungen irdischer und endlicher Existenz überhaupt zu erlangen ist. Ausgehend von einem hedonistischen Glücksbegriff, nach dem Glück als Lust durch Befriedigung libidinöser Regungen verstanden wird, zweifelt etwa Sigmund Freud daran, ob der Mensch von seiner natürlichen Ausstattung her überhaupt dauerhaft glücklich sein kann. Unter Verweis auf die Bedingungen des konkreten alltäglichen Lebens mit allen Enttäuschungen, Schmerzen und Problemen, die von Seiten des eigenen Körpers, der Außenwelt und der Mitmenschen drohen, und angesichts der Tatsache, dass wir als Menschen gemäß dem Lustprinzip nur den Kontrast, d. h. die plötzliche Befriedigung hochaufgestauter Bedürfnisse als Glück genießen können, kommt Freud zur Überzeugung, dass „die Absicht, daß der Mensch ,glücklich‘ sei, […] im Plan der ,Schöpfung‘ nicht enthalten“2 ist. Ansonsten müsste die Konstitution seiner Natur eine andere sein. Schon vor Freud hat die mittelalterliche Theologie seit Augustinus darauf hingewiesen, dass das Glück des Menschen nur ein begrenztes und unvollkommenes sein kann. Wahre und ungetrübte Erfüllung der Glückssehnsucht sei erst im Himmel möglich. Diese theologische Sicht mit ihrem Verweis auf Gottes Heilswirken bedeutet einerseits eine Entlastung für den Menschen und sein Leben als einzige und letzte Chance, Glück zu erlangen, andererseits birgt sie die Gefahr der Vertröstung und damit der Legitimierung Glück verhindernder Zustände oder Unglück erzeugender Verhaltensweisen.
Als spezifisch menschliche Qualität hängt das Glück wesentlich davon ab, wie der Mensch die Bedingungen seines Lebens annimmt und den Möglichkeiten gemäß sein Leben gestaltet. Um mit Viktor E. Frankl zu sprechen: Sinn und Glück stellen sich ein auf dem Weg der Verwirklichung von schöpferischen Werten, Erlebniswerten, aber auch Einstellungswerten,3 d. h. in der kreativen Gestaltung von Welt, im dankbaren Empfangen und Genießen von Schönem und Erfüllendem, aber auch in der bewusst vollzogenen Annahme von Leidvollem und Schicksalhaftem. So wichtig die Rolle der einzelnen Person im Erleben von Glück ist, hängt es doch auch von vielen äußeren Bedingungen ab. Diese sind zwar essentiell, werden oft aber überschätzt. Eine sehr hohe Stellung in der Hierarchie der Bedingungen, von denen Menschen glauben, dass ihr Glück abhängt, hat materieller Reichtum. Zweifelsohne ist ein gewisses Maß an materiellen Ressourcen notwendig, um das Leben als glücklich zu empfinden. Geld macht also in gewissem Sinn glücklich, aber natürlich nicht Geld allein bzw. Geld an sich. Ab einem gewissen materiellen Wohlstand trägt der Reichtum nichts mehr bei zum eigenen Glück. Im Gegenteil, die Fixierung auf den sozialen Status oder auf das Anhäufen materiellen Reichtums untergräbt das persönliche Glückserleben.
Glück steht vor allem auch in einem größeren Kontext. Der einzelne Mensch kann nicht im Rahmen einer „splendid isolation“ glücklich sein. Die Frage der Lebensqualität (quality of life) verbindet alle das Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft im Kleinen wie im Großen betreffenden Bereiche, sei es Soziales, Gesundheit, Wirtschaft, politische und gesellschaftliche Strukturen sowie Sicherheit. Das Wohlbefinden der Gesellschaft im Ganzen innerhalb eines Staats, ebenso wie der Wohlstand der Menschheit im globalen Sinn können also aus der Frage nach dem Glück des Menschen nicht ausgeklammert werden. Hinsichtlich seiner Verantwortung für das Glück seiner Bürgerinnen und Bürger gab und gibt es unterschiedliche Doktrinen. Wird in kollektivistischen oder totalitären Systemen die Rolle des Staats überschätzt, so wird sie in individualistisch-liberalistischen Ideologien zu Lasten des sozialen Ausgleichs unterbewertet. Die Brisanz dieser Frage wurde in den letzten Monaten verstärkt bewusst, als in Folge der weltweiten Finanzkrise der Ruf nach einem zum Schutz der Einzelnen stärker normierenden und intervenierenden Staat wieder unüberhörbar war. Generell ist es wohl so: Der Staat kann nicht Garant für das persönliche Glück sein, aber eine verlässliche staatlich-demokratische Struktur ist dessen unverzichtbare Voraussetzung.
Die Mitverantwortung für das Glück des anderen spüren wir wohl am deutlichsten im Umgang mit unseren Kindern. Alle Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder glücklich sind und alle Voraussetzungen mitbekommen, um später eigenständig ein glückliches Leben führen zu können. Die Ergebnisse der Studien hinsichtlich der Frage, was Kinder wirklich glücklich macht, sind vielfältig, bisweilen überraschend. Manche Klischees, etwa dass Kinder aus geschiedenen Ehen unglücklicher sind, können für die Zeit des Kindseins nicht erhärtet werden. Übergreifend zeigt sich, dass stabile Beziehungen eine der wichtigsten Grundlagen sind. Darüber hinaus ist es für Kinder eine wertvolle Lebenshilfe zu lernen, dass nicht jeder Wunsch sofort erfüllt werden kann und muss. Grundvoraussetzung für ein glückliches Leben im Erwachsenenalter ist die Kultur des richtigen Umgangs mit Sehnsucht. Sehnsucht ist eine der Lebensquellen des Menschen. Keine Sehnsucht zu haben, wird als großes Unglück erlebt. Der Mensch hat kein Ziel, kein Interesse, das ihn antreibt, keine Vision, auf die er zustrebt. Mit Sehnsucht gilt es aber richtig umzugehen, d. h. es auszuhalten, dass sie nicht sofort oder nicht gemäß der eigenen Vorstellung erfüllt wird. Um die Spannung der Nichtidentität von Sehnsucht und Wirklichkeit zu entschärfen, greifen manche Menschen zu Suchtmitteln, die ihnen eine trügerische Befriedigung verschaffen. Wahrscheinlich ist auch das Glück selbst Inhalt einer nie vollkommen zu erfüllenden Sehnsucht. Doch schon das Ernst-Nehmen und die Pflege dieser Sehnsucht – in einer Abwandlung von Voltaires Wort könnte man sagen: das umsichtige, liebevolle Bestellen des Gartens des Glücks – ist ein Weg zum Glück. Diese Dimension des Glücks wird besonders in der Welt der Literatur, der bildenden Kunst und des Films deutlich. Trotz mancher ästhetischer Bedenken und Einwände finden sich hier Beispiele, in denen die vielschichtige, ambivalente und heterogene Wirklichkeit des konkret gesuchten und erfahrenen Glücks in beeindruckender Weise Gestalt annimmt. Es ist auf die dialektische Struktur des Glücks zurückzuführen, dass dies oft in Verbindung mit Unglück, Leid und Verzweiflung geschieht. Dennoch bekommen wir eine Ahnung davon, dass Glück mehr ist als ein schönes, jedoch leeres Wort – eine Wirklichkeit in uns, die vielleicht nur mit wachem Herzen neu entdeckt und sorgsam gepflegt werden will.
Der vorliegende Band beruht überwiegend auf Ergebnissen der interdisziplinären und interuniversitären Ringvorlesung „Auf der Suche nach Glück“, die im Wintersemester 2009 / 2010 im Rahmen des Schwerpunkts „Wissenschaft und Kunst“ an der Universität Salzburg stattfand. Unser Dank gilt Stephanie von Liebenstein, Inga Deventer, Carolin Köhne und Dr. Jörn Laakmann, die den Band seitens des Verlages professionell betreut haben. Danken möchten wir vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Fachbereich Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg für die Unterstützung bei der redaktionellen Bearbeitung der Texte, namentlich Manuela Berndorfer, Thomas Seissl, Zlatko Valentic und besonders der Leiterin dieses Teams, Antonia Weinert.