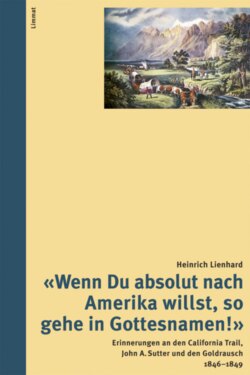Читать книгу "Wenn Du absolut nach Amerika willst, so gehe in Gottesnamen!" - Heinrich Lienhard - Страница 6
ОглавлениеHeinrich Lienhards Biografie 1822–1846
Kindheit und Jugend auf dem Ussbühl 1822–1843
Heinrich Lienhard wurde am 19. Februar 1822 in Bilten, Kanton Glarus, geboren. Er war ein Nachfahre Conrad Leonhardts1 von Urnäsch, der im 17. Jahrhundert aus dem Appenzellerland in die Linthebene gezogen war und sich am Ussbühl niedergelassen hatte, einem zu Bilten gehörenden Weiler. Heinrichs Eltern, Kaspar und Dorothea Lienhard-Becker,2 bewirtschafteten einen einfachen Bauernhof mit einigen Hektar Land und einem bescheidenen Viehbestand. Dorothea Lienhard gebar sieben Kinder, von denen drei im ersten Lebensjahr starben.3 Heinrichs Geschwister waren Peter, geboren 1812, Barbara (1819) und der jüngere Bruder Kaspar (1825).
Lienhards Geburtshaus steht in malerischer Lage hoch über dem Talgrund, nur ein paar Schritte von der Kantonsgrenze entfernt, die den Ussbühl in eine schwyzerische und eine glarnerische Hälfte trennt. Es ist noch heute in Familienbesitz und bietet seinen Bewohnern einen einzigartigen Blick von der March im Westen, über das weite Riedland der Linthebene im Norden bis zu den Vorläufern der Glarner Alpen im Osten. Hinter dem Haus ragt der bewaldete Nordhang des Hirzli in die Höhe, über den ein steiler Fussweg zum ehemaligen Bergland der Familie hinaufführt, wo Heinrich oft Vieh hütete und Holz sammelte. Auf alten Karten ist dort noch die Bezeichnung «Lienhard-Berg» (heute Hämmerliberg) zu finden, dem früheren Brauch entsprechend, eine Alpweide nach ihrem Besitzer zu nennen.
Obwohl seit seiner Jugend auf dem Ussbühl viele Jahre vergangen sind, blickt Heinrich Lienhard beim Schreiben ohne Verklärung auf jene Zeit in der alten Heimat zurück, wenn er gleich zu Beginn seiner Erinnerungen feststellt: «Meine Eltern waren brave und arbeitsame Bauersleute, welche uns, solange ich mich zu erinnern weiss, zu strenger Zucht und zur fleissigen Arbeit hilten.»4 Die unbeschwerten Kinderjahre waren von kurzer Dauer, denn der Vater setzte dem fröhlichen Kritzeln auf dem grossen Schiefertisch in der Wohnstube bald ein Ende. «Schon im sechsten Jahre musste ich Vieh hüten», erzählt Lienhard, «man band einer Kuh, welche im Sommer nicht auf die Alpen getrieben wurde, einen Strick um die Hörner, an diesem musste ich sie auf unserm Grundstück halten.»5 In den folgenden Jahren wurde der Viehbestand auf zehn bis fünfzehn Tiere vergrössert; der Hütedienst erstreckte sich nun im Frühling und Herbst jeweils über die ganze Woche, einschliesslich Sonntag, und er wurde auch schwieriger, besonders auf Wiesen, wo es weder Hecken noch Zäune noch Gräben gab.
So ist es nicht verwunderlich, dass ein kleines Drama während des Viehhütens zu Lienhards ersten und eindrücklichsten Kindheitserinnerungen gehörte. Es ereignete sich im Sommer auf dem Bergland, wo das Hüten besondere Aufmerksamkeit erforderte. Der Tag war schwül, die von Fliegen und Mücken geplagten Tiere wurden unruhig und versuchten, durch Gebüsche und Wald davonzulaufen. Heinrich war auf Geheiss seines älteren Bruders damit beschäftigt, Tannäste einzusammeln, als ein junger Ochse, der sich ein wenig von der Herde entfernt hatte, auf einer Felsplatte ausrutschte und in einen der steilen Lattenzüge fiel, eine Art grosse Rutschbahnen, auf denen Heuballen und Bäumstämme bequem ins Tal befördert werden konnten. Auch der Ochse glitt nun wie ein Stück Holz einem nahezu senkrechten Felsabsatz zu und stürzte über diesen hinaus in die Tiefe. Weinend rief Heinrich zum Elternhaus hinunter um Hilfe, worauf bald der ältere Bruder bei ihm erschien. Er hörte sich die Geschichte an und machte sich dann auf die Suche nach dem Tier, «mich noch versichernd», so Lienhard, «dass ich dafür vom Vater ganz sicher eine recht ordentliche Portion Prügel bekommen werde».6
Der Bemerkung Peters hätte es kaum bedurft, denn Heinrich wusste selbst, was ihn erwartete: «Es war bereits dunkel, als ich unter grossem Bangen unser Haus erreichte, Vater und Bruder waren noch an der Stelle, wo der junge Ochs endlich nicht mehr weiter rollen konnte. Was mir die Mutter vom Vater mich betreffend sagte, war wenig ermunternd für mich. Sie hiess mich in die Wohnstube gehen, wo ich hinter dem Ofen fast mit Todesangst die Ankunft des Vaters erwartete.»7 Dass er an diesem Abend ohne Schläge davonkam und der Vater nur schimpfte, erschien ihm wie ein Wunder; er ahnte wohl, dass er dies der Fürsprache seiner Mutter zu verdanken hatte. Doch auch der scharfe Tadel prägte sich ihm tief ein: «Die Worte des Vaters, er würde mich dem Ochsen nachgeschmissen haben, wenn er dabei gewesen wäre, machten ein unvergesslicher Eindruck auf mein Gemüth, war es mir doch, als ob ich bereits über die Felsen und Abhänge des Lattenzugs hinunter stürze, Hals und Knochen bräche und natürlich mause Tod unten ankomme.»8
Der Zwischenfall hatte ein Jahr später ein Nachspiel, indem sich an derselben Stelle das gleiche Unglück ein zweites Mal anbahnte. Die Worte des Vaters noch deutlich im Gedächtnis, unternahm Heinrich ein riskantes Klettermanöver, um das Tier vor dem Hinunterfallen zu bewahren. Als er später dem Vater davon erzählte und ihm die gefährliche Stelle zeigte, meinte dieser, Heinrich hätte sich wegen des Tieres nicht derart in Gefahr begeben dürfen. Der Knabe erinnerte ihn darauf an seine früheren Worte, «da wurde er noch ernster und besonders still; er sagte mir, dass wier einen Zaun bauen werden, damit dann keine solche Gefahr mehr mir entstehen soll».9 Und mit besonderer Genugtuung erfüllte es Heinrich, als er abends den Vater zur Mutter sagen hörte: «Das war eine rechte Torrheit von mir, dass ich dem Jungen damahls sagte, dass, wenn ich dabei gewesen wäre, als der frühere Stier den Lattenzug hinunter fiel, ich ihn auch mit hinunter geschmissen haben würde. Wäre der arme Junge jetzt tod, so müsste ich mir mein Leben lang Gewissensvorwürfe machen!»10
Für Kaspar Lienhard war es selbstverständlich, dass seine drei Söhne Bauern würden. Für seine Frau und Kinder blieb dies nicht ohne Folgen: «Da mein Vater trotz seinem Zeitunglesen denselben Grundsätzen wie die meisten übrigen Bauersleute huldigte, nämlich: ‹Bleibe im Lande und nähre dich Redlich!›, so meinte er, dass seine Söhne ganz Dasselbe Leben treiben müssten, wie er, sein Vater und sein Grossvater es getrieben, und so glaubte er sich verpflichtet, so viel Land zu kaufen, dass jeder von uns die Bauerei auf ähnliche weise wie er betreiben sollte. Da er aber dieses viele Land nicht alles bezahlen konnte, musste er sich in Schulden einlassen, und nun gab es erst recht alle Hände voll Arbeit.»11 Während der grosse Bruder auf dem Hof zupackte, wie der Vater es von ihm erwartete, entwickelte sich Heinrich schon früh in eine andere Richtung. Er hütete ungern Kühe, liess sich vom älteren Bruder nur widerwillig Befehle erteilen und nahm auch die ihm vom Vater verordneten Arbeiten in Feld und Stall ohne grosse Begeisterung an die Hand. Er war ein neugieriges Kind und ging gerne zur Schule, wo sich schon bald andere Interessen und Begabungen bemerkbar machten. Kaspar Lienhard beobachtete diese frühen Anzeichen von Unabhängigkeit mit Argwohn und war offensichtlich entschlossen, auch Heinrich zum Bauern zu erziehen – wenn möglich durch Arbeit, wenn nötig durch Strafen.
An die harten, oft ungerechten Strafen erinnert sich Lienhard mit bitteren Gefühlen: «Die Jahre vergiengen auf diese weise auf gleichförmige art. Ich hatte bei den gewöhnlichen Arbeiten mitzuhelfen; schon im neunten Jahre musste ich helfen Heu rechen und Grund umgraben, und war ich da nicht so fleissig, wie mein Vater meinte, dass ich sein könnte, so gab es Ohrfeigen in Hülle und Fülle, so dass eines Abends ein Nachbar meinem Vater ordentlich Vorwürfe derwegen machte. Ich erinnere mich noch sehr wohl, dass ich beorfeigt wurde, blos weil ein Nachbar einige (wie mein Vater glaubte) ungerechte Ausdrücke gegen ihn sich erlaubte. Freilich that es ihm gleich nachher wieder recht leid derwegen, aber die Straffe war damit nicht Ungeschehen zu machen, und es war für mich nur ein schlechter Trost, ja ich war schon lange gewöhnt, mich selbst als eine Art Sündenbock zu betrachten, indem ich fast immer nach Vaters Ansicht der allein Schuldige für alles sein musste, wenn etwas nicht gieng, wie er es wünschte.»12
Umso wichtiger war für Heinrich der Einfluss seiner Mutter. Sie versuchte stets zu vermitteln und zu schlichten, und ihre vernünftigen Worte bewirkten oft, dass eine Strafe des Vaters milder ausfiel als befürchtet: «Meine Mutter war eine anständige, brave Frau und gute, sorgsamme Mutter, welche ihre Liebe gleichmässig auf ihre Kinder vertheilte. Sie war viel mehr befähigt, die Eigenschaften ihrer Kinder zu beurtheilen, als der Vater. Wenn sie es für nöthig hielt, konnte sie auch strafen, und ihre Strafe war empfindlich, aber sie versuchte es doch auch mit gütigen Worten und Mahnungen, und diese hatten immer ihre guten Wirkungen.»13
Neben der Mutter fand Heinrich in der Person des Gemeindepfarrers von Bilten einen wichtigen Verbündeten. Rudolf Schuler war ein engagierter Kämpfer für die allgemeine Schulpflicht und ein grosser Förderer des Glarner Schulwesens.14 Dank seinem unermüdlichen Einsatz gab es in Bilten früher als in den meisten anderen Gemeinden des Kantons ein Schulgesetz, das die Eltern verpflichtete, ihre Kinder bis zum 16. Altersjahr zur Schule zu schicken,15 und er sorgte auch dafür, dass es befolgt wurde: «Genaue Absenzenverzeichnisse wurden geführt und die saumseligen Eltern und Kinder erst ermahnt, dann vor Stillstand citirt, und wenn dies nicht fruchtete, gab es auch einzelne Fälle, die der Obrigkeit verzeigt wurden.»16 Während der Pfarrer für die unteren Klassen einen Hilfslehrer einstellte (aber die Aufsicht über alle Klassen vertrat), übernahm er die oberen Klassen der Dreizehn- bis Sechzehnjährigen selbst. Sein Lehrplan umfasste Sprache, Religion, Rechnen, Vaterlandsgeschichte, biblische Geschichte, Geografie sowie Zeichnen und Musik. Rudolf Schuler galt als strenger Lehrer, doch Heinrich verlor seine Angst vor ihm schon am ersten Schultag, als der Pfarrer auf ihn zutrat, ihn nach seinem Namen fragte und für seine ersten Schreibversuche lobte. Er merkte bald, dass der Pfarrer die Schüler, die sich Mühe gaben, freundlich behandelte und nicht überforderte, «er war mehr gegen Nachlässige oder Possenreisser manchmahl etwas scharf, welche es aber auch gewöhnlich wohl verdienten.»17
«Ich machte im Ganzen wenn auch gerade keine riesigen, doch zimmliche Fortschritte in der Schule», meint Lienhard rückblickend, «so dass ich die zwei letzten Jahre meistentheils, das letzte Jahr aber fast Fortwährend der Oberste in der Klasse18 beim Pfarrer war. Geographie, Gegensätze19 und Aufsätze waren mir angenehme Beschäftigungen, und gab es einmal zur Abwechslung Naturhistorische Geschichte, so war ich mit Leib und Seele dabei. Ich gestehe, dass es aber auch Dinge gab, welche ich nicht gern lernte, ja sogar eine art Antipaty dagegen hatte. Eines war Noten lernen, ein sehr langweiliges Geschäft für mich, da ich ja bald jede Melodie nach ein paarmahligem Abhören schon auswendig konnte. Dann war das ortographisch Richtigschreiben mir ganz Wiederwärtig. Ich begreife Heute noch nicht, warum ich mich in diesen zwei Fächern nicht besser befleisste, besonders im Letzten. Gramatikalisch und Ortographisch Richtig schreiben können ist gewiss zu jeder Zeit eine Hauptsache. Dieses wusste ich indessen Recht wohl, aber der Wiederwillen dagegen war leider zu gross, als dass meine Vernunft darüber gesiegt hätte.»20
Pfarrer Johann Rudolf Schuler (1795–1868), Lehrer und Förderer Heinrich Lienhards.
Ungeachtet dieser Abneigung gegen die Orthografie schrieb Heinrich gerne Aufsätze, wobei der Pfarrer ihn nach Kräften unterstützte. Er bedachte die Arbeiten seines Schülers stets mit lobenden Worten und vermittelte ihm dadurch Selbstvertrauen im schriftlichen Ausdruck sowie Freude am Erzählen, Eigenschaften, ohne die später vermutlich weder Reisenotizen noch Manuskript entstanden wären. Zwischen Pfarrer Schuler und Heinrich Lienhard scheint vom ersten Schultag an eine Art stilles Einverständnis bestanden zu haben: Schuler freute sich über den Lerneifer des aufgeweckten Bauernbuben vom Ussbühl, und Heinrich fand beim Pfarrer die Anerkennung und Förderung, die sein Vater ihm nicht geben konnte.
Die folgende Episode zeigt anschaulich, wie viel dem Heranwachsenden die Wertschätzung des Pfarrers bedeutete und wie bestrebt er war, sich diese zu erhalten. Eines Tages beobachtete Heinrich bei einer Schreibübung, dass einige Kameraden in der Reihe vor ihm eine kurze Abwesenheit des Pfarrers dazu benutzten, bei den vor ihnen sitzenden Mädchen abzuschreiben. Als der Pfarrer zurückkam, ging er durch die Bankreihen, korrigierte nacheinander alle Schiefertafeln und strich bei Heinrich sechzehn Fehler an. «Ich hatte allerdings viele erwartet», gesteht dieser, «aber doch soviele nicht, und im Bewusstsein, dass die Untern ihre Aufgaben gar nicht selbst gemacht hätten, machte ich anstatt der 16 nur 14 auf die Tafel, und zwar schnell und im selben Augenblick, als der Pfarrer dem Nächsten nach mir die Tafel abnahm. Als ich diese famose That begangen, zeigte ich die Tafel meinem nächsten Nachbar. Nun war aber auch seine Tafel schon kurigirt; er hatte einige Fehler weniger als ich, drei oder vier der Untern aber noch weniger.
Als alle kurigirt waren, kam der Pfarrer wieder zu mir, um zu fragen, wie viele Schreibfehler ich habe (denn jetzt sollten die Schüler danach die Plätze wechseln), leider gab ich ihm nicht die Sechszehn, sondern nur Vierzehn an. ‹Das ist nicht die Wahrheit›, sagte er, ‹hast du nicht Sechszehn?› – ‹Ich habe Vierzehn, Herr Pfarrer!›, war meine Antwort, denn ich dachte, wenn einer 16 hat, muss er gewiss 14 haben und lügt daher nicht, wenn er so sagt. Aber ein Schlag auf mein Gesicht – es war der Erste und auch der Letzte, den er mir je gab – lehrte mich sogleich, dass der Pfarrer die Sache anders auffasste als ich. Ich war sehr ärgerlich, aber noch mehr beschämt, und bereute sogleich, diesen Betrug versucht zu haben. Doch sagte ich ihm noch, dass mehrere Nachbarn ihre Aufgabe gar nicht selbst gemacht und sie sowohl als ich Strafe verdient hätten; denn ich hatte sie noch lachen sehen und war nicht geneigt, still zu bleiben.»21
Der Pfarrer liess sich dadurch aber nicht beeindrucken, denn er schien entschlossen, dem Knaben eine Lehre zu erteilen, die ihm das Lügen in der Zukunft verleiden würde. Nicht nur liess er die Mitschüler ungestraft, sondern er befahl Heinrich auch, sich an einem gut sichtbaren Ort hinzustellen und sich zu schämen. «Ich fühlte diese Demüthigung nur zu sehr», erinnert sich Lienhard, «auch war ich überzeugt, dass ich sie reichlich verdient habe, und ich nahm mir vor, in Zukunft durch gutes Betragen und tüchtiges Lernen den guten Willen des Pfarrers wieder zu gewinnen.»22 Den Mitschülern zeigte Heinrich seine Verachtung, indem er sich anderntags nicht, wie der Pfarrer es verlangte, neben die «Abschreiber» setzte, sondern freiwillig in die unterste Bank. Der Pfarrer schien ihm die kleine Eigenmächtigkeit nicht übel zu nehmen, sondern behandelte ihn, wie Heinrich erleichtert feststellte, sogar freundlich, «wodurch ich nur noch mehr in meinem Beschluss erstarkte, in Zukunft mir keine derartige Vergehen mehr zu schulden kommen zu lassen».23
Er wusste, dass die beste Gelegenheit, das Vertrauen des Pfarrers zurückzugewinnen, der nächste Aufsatz sein würde. Aufsatzschreiben stand zwar erst in einigen Tagen auf dem Programm, aber möglicherweise bemerkte der Pfarrer die Ungeduld seines Schülers, und vielleicht war er ja auch selbst nicht ganz glücklich über die Ohrfeige vom Vortag – jedenfalls entschied er sich, sein Unterrichtsprogramm zu ändern. «Gegen mein Erwarten und zu meiner grossen Freude erhielten wir am selbigen Tage schon den Auftrag, auf den nächsten Tag Aufsätze zu schreiben, und er gab uns die Wörter auf, über welche wier schreiben sollten, die er dann wie gewöhnlich einigermassen auseinander setzte. Ich konnte meine Freude darüber kaum verbergen, und ich erinnere mich noch sehr wohl, wie mich der Pfarrer lächelnd ansah. Er mochte wohl wissen, was ich empfand, und ich glaube, dass ich das empfand, was er sich vorstellte. Mit besonderm Eifer gab ich mich meiner Aufgabe hin, um das Wort oder die Meinung und Bedeutung dessen womöglich recht und richtig zu erklären, auch gab ich mir Mühe, dass Dieselbe so Fehlerfrei als möglich ausfiel.
Mit Begierde erwartete ich am nächsten Tag den Augenblick, wo er unsere Aufsatzschriften entgegen nahm, und konnte meine Ungeduld kaum mässigen, bis ich die Meinige, von ihm kurigirt und mit seinem geschriebenen Urtheilsspruch darunter, wieder zurück erhielt. Meine Erwartung war nicht nur nicht getäuscht, sondern übertroffen, denn es war das beste Urtheil, welches mir bis dahin zu Theil geworden. Und es war für mich eine besondere Genugthuung, auf diese art und so bald den ersten Platz wieder einzunehmen, und ich konnte ein kleines, frohlockisches Lächeln kaum verbergen, ja sogar der Pfarrer selbst schien mir dadurch ein wenig Vergnügt. Von nun an blieb ich oben, und ich führte mich so auf, dass ich keinen Grund mehr zur Unzufriedenheit gab.»24
Pfarrer Schulers für damalige Zeiten fortschrittliche Ideen stiessen bei vielen Eltern auf Unmut und Ablehnung, so dass er sich zeitweise heftigem Widerstand ausgesetzt sah. Gerade das häufige Aufsatzschreiben entwickelte sich zu einem Stein des Anstosses bei der Dorfbevölkerung, denn «dabei sollen von den Kindern oft 10 bis 20 Seiten lange Aufsätze eingeliefert worden sein, manche bis spät in die Nacht hinein darüber gearbeitet haben. Hatte daran der Hr. Pfarrer seine Freude und spornte er durch Ruhmeserhebung der Fleissigen auch die Andern zu ähnlichen Leistungen an, so erschienen diese Hausaufgaben seinen Leuten von Bilten als etwas Unerhörtes, zu der Väter Zeiten nicht Dagewesenes, als eine all zu überspannte Forderung, und beschloss desshalb die Gemeinde 1835, dass alle und jede Aufsatzarbeit bei Hause untersagt sein solle und erneuerte dieses Verdikt auch 1837, 1839 und noch wieder 1853.»25
Nicht viel besser erging es dem Pfarrer mit seinen Bemühungen, die persönlichen Talente der Schüler zu fördern. Heinrich war unter den Mitschülern als «Zeichenkünstler»26 bekannt, und auch dem Pfarrer war seine Begabung nicht lange verborgen geblieben. Er brachte ihm deshalb zuerst einfache, dann immer anspruchsvollere Vorlagen mit, die der Knabe nach Hause nehmen durfte, um sie abzuzeichnen und die verschiedenen Formen zu üben. Vom Lob des Pfarrers ermutigt, scheint Heinrich dabei jenen Eifer entwickelt zu haben, den sein Vater bei der Arbeit in Feld und Stall vermisste. Die Folgen waren hart für Heinrich: «Gerne wollte ich regnerische Tage zum Zeichnen benützen, aber da hiess es vom Vater: ‹Heraus mit dem faulen Kerl, ich will ihm schon zeichnen mitten im Tage, wenn man so viele nöthige Arbeit zu verrichten hat! Deine Zeichnerei bringt uns doch kein Brod ins Haus, ist auch für Bauersleute ganz unnütz.›
Mein Vater war überhaupt der Ansicht, dass ein Bauer nebst Schreiben, Lesen und Rechnen sonst gar keine weitere Schulkenntnisse bedürfe. Unter diesen Umständen blieb mir daher keine Zeit zum Zeichnen ausser Abends, nach dem Abendessen, beim trüben Schein der Öllampe. Da mag Jeder, der es versucht hat, schon wissen, ob man dabei Vortschritte machen kann und ob dessen Augen eine solche Anstrengung auf längere Zeit aushalten können. Die meinigen entzündeten sich bald, und ich ward verbunden, das Zeichnen für eine Zeitlang ganz zu unterlassen. Unser Pfarrer meinte zwar, meine Eltern bewegen zu können, dass sie mich entweder zum Maler, Musterzeichner oder Bildhauer ausbilden lassen sollten, indem er sagte, dass es eine Sünde sei, ein solch gutes Talent nicht auszubilden, womit ich in Zukunft ein gutes Auskommen finden könnte. Doch war alles umsonst, und mein Vater war darin nicht zu bereden.»27
Am Palmsonntag 1838 wurde Heinrich konfirmiert und damit aus der Schule entlassen. In Bilten gab es zu jener Zeit keine Möglichkeit, eine höhere Schule zu besuchen, und auswärtiger Schulbesuch kam nicht in Frage. Auch später noch merkt er dies mit Bedauern an: «Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie ich Jünglinge meines alters oft um ihr Glück beneidete, deren Eltern befähigt waren, sie auf höhere Lehranstalten zu schicken, und welche dann in den Ferienzeiten mit punten Farben um ihre Kapen oder farbigen Schlingen als sogenannte Studenten fröhlich nach ihren Heimathen zurück kehrten. Nach meines Vaters Wille sollte ich von nun an ganz Bauer werden, denn dass man mich nach meinem Geschmack, Willen oder Talent frage, fiel meinem Vater natürlich nicht ein. Das musste der Vater ja besser wissen als ich, so meinte er, und damit hatte ich mich zu fügen, mochten da meine Gedanken in die weite, liebe Welt hinaus schweifen, so viel sie wollten. Und wie oft schweiften meine Gedanken hinaus, besonders wenn ich oben auf dem Berg beschäftigt war! Die herrliche Aussicht über das weite Thal, in welchem unser Vaterhaus stand, die Berge, Tähler, Flüsse und Seeen von vier sich nahegrenzenden Cantonen, die prachtvolle Aussicht auf den Zürichsee mit seinen zahlreichen prächtigen Ortschaften! Dorthinunter, dorthinaus, war es mir immer, werde, ja müsse ich einst auch gehen. Doch waren dieses vor der Hand nur eitle, sehnsüchtige Träume, und mir schien nur wenig Aussicht vorhanden, dass diese Träume jemahls realisirt werden würden.»28
Ganz so hoffnungslos war seine Lage jedoch nicht, denn ein anderer junger Mann in der Familie hatte dieselbe Idee bereits in die Tat umgesetzt: Heinrich Schindler aus Mollis, ein Cousin zweiten Grades, war Anfang Dreissigerjahre in die USA ausgewandert. Mochten die Umstände, unter denen er seine Heimat verlassen hatte, auch nicht die glücklichsten gewesen sein,29 so las Heinrich dennoch fasziniert seine Briefe und fasste bereits damals heimlich den Entschluss, später ebenfalls nach Amerika zu reisen. Drei Jahre nach Heinrich Schindler erfüllten sich auch zwei Cousins, je ein Sohn zweier Brüder des Vaters, diesen Traum, und es ging ihnen gut in den USA.30 Ihre Nachrichten hielten Heinrichs Fernweh wach und bestärkten ihn in seinem Gefühl, das Leben werde auch ihm mehr zu bieten haben als nur harte Arbeit und eine bescheidene Existenz auf dem Ussbühl.
Lienhards Erinnerungen an die Jahre nach der Konfirmation zeigen, dass er sich sehr wohl mit der Landwirtschaft verbunden fühlte, dass ihm aber die herkömmliche Art und Weise, wie der Vater sie betrieb, wenig Anreiz bot: «Mein Vater […] hielt durchaus nichts auf Neuerungen, sondern liess alles beim Alten, mochte es zweckmässig sein oder nicht. Denn so hatte er eine Sache betrieben, ebenso sein Vater und noch gar viele andere Leute, und diese waren doch auch keine Narren. Diese Neuerungen taugen wenig oder nichts; recht tüchtig drauflos arbeiten, das war die rechte Art, damit kann man nur sein Leben machen. […] Dass der Mensch, der doch von Gott mit gesunder Vernunft erschaffen ist, diese zu seinem und seiner Mitmenschen Vortheil und Verbesserung der Lage nach besten Kräften und Vermögen verwenden sollte, scheint mein Vater nicht recht begriffen zu haben.»31
Heinrich wollte Neues lernen und moderne Methoden ausprobieren. Ein Zeichen in dieser Richtung setzte er im Juli 1841, als er an einem Sonntagmorgen um vier Uhr aufstand und nach Glarus marschierte, um sich dort ein Buch über Landwirtschaft zu kaufen.32 Den Kopf voll neuer Ideen, kehrte er nach Hause zurück, und «Simon Strüf» weckte nicht nur seine lebenslange Leidenschaft für den Obstbau, sondern sollte ihn später auch nach Amerika begleiten und ihm dort gute Dienste leisten: «Ich war jetzt der glückliche Besitzer eines guten und nützlichen Buches, und ich benutzte jeden Moment, um daraus zu lesen und zu lernen, denn es handelte über fast jeden Zweig der Landwirthschaft. Gar viel war über Obstbauzucht daraus zu lernen. Ich lernte daraus Okuliren, auch einige Pfropf- und Kopulirmethoden. Im Herbst gieng ich an das Putzen unserer alten Greise von Fruchtbäumen. Alles Moos und überflüssige alte Rinde musste herunter, und die überflüssigen alten, zum Theil drockenen Äste wurden ebenfalls heruntergesägt. Wenn wier junge Bäume pflantzten, machte ich die Gruben vier Fuss Durchmesser und zwei Tiefe, legte die obere, bessere Erde auf eine und die untere, schlechtere auf die andere Seite der Grube. War der Grund schlecht, so suchte ich diesen durch Bessern theils zu ersetzen, machte mit dem bessern Grund einen Hügel in der Mitte der Grube und setzte den zu pflantzenden Baum auf denselben. Den Wurzeln des jungen Baumes gab ich so viel als möglich die Form eines Rades, füllte die beste und feinste Erde zwischen dieselben, pflanzte um so tiefer, als sie früher gestanden, gab ein gerader Pfahl, füllte auch die schlechtere Erde in die äussern Seiten der Grube, so dass der äussere, schlechtere Grund den innern, bessern um einige Zoll überragte. Waren die Wurzeln dann mit Grund ein wenig bedeckt, goss ich langsam mit einer Giesskanne ringsherum so lange Wasser, bis der feinere und bessere Grund sich zwischen den Wurzeln hinein gesenkt und sich an dieselben angelegt hatte. Kamen einzelne der Wurzeln dadurch wieder zum Vorschein, wurden diese abermahl mit feinem, gutem Grunde gedekt, dann wieder begossen und endlich noch Einmahl mit feiner Erde bedekt. Dann wurde der Baum an den Pfahl gebunden, der Grund während des Sommers locker und rein vom Unkraut gehalten, und ich war stehts sicher, dass gesunde, junge, auf diese Art behandelte Bäume kräftig wuchsen.»33
An abendlichen Freizeitvergnügen für Jugendliche bestand damals nach Lienhards Worten kein grosses Angebot. Die jungen Männer spazierten durch die Dorfgassen, unterhielten sich mit Streichen oder inszenierten Raufereien. Heinrich ging einige Male mit, langweilte sich aber bald und zog es dann vor, zu Hause zu bleiben. Daran vermochte auch der junge Nachbar nichts zu ändern, der ihn eines Tages warnte, er werde auf diese Weise bald als Sonderling angesehen und es heisse bereits jetzt von ihm, er sei «ein Kerl wie ein alter Mann»34. Abwechslung fand er unter anderem beim Musizieren. Der ältere Bruder hatte ein Jahr vor Heinrichs Konfirmation geheiratet,35 und seine junge Frau besass eine Zither. «Dieses Instrument verstand sie ordentlich zu spielen, und bald spielte sie meine Schwester auch, doch beide konnten die Zitter nicht richtig stimmen, welches ich aber für sie that, nachdem sie mir gezeigt, wie es zu thun sei. Natürlich fing ich dann auch bald an selbst zu spielen und überholte damit in kurzer Zeit sowohl meine Schwägerin als meine Schwester; und diese Zitter vertrieb mir denn auch einen grossen Theil von meiner langen Weile.»36
An Sonntagen unternahm er gerne Wanderungen entlang der Linth oder in den Glarner Alpen: «Ich hatte ein besonderes Verlangen, etwas Neues zu sehen, aber neue Landschaftsbilder, von denen es in den heimatlichen Bergen so viele gibt, hatten einen besondern Reiz für mich.»37 Regentage verbrachte er wenn möglich in der Werkstatt, wo er sich am liebsten mit Holzarbeiten beschäftigte. Er reparierte alte Geräte und bastelte Neues, überlegte und tüftelte, bis das Gewünschte – von der Mausefalle über den Hornschlitten bis zum Drechselstuhl – Form annahm und funktionierte. Als eines Tages die Treppe vom Wohnzimmer in den Keller für unsicher erklärt wurde, anerbot er sich, eine neue zu zimmern, wenn der Vater ihm dazu die nötige Zeit in der Werkstatt gebe. Nachdem Heinrich die Arbeit beendet hatte, trugen sie die Treppe gemeinsam in den Keller, «aber Oh weh – sie stand ein klein wenig schief, welches mich so ärgerte, dass ich augenblicklich sie mit der Axt38 in Stücker schlagen wollte. Aber mein Vater gebot mir, dass ich mich dessen nicht unterstehe, denn die Treppe sei ganz gut, und das bisschen Schiefsein hätte nichts zu bedeuten. Zirca 8 bis 10 Jahre späther, als ich wieder einmahl aus Amerika zurück kam, vertrat die Treppe noch immer gute Dienste.»39
Als Heinrich siebzehn Jahre alt war, beteiligte er sich an den freiwilligen Exerzierübungen, die Oberst Schindler für angehende Rekruten in Bilten durchführte. Im Jahr darauf, 1840, nahm er erstmals an den militärischen Vorübungen in Oberurnen teil, die jeder Rekrut zu absolvieren hatte, und zwar während dreier Jahre jeweils eine Woche im April. Er absolvierte diese Ausbildung mit Begeisterung: «Für mich waren diese militärischen Vorübungen ein grosses Vergnügen, und ich glaube kaum, dass irgend einer auf dem Platz zu finden gewesen wäre, der mehr Vergnügen an unsern Übungen empfunden hätte als ich. Ich lernte dabei recht ordentlich, und ich kann dreist sagen, ohne zu prahlen, dass ich im letzten Jahr einer von den am weitesten Vorangeschrittenen war. Ich hatte mehr als Einmahl Schwenkungen komandirt und ausgeführt, welche einer unserer jungen Instrukteure vergebens auszuführen versuchte. Solches konnte natürlich nur geschehen, wenn der Major nicht zugegen war, indem es sonst unserm jungen Instruktör als solchem hätte schaden können. Dieses waren meine glücklichsten Tage in meiner alten Heimath, welche aber leider nur zu schnell vorüber gehend waren.»40
Die Beziehung zum älteren Bruder blieb auch in den Jahren nach der Konfirmation gespannt, umso mehr, als Peter nach dem frühen Tod seiner Frau ins Elternhaus zurückgekehrt war. Zum einen gestaltete der grosse Altersunterschied von gut neun Jahren das Verhältnis zwischen den Brüdern schwierig, zum anderen scheinen sie auch in ihrer Art sehr verschieden gewesen zu sein; dies jedenfalls lassen einige Episoden vermuten, die Lienhard offensichtlich tief gekränkt hatten. Am meisten litt Heinrich, wie schon als Kind, unter der Parteilichkeit des Vaters, der bei Streitigkeiten, ohne nachzufragen, stets dem Älteren Glauben schenkte und die Rivalität der Brüder dadurch noch verstärkte. In dieser ungerechten Behandlung des Vaters liegt wohl auch Lienhards spätere Art begründet, bei einem Streit – ob selbst involviert oder nur um seine Meinung gebeten – den Hergang des Geschehens immer genau zu rekonstruieren beziehungsweise sich erzählen zu lassen, wenn nötig auch zweimal.
Als Erwachsener konnte sich Lienhard das Verhalten seines Vaters mit dessen eigener, besonders harten Jugend erklären. Kaspar Lienhard verlor als Ältester von fünf Geschwistern mit dreizehn Jahren seine Mutter,41 und der Vater, der dem Kartenspiel verfallen war, sorgte mehr schlecht als recht für seine Kinder. «Daher kam es denn wohl auch», glaubt Lienhard, «dass unser Vater, da [er] eine freudlose Jugend durchgemacht,42 selbst keinen richtigen Begriff von einem gutgeordneten Familienleben hatte. Er war hart, ohne es eigentlich zu wollen, er war einseitig, ohne dass er es beabsichtigte.»43 Für den älteren Bruder findet Lienhard keine versöhnlichen Worte dieser Art.
Zukunftsweisend für Heinrich Lienhard waren Erlebnisse wie an jenem Abend, als er von der Feldarbeit nach Hause kam und der grosse Bruder ihn aufforderte, ihm zu helfen, einen grossen Stein wegzuwälzen. Heinrich antwortete ihm, dass er zuerst kurz ins Haus wolle, ihm danach aber helfen werde. Obwohl er sich beeilte, wurde er, als er aus dem Haus trat, von Peter schroff abgewiesen, da diesem inzwischen der jüngere Bruder Kaspar geholfen hatte. Beim Abendessen beklagte sich Peter über Heinrichs mangelnde Hilfsbereitschaft, worauf ein heftiger Streit entbrannte: «Ich antwortete, dass ich ihm doch habe helfen wollen, und erzählte, warum ich nicht sogleich helfen konnte, allein mein Bruder sagte, dass ich lüge, worüber ich sagte, dass er lüge, und nicht ich. Die nächste Antwort war ein Schlag von ihm auf mein Gesicht, welchen ich erwiderte, allein da er natürlich viel stärker war als ich, wurde ich von ihm erfasst und auf die Stubetiele geschmissen. Meine Schwester hörte ich sagen: ‹Das ist Recht!›, meine Mutter mahnte zur Vernunft, aber mein Vater nahm mich nichts weniger als sanft und schmiess mich vor die Hausthüre hinaus! Das war die Behandlung, die mir zu Theil wurde, die Gerechtigkeit, die mir wiederfuhr – weil ich das Herz hatte, eine freche Lüge von meinem Bruder als solche zurück zu weisen und einen Faustschlag mit einem Faustschlag, wenn auch schwächern, zurück zu geben.
Verzweiflung hatte sich meiner nahezu bemächtigt, und ich weiss nicht, was ich gethan haben würde, wenn ich meine liebe, unvergessliche Mutter nicht gehört hätte, wie sie zu Vernunft mahnte, zum unparteiischen Untersuchen der Sache. Ich begab mich in das Gebüsch, von da in das obere, dem Vater gehörende Haus, mich fortwährend mit Gedancken der schlimmsten Art beschäftigend. Bald wollte ich an die Lint eilen, um meinem misserablen Dasein ein Ende zu machen, oder ich wollte doch wenigstens fortlaufen, weit, weit hinaus in die fremde Welt, zu fremden, unbekannten Menschen – schlimmer glaubte ich es nirgends zu bekommen. Längere Zeit wandelte ich umher, aufgeregt und bis ins Innerste gekränkt; dann und wann sah ich empor zu dem herrlichen, vom Monde und den Millionen von Sternen beleuchteten Himmel: Wie herrlich war die Pracht und die Ruhe der Nathur, wie sehr verschieden von meinen Empfindungen!»44 Als seine Mutter ihn endlich fand, erklärte er ihr, dass er die ungerechte Behandlung nicht mehr länger ertragen könne und deshalb fort wolle von zu Hause. «Natürlich beredete die Mutter mich, wieder ins Haus zu kommen, und ihrem mahnenden, vernünftigen Zureden schreibe ich es zu, dass ich mich jene Nacht nicht vom elterlichen Hause trennte.»
Lienhard harrte in jenen Jahren nur seiner Mutter zuliebe auf dem Ussbühl aus. Sie war kränklich, und er wusste, dass auch sie unter der Art des Vaters litt. Deshalb wollte er ihr jetzt, da er bald erwachsen war, zur Seite stehen, wie sie es in seiner Kindheit so oft für ihn getan hatte. «Unsere Mutter besass ein viel klaarerer Verstand [und] richtigeres Begriffsvermögen», urteilt er rückblickend, «und ihr Einfluss und Ansicht waren ein Segen für uns Alle. Leider wollte der Vater ihren überlegenen Ansichten sehr oft nicht beipflichten, indem er sich dadurch seiner vermeinten männlichen Würde abbruch zu thun glaubte. Dadurch geschah es, dass seine Unternehmen manchmahl verkehrt ausfielen, wofür er aber doch lieber nicht die Schuld auf sich nehmen wollte, wenn ihm von der Mutter seine Missgriffe gezeigt wurden. Bei solchen Gelegenheiten gab es dann einigen Zwist zwischen den Eltern, und der Vater konnte sogar Ungerecht und Grob gegen die Mutter werden. Nahmen wir Kinder mehr die Partei mit der Mutter, welches Grösstentheils geschah, weil wir sie auch am meisten im Rechte glaubten, so erbitterte es den Vater dann nur noch mehr, und er wollte selten Gründe annehmen oder hören, bis sein Zorn nachgelassen hatte.»45
Heinrich Lienhards zehn Jahre älterer Bruder Peter (*1812) mit seiner dritten Frau Christina Blumer (*1831) von Nidfurn. Die drei Kinder Christina, Dorothea, und Caspar stammen aus seiner zweiter Ehe mit Dorothea Ackermann von Kerenzen (1821–1848). Peter Lienhard wanderte in den 1850er-Jahren mit seiner Familie nach Brasilien aus.
Heinrich war bereits achtzehn oder neunzehn Jahre alt, als er es einmal wagte, dem Vater energisch ins Gewissen zu reden. Vorausgegangen war ein heftiger Wortwechsel zwischen den Eltern, in dessen Verlauf der Vater die Mutter mit beleidigenden und kränkenden Ausdrücken beschimpft hatte: «Ich frug den Vater, ob er mit seinen ungerechten und unverdienten Zänkereien mit der Mutter uns ein Beispiel geben wolle, wie sich gute Eltern miteinander vertragen sollen. Er bete viel und alle Tage und wolle christlich Handeln, ich könne aber in seinen Zänkereien gegen die Mutter wenig christliches Betragen erblicken. Oder ob er vielleicht lieber hätte, dass die Mutter sterben sollte? Wenn das der Fall sei, so glaube ich, dass er sein Ziel allerdings leicht erreichen werde, denn es habe ihm ja früher schon einmahl ein Arzt gesagt, dass, wenn er seine Frau bald Tod sehen wolle, er sie nur recht zu ärgern brauche, so werde er bald am Ziel sein.»46 Zu seinem Erstaunen hörte ihm der Vater ganz ruhig zu, und seine Worte sollten ihre Wirkung nicht verfehlen: «Ich freue mich jetzt noch, mir sagen zu dürfen, dass mein Vater nachher niemahls mehr Hart und Beleidigend gegen die Mutter war, ja er erzählte mir sogar nach der Mutter Tod einmahl, dass er meine Mahnung sehr zu herzen genommen und beschlossen habe, in Zukunft die Mutter besser zu behandeln. Und er hatte es treulich gehalten.»47
An einem Abend im Dezember 1841 erschien ein Knecht von Barbaras Schwiegervater auf dem Ussbühl und berichtete, Barbara sei recht krank und wünsche sich, dass die Mutter nach Schänis käme.48 Vergeblich versuchten der Vater und die Söhne, die Mutter davon abzuhalten; schon am folgenden Tag begab sie sich zu Barbara, wo sie mehrere Wochen blieb und ihre Tochter gesund pflegte. Nach ihrer Rückkehr auf den Ussbühl geschah, was alle befürchtet hatten: Die Mutter erkrankte ebenfalls am sogenannten Nervenfieber49. Heinrich pflegte sie hingebungsvoll und war untröstlich, mit ansehen zu müssen, wie sie Schmerzen litt und mit jedem Tag schwächer wurde. Auf die drängenden Fragen des Vaters und der Kinder eröffnete ihnen der Arzt schliesslich, dass keine Hoffnung mehr bestehe. Gegen Ende delirierte die Mutter oft, und die Phasen, in denen sie ansprechbar war, wurden immer seltener. Die Schilderung dieser letzten Wochen am Bett der schwer kranken Mutter ist ein sehr persönlicher Abschnitt des Manuskripts; sie bringt die Liebe und grosse Dankbarkeit zum Ausdruck, die Lienhard für die Mutter empfand und sein Leben lang bewahrte.
Am 30. Januar 1842, einem Sonntag, blieb Heinrich, als die Besucher sich für kurze Zeit aus dem Krankenzimmer entfernten, allein bei der Mutter zurück und fragte sie: «‹Liebe Mutter, kennt Ihr mich noch?› Sie öffnete ihre Augen, blickte mich freundlich an und antwortete: ‹Ja, Du bist ja mein lieber Heinrich!› Ich konnte kaum Worte hervorbringen, doch wollte ich sie noch Einiges fragen; aber es waren ihre letzten lieben Worte gewesen, und sie war wieder in Schlummer verfallen, und ihr Puls gieng besonders schnell und laut.»50 Nachdem sich die Familie wieder um das Bett versammelt hatte, starb die Mutter in Heinrichs Armen. «Ich konnte meiner Gefühle kaum Herr werden», beschreibt er diesen Moment, «denn mir war es, als ob sich auch für mich auf dieser Welt alles aufgelöst habe und ich nun nicht mehr existiren könne, und ich glaube, hätte ich auf mein Wort ihr in die Ewigkeit folgen können, ich würde es gethan haben. Nachdem meine erste Aufregung etwas nachgelassen und ich meine Fassung einigermassen wieder erlangt hatte, da war mein Beschluss gefasst: ‹Ich reise nach Amerika›, sagte ich mir, ja ich sagte es offen!»51
Obwohl seine Entscheidung nun feststand, brachte er es nicht übers Herz, den trauernden Vater gegen dessen Willen zu verlassen. Kaspar Lienhard beschloss nach dem Tod seiner Frau, mit dem mütterlichen Erbe sein gesamtes Land den Kindern zu überlassen. Sie teilten es in vier möglichst gleich grosse Teile auf und verlosten diese untereinander. Am begehrtesten war das sogenannte «Heimatgut» mit dem Elternhaus, das lebenslanges Wohnrecht für den Vater und für die unverheirateten Söhne einschloss. Das Los entschied für Peter, und für Heinrich war klar, dass er von seinem Wohnrecht keinen Gebrauch machen würde. Er wollte deshalb die Zeit, bis der Vater seinen Reiseplänen zustimmen würde, für eine Berufslehre nutzen, setzte vorher aber noch ein deutliches Zeichen, indem er im Sommer das ihm zugefallene Land an einer Auktion verkaufte. Dabei spielte ihm der ältere Bruder einen letzten Streich: Obwohl der Vater Peter davor gewarnt hatte, bot dieser mit,52 worauf sich der am Kauf interessierte Nachbar zurückzog. Später liess dieser Heinrich wissen, dass er ihm zweihundert Gulden mehr bezahlt hätte als der Bruder.
Noch im selben Jahr trat Heinrich kurz nacheinander zwei Lehrstellen an, denn er wollte unbedingt einen Beruf erlernen. «Dieses lässt sich leicht sagen», resümiert er seine Erfahrungen, «aber wer in Europa Lehrling sein muss, hat gewiss ein schöner Vorgeschmack von Sklaverei erhalten; mir kam es wenigstens so vor.»53 Zuerst versuchte er es in der grössten Schreinerei von Wädenswil, wo schöne Möbel angefertigt wurden und ein halbes Dutzend Gesellen sowie drei Lehrlinge beschäftigt waren. Er vereinbarte mit dem zukünftigen Meister eine dreiwöchige Probezeit; würde er die Lehre danach definitiv antreten, sollte er sich für drei Jahre verpflichten und vierzig Taler Lehrgeld bezahlen,54 anderenfalls der Familie drei Gulden Kostgeld für die Probezeit vergüten.
Die ungewohnte Arbeit in der Werkstatt war anstrengend, zudem lernte Heinrich schon bald auch alle anderen Pflichten des jüngsten Lehrlings kennen. Sie bestanden darin, «erstens dem Meister zu jedweder Arbeit zu Diensten zu sein, Zweitens das Wasser ins Haus [zu] tragen, Drittens der Frau Meister die Betten für alle Gesellen zu machen und die vielen schnellfüssigen Flöhe zu fangen helfen – ein Geschäft, wobei ich etwas Dumm und Langsamm war. Und endlich sollte ich, wenn der Meister nicht gerade dabei war, auch noch den jungen schwäbischen Lausbuben, welche sich als Gesellen über mich dünkten, allerlei Dienste verrichten und am Sontag auch noch sie Traktiren.»55 Dies alles entsprach nicht seinen Vorstellungen einer Lehrstelle, so dass er nach Ablauf der Probezeit dem Meister die drei Gulden Kostgeld bezahlte und erleichtert auf den Ussbühl zurückkehrte.
Den zweiten Versuch machte er bei Büchsenmacher Pfenninger in Stäfa. «Ich war immer ein Freund vom Schiessen und schöner Schiessgewehre»,56 begründet er seine Wahl, und die dreiwöchige Probezeit verlief denn auch für beide Seiten zufriedenstellend. Das Wohnhaus mit Weinberg befand sich auf einer Anhöhe in schöner Lage, der Meister und seine Frau, die Tochter und die fünf Söhne, von denen der Älteste ebenfalls in der Werkstatt arbeitete, behandelten ihn freundlich, und auch die Kost liess nichts zu wünschen übrig. «Hätte ich da zögern sollen, einen Kontrakt zu schliessen? Ich sollte zwei und dreiviertel Jahre beim Meister bleiben und sollte eilf Dublonen Lehrgeld bezahlen; ich sollte dann aber zu keiner andern Arbeit verpflichtet sein als solche, die zum Erlernen des Büchsenmacher-Geschäft gehörenden. Die erste Hälfte des Lehrgeldes wurde sogleich bezahlt, die zweite Hälfte sollte nach Ablauf der halben Lehrzeit bezahlt werden.»57
In der Werkstatt machte er rasch Fortschritte und war begierig, Neues zu lernen. Der Meister zog aber ein gemächlicheres Tempo vor und fand die wiederholte Bitte seines Lehrlings, er möge ihm mehr zeigen, verfrüht. Heinrich vermutete allerdings, Pfenninger habe wohl eher befürchtet, es könnte ihn dadurch «zu sehr nach baldiger Freiheit gelüsten.»58 So verrichtete er weiterhin die härtesten Arbeiten wie «Züge in neue Büchsenläufe zu ziehen, alte Züge zu erneuen und tiefer zu ziehen, Flintenläufe auszuschneiden und dergleichen, welches bedeutende Anstrengung erforderte, bei welchen Arbeiten ich förmlich dämmpfte.»59
Mit der Zeit stellte Heinrich fest, dass die kleinen Gefälligkeiten, um die er ab und zu ausserhalb der Werkstatt gebeten wurde, sich häuften. Er verstand zwar, dass es für ihn leichter sei als für die Frauen, Wasser aus dem Brunnen ins Haus zu tragen, störte sich aber trotzdem an dem Gedanken, sich für elf Dublonen Lehrgeld zweidreiviertel Jahre «als Wasserträger für die Familie»60 betätigen zu müssen. «Aber ich suchte mich zu trösten und sagte mir, dass ich mir als Lehrjunge eine Kleinigkeit gefallen lassen müsse.»61 Er hackte Holz, half auf dem Feld und im Rebberg, und erst als ihn der Meister einmal aufforderte, Jauche umzuschöpfen, weigerte er sich, dessen Anweisung zu befolgen. «Ich war bereits an meiner Arbeit in der Werkstätte, da kam der Meister. Als er die mir befohlene Arbeit unverrichtet fand, sah er bald nach mir durch das Fenster, bald nach den Jauchen-Behältern und that sehr erzürnt. Um dass das Schlimmste sogleich kommen möge, stellte ich mich an das Fenster hin und sah ihm ruhig durch dasselbe zu. Ich erwartete, ungefähr so Freundlich angesprochen zu werden, als er mich durch seine Brille anschaute; ich hielt sein Blick aber ruhig stehend aus und erwartete ihn im nächsten Moment in der Werckstätte. Aber der Meister gieng ins Haus und hatte kein Wörtchen derwegen zu mir zu sagen.»62
Kurze Zeit später liess man ihn aber wissen, dass er im Frühjahr würde helfen müssen, mit dem Karst den Weinberg umzugraben, Jauche und Mist auszutragen und anderes mehr, worauf Heinrich erwiderte, dass er dies nicht zu tun gedenke. «Meine Lage wurde dadurch nichts besser», erinnert er sich, «weil ich mich weigerte, der gedungene Sklave zu sein, und ich war entschlossen, der Sache sobald als Möglich ein Ende zu machen. Amerika war nun entschieden mein Ziel, doch davon durfte ich einstweilen Niemanden etwas merken lassen.»63
Obwohl er Grund hatte, die Lehre abzubrechen, befürchtete er, der Meister könnte noch die zweite Hälfte des Lehrgeldes von ihm fordern. «Ich war damahls noch Unerfahren», stellt er rückblickend fest, «sonst hätte ich, ohne viele Umstände zu machen, mein Bündel geschnürt und mich dann bestens empfohlen, da der Kontrakt von des Meisters seite verletzt wurde, nicht aber von mir.»64 Er legte sich einen Plan zurecht und schrieb dem Vater einen Brief, in dem er ihm die Situation darlegte und ihn bat, schriftlich von ihm zu verlangen, nach Hause zu kommen, um das von der Mutter geerbte Land zu übernehmen und selbst zu bewirtschaften. Er, der Vater, habe das Land nach dem Tod der Mutter an seine Kinder abgetreten, um davon befreit zu sein, und er könne mit Heinrich keine Ausnahme machen.
Die erste Antwort des Vaters fiel nicht nach Heinrichs Wunsch aus: «Mein Vater war kein Freund der Büchsenmacherei und hatte mir anfangs stark abgerathen, diese Profession zu erlernen, von welcher er ungefähr die selbe Achtung hatte, als wäre sie mit der Kesselflickerei auf einer Stufe. […] In seiner Antwort hiess es, ich hätte mir das Ding besser überlegen sollen, noch befor ich den Kontrakt unterzeichnet und das halbe Lehrgeld, Fünf und eine halbe Dublone, daran bezahlt. Jetzt solle ich womöglich zu bleiben suchen, Zwei und ein Viertel Jahre seien ja doch keine Ewigkeit etc.»65 Heinrich antwortete dem Vater aber postwendend, dass er die Lehrstelle mit oder ohne seine Hilfe verlassen werde, selbst auf die Gefahr hin, die andere Hälfte des Lehrgeldes noch bezahlen zu müssen. Bald darauf traf der gewünschte Brief des Vaters doch noch ein. Heinrich gab ihn dem Meister zu lesen, worauf dieser erklärte, er wolle mit ihm nach Bilten gehen und persönlich mit dem Vater und den Geschwistern reden.
Der Besuch auf dem Ussbühl wurde auf einen Sonntag Anfang 1843 festgesetzt. «Es war noch Finster, als wir den Weg nach Bilten antraten. Es war ein frostiger Februar-Morgen, in den Strassen gab es noch an vielen Stellen Schnee und Eiskrusten. Der Meister lief sehr rasch und war fast immer um ein bis zwei Schritte voraus und stürzte ein paar Mahl nieder, wobei er sich ein wenig Wehe that und welches ich, wäre ich geneigt gewesen, ein Bisschen abergläubig zu sein, als für mich ein gutes Zeichen hätte betrachten sollen.»66 Tatsächlich verlief der Besuch zu Hause ganz nach Heinrichs Wunsch, indem die Familie sich genau an seine Anweisungen hielt und Pfenninger schliesslich einsehen musste, dass die Sache nicht mehr zu ändern war.
Am folgenden Tag marschierte Heinrich mit Pfenninger zurück nach Stäfa, wo der Meister ihn noch einen grossen Haufen Holz sägen und hacken hiess. «Um keine Unzufriedenheit durch eine Weigerung hervorzurufen, gieng ich rüstig an die Arbeit, sägte mit verdopelter Kraft drauf los, und der grosse Haufe war Abends zum Erstaunen der ganzen Familie fertig, denn man hätte mir das gar nicht zugemuthet, dass ich soviel in einem Tag fertig bringen könnte. […] An Essen und Trinken wurde ich an diesem Tage behandelt wie während meiner Probewochen. Am nächsten Morgen hatte ich meine Kleider bald zusammen geschnürt und nahm endlich herzlichen Abschied, das heisst, ich verabschiedete mich herzlich Gern. Als ich Stäfa im Rücken hatte, fühlte ich wieder wie der Vogel in der Luft, und ich erreichte mein Vaterhaus bald [am] Nachmittag.»67
Auf dem Ussbühl folgte eine schwierige Zeit, in der, so Lienhard, der Hausfriede nicht der beste war. Immer wieder versuchte er, dem Vater die Erlaubnis für die geplante Amerikareise abzuringen, denn ohne den väterlichen Segen wollte er das Elternhaus nicht verlassen. Aber der enttäuschte Vater, der seinem Sohn beim Abbruch der Lehre geholfen hatte im Glauben, dieser kehre nun endgültig nach Hause zurück, weigerte sich beharrlich, sein Einverständnis zu geben. Die alten Grundsatzdiskussionen nahmen ihren Fortgang, und das Reizwort «Amerika» gab Anlass zu vielen harten Auseinandersetzungen. Warum der Vater ihn nicht ziehen lassen wollte, war für Heinrich schwer zu verstehen: «Obschon ich entschieden der Ansicht war, dass mein Vater unter seinen Kindern mich damahls am wenigsten liebte (und dieser Ansicht bin ich jetzt noch), so glaube ich, dass er mich, gerade weil er mich doch auch lieb hatte, nicht so weit weg von ihm und der Heimath wissen wollte. Der Gedanke, was aus mir werden sollte, wenn ich unter fremden Leuten krank würde, schien ihn sehr zu quälen, und dass ich seinen derartigen Gedanken nicht gehörig Rechnung trug, schien ihm fast Räthselhaft.»68
Auch spontane Einfälle brachten nicht den gewünschten Erfolg: «Unseren fortwährenden desshalbigen Verdriesslichkeiten müde, meinte ich einst, den Vater damit zu erschrecken und vielleicht gefügiger für meine Amerika-Pläne zu machen, als ich drohte, wenn ich nicht nach Amerika könne, so werde ich heirathen. Aber das war dem Vater eben gerade Wasser auf die Mühle, denn sogleich war er damit einverstanden: ‹Thue das›, sagte er, ‹das ist das Gescheidteste, was Du thun kannst!› Ich sah mein Irrthum sogleich ein und erwiederte ihm, dass ich dazu noch viel zu Jung sei.»69
Dann kam ihm eines Tages unerwartet ein Bruder des Vaters zu Hilfe: «Nachdem Unkel Peter sich zu uns gesetzt und er einige Worte mit uns gesprochen hatte, wandte er sich plötzlich zum Vater mit der Bemerkung: ‹Bruder, Du zankst Dich immer mit deinem Jungen, nur weil er nach Amerika will. Lass ihm doch sein Willen, und lass ihn gehen! Wenn etwas Ordentliches aus ihm wirdt, wenn er einmahl Dort ist, so sollst Du darüber Froh sein; sollte er aber ein Daugenichts werden, so sei Du zufrieden, dass er so weit von Dir fort ist! Er hat eine gelehrige Hand, er wird wohl wie andere junge Leute dort auch sein Auskommen finden. Bruder Jakob und ich, wir Beide haben je ein Sohn in Amerika, und wir sind es zufrieden. Warum willst Du es denn deinem Heinrich absolut verwehren?›»70 Die Übermacht von Bruder und Sohn scheint Kaspar Lienhard für einen Moment aus der Fassung gebracht zu haben, denn «halb Drotzig, halb Unwillig» wandte er sich an Heinrich mit den Worten: «Nun, wenn Du absolut nach Amerika willst, so gehe in Gottesnamen! Wenn es Dir dort gut geht, so bin ich auch damit zufrieden!»71
Reise nach Amerika 1843
Nach den erlösenden Worten des Vaters wollte Heinrich Lienhard keine Zeit mehr verlieren. Er wusste, dass sein Nachbar Jakob Aebli schon lange auf einen Begleiter wartete, mit dem er nach Neu-Schweizerland72 in Illinois reisen könnte, wo Verwandte von ihm lebten. Unverzüglich überbrachte ihm Heinrich nun die gute Nachricht, dass sein Reisepartner gefunden sei. Gemeinsam legten sie das Abreisedatum auf den 24. August 1843 fest und begannen mit den Reisevorbereitungen. Aeblis Bruder war in einer Advokatur tätig und organisierte ihre Fahrt bis Le Havre durch die Agentur Rufli in Sisseln, Kanton Aargau. Später sollte sich zeigen, dass dies nicht nötig gewesen wäre: «Ich war damahls wie die meisten Erstlinge oder Grünlinge in solchen Dingen noch sehr Unerfahren. So viel fanden wir indessen spähter heraus, dass wir die Reise von [zu] Hause nach Havre vollkommen so billig und in viel kürzerer Zeit per Post auf viel angenehmere Art hätten machen können.»72
Die bevorstehende Reise von über zwei Monaten erforderte gute Planung, umso mehr, als sie sich bis nach Le Havre selbst verpflegen wollten und dies auf der Atlantik-Überfahrt von Zwischendeck-Passagieren ohnehin erwartet wurde. «Diese Ausrüstung, wenn sie nach damahliger Idee einigermassen für den Schiffsraum und [die] selbst Verköstigung hinreichend sein sollte, verlangte von 30 bis 60 Pfund Käse, dürre Zwetschgen und dito Kirschen von [zu] Hause aus. Der Käse wurde dann an der Französischen Grenze versiegelt (blumbirt); solch versiegelter Käse durfte erst auf dem Meer angeschnitten werden. Für Federbetten auf dem Meere hatte Jeder auch selbst zu sorgen, dann noch eine küpferne Kochpfanne durfte nicht fehlen. Zwei bis vier vollständige Kleideranzüge, ein bis zwei oder Mehr Dutzend Hemden, ein oder zwei Dutzend Nastücher und wo möglich dito baumwollene und wollene Strümpfe nebst einer Flinte und einer Pistole und vielleicht eine Büchse, um sogleich den vielen Hirschen, Bären, Pänter und Büffel nach Ankunft in Amerika den Gar ausmachen74 zu können, waren durchaus als Nöthig angesehen.»75 Für den Transport liessen sie sich jeder einen grossen, mit Metallbeschlägen verstärkten Überseekoffer anfertigen und mit gelber Farbe ihren Namen darauf malen.
Zwei Wochen vor der Abreise begaben sie sich nach Glarus auf die Kanzlei, um ihre Pässe abzuholen. Lienhards «Reise-Pass» datiert vom 10. August 1843, und das «Signalement des Tragers» lautet wie folgt: «Alter: 21 Jahre; Grösse: 5 Fuss 8 Zoll; Haare: dunkelbraun; Augenbrauen: item; Stirne: gewöhnlich; Augen: hellbraun; Nase, Mund: mittler; Kinn: rund; Gesicht: oval; Besondere Kennzeichen: keine.»76 Nachdem sie das lang ersehnte Reisedokument sicher in ihrer Tasche wussten, mischte sich auf dem Nachhauseweg sogar ein wenig Wehmut in ihre Vorfreude: «Auf dem Rückweg von Glarus über Mollis nach Hause besahen wir noch unsere romantischen Glarnerberge. Da erhoben sie sich so Majestätisch, und doch sahen sie so friedlich aus an diesem freundlichen, sonnigen Augusttag. ‹Werden wir diese herrlichen Berge wieder sehen?›, fragten wir uns, ‹es ist halt doch schön hier!›»77
Am 24. August fiel der Abschied vom Vater so versöhnlich aus, wie Heinrich es sich immer gewünscht hatte: «Während meine Brüder Peter und Kaspar meine Reisekuffer hinten auf das Chaisechen78 für mich befestigten, waren mein Vater und ich noch allein im Hause. Wir tranken etwas Wein zusammen und vergaben uns jeden Fehler, welchen wir gegen einander begangen haben mochten. Plötzlich sagte der Vater zu mir: ‹Heinrich, bleibe hier! Ich will Dir gern alle Auslagen ersetzen, wenn Du hier bleibst.› Daran erkannte ich deutlich genug, dass der Vater mich doch noch lieb hatte, woran ich früher so oft zweifelte. Freilich konnte ich seinem Wunsche nicht entsprechen, denn ich sagte ihm, dass, wenn ich auch wirklich wollte, so dürfte ich mich so etwas nicht unterstehen, indem man mich für immer verhönen würde. Jetzt war Unten alles fertig, der Vater wollte mich noch bis Lachen begleiten. Aber aus dem Väterlichen Hause, in welchem ich das Licht der Welt zum Erstenmahl erblickte, in welchem ich meine Kindheit durchlebt und gross geworden durch die gütige Pflege und Vorsorge meiner Eltern, besonders meiner nun modernden, unvergesslichen Mutter, deren Augen ich zudrückte – es that mir doch Wehe, ich mochte mich dagegen wehren, wie ich wollte.»79
In Lachen stiegen die beiden jungen Männer mit ihren Angehörigen zu einem letzten gemeinsamen Mittagessen im Gasthof Zum Bären ab. Später begaben sie sich zum Landungssteg, wo das Botenschiff nach Zürich wartete, und nahmen Abschied. «Der Vater blieb noch längere Zeit an der Landung stehen», erinnert sich Lienhard, «wahrscheinlich glaubte er, mich zum Letztenmahl gesehen zu haben. Ich schwenkte ihm noch manchmahl mein Nastuch, bis auch er endlich den Platz verliess.»80
Nach einer unruhigen Nacht auf Heu und Stroh war Lienhard frühmorgens der Erste, der das unbequeme Lager verliess. Selbst die vielen Flohbisse der vergangenen Nacht vermochten seine frohe Aufbruchstimmung nun nicht mehr zu trüben. In Zürich angekommen, besorgte er sich er sich ein deutsch-englisches Wörterbuch, während sich Aebli auf die Suche nach einem Transportmittel für ihre Weiterfahrt Richtung Basel machte, mit gutem Erfolg: Beim Landeplatz der Frachtkähne erklärte sich einer der Bootsleute bereit, ihn und seinen Reisegefährten – als einzige Passagiere – für wenig Geld bis nach Laufenburg mitzunehmen. Ihr Gepäck sowie «einige schwere Stücker Roheisen und eine Anzahl fetter Kälber für die Bäder in Baden»81 wurden eingeladen, dann ging es auf dem langen, spitzen Kahn in schneller Fahrt via Limmat, Aare und Rhein flussabwärts. Am Abend machte man bei einem Gasthof Halt für die Nacht: «In dem Wirtshaus fanden wir noch ganz unerwartet einen unserer nächsten Nachbarn, Friedolin Streif, welcher mit Schabzieger handelte und am nächsten Tag nach Zurzach wollte, welches unweit von Da zwischen der Aare und dem Rhein liegen soll. Durch Streif sandten wir unsern Verwandten noch einmahl Grüsse heim.»82 Am Nachmittag des 26. August erreichten sie Laufenburg, von wo sie mit einem Fuhrwerk nach Sisseln gelangten.
Hier wartete bereits ein junger Mann von Ruflis Reisegruppe: «Wir fanden bei unserer Ankunft nur ein einziger Passagir von St. Gallen namens Jakob Behler, welcher wie wir Highland83 als das Endziel seiner Reise nach Amerika betrachtete. Behler hatte die selbe Broschüre von Salomon Köpfli über Neu Helvetia84 gelesen wie wir, und seine zwei Brüder und er wurden dadurch ebenso sehr wie Aebli und ich für das neue gelobte Land begeistert, als welches wir Highland dieser Beschreibung gemäss halten mussten. Wir betrachteten uns, als wären wir schon alte Bekannten, und hatten, soviel ich mich erinnere, keine Ursache, späther diese Bekanntschaft bereuen zu müssen.»85
In den folgenden Tagen trafen nach und nach weitere Reisende ein, vor allem Leute aus den Aargauer Gemeinden Küttigen, Erlinsbach und Frick, darunter viele Familien mit Kindern. Als Transportmittel für die Reise nach Le Havre dienten zwei grosse, breite gedeckte Wagen, in denen Bänke angebracht waren und die von je vier bis fünf starken Pferden gezogen wurden. Lienhard und Aebli waren der Ansicht, dass die beiden Wagen überladen seien, besonders nachdem sich ihnen vor Basel noch eine Gruppe von etwa zehn Berner Emigranten angeschlossen hatte.
Am 31. August passierten sie die Grenze bei St. Louis, danach ging die Reise langsam, aber stetig in nordwestlicher Richtung quer durch Frankreich: «Nancy ist eine schöne Stadt in einer herrlichen, mit Wein bebauten Gegend noch im Lotringischen. Wir hielten uns aber nur so lange auf, als nöthig war, das Mittagessen einzunehmen. Chalons ist eine grosse und schöne Stadt, Paris liessen wir zu unserer Linken ligen. Rouen erreichten wir Nachmittags zirca um Vieruhr; es nahm uns zwei volle Stunden, bis wier diese Stadt passiert hatten. Nachher bezogen wir wieder in einem grossen Pferdestall unser Nachtquartier86. Rouen ligt an der Seine, es kommen schon kleinere Seeschiffe bis dahin. Die Landung sieht einem Seehaven ähnlich, und man riecht schon den Teer, sieht grosse Taue, Anker, Matrosen – überhaupt war da viel Leben und geschäftiges Treiben.»87 Lienhard gehörte zu den jungen Leuten, die bei dem fast ausnahmslos schönen Sommerwetter einen guten Teil der Strecke zu Fuss zurücklegten, und wenigstens darin sah er einen Vorteil gegenüber der Beförderung mit der Postkutsche: «Auf diese Art, wie wir reisten, hatten wir natürlich gute Gelegenheit, Frankreich, soweit wir kamen, besser zu besehen, und ich war entzükt über die grössten Theils schönen, gutbebauten, fruchtbaren Gegenden.»88
Nach zweiwöchiger Reise näherten sie sich ihrem ersten grossen Etappenziel: «Sonntag, den 14. Sept. kamen wir plötzlich auf einer Anhöhe an, von wo aus wir zum Erstenmahl das Meer erblickten. Es war eine prächtige Aussicht, die See glänzte wie ein Silberspiegel und erweckte in uns Gefühle eigener Art.»89 Wenig später erreichten sie die Stadt Le Havre. Als sie dort beim letzten Essen mit Rufli in einem Gasthaus sassen, trat ein Mann auf sie zu und erkundigte sich, ob es unter ihnen Glarner gebe. Er stellte sich selbst als Glarner namens Legler vor und anerbot sich, Leuten aus seinem Heimatkanton bis zur Abfahrt des Schiffes zu helfen, da er sich in Le Havre gut auskenne und einige Tage Zeit habe. Aebli und Lienhard nahmen das Angebot dankbar an und trennten sich von der Rufli-Gruppe.
Legler brachte sie zuerst in einem besseren Gasthof unter und begleitete sie in den folgenden Tagen bei ihren Besorgungen. Als Erstes kauften sie sich ihre Schiffspassage auf dem amerikanischen Segelschiff «Narragansett»90. Dann besorgten sie sich das noch fehlende Geschirr und Bettzeug sowie zusätzliche Essensvorräte für die mehrwöchige Seereise. Am 18. September mussten sich die Schiffspassagiere an Bord einfinden, und in Lienhards Pass vermerkte der Commissaire de Police Délégué neben dem Polizeistempel: «Vue pour La Nouvelle Orléans sur Le Navire Le Narraganset. Havre Le 18 Sep. 1843.»
Die Wahl des neuen, dreimastigen Segelschiffes sollte sich als Glücksfall erweisen, strenge Regeln an Bord sorgten für Ordnung und Hygiene und machten den Schiffsalltag auch für die gut achtzig Passagiere des Zwischendecks erträglich. Mehr als fünfzig von ihnen waren Schweizer, denn auch Rufli hatte für seine Gruppe Passage auf der «Narragansett» gebucht. Am 20. September meldete das Journal du Havre, die «Narragansett» habe den Zoll passiert und stehe kurz vor dem Auslaufen. Am folgenden Tag ist das Schiff auf der Liste der «sorties» aufgeführt.91
Auf offener See wurden Aebli und Lienhard wie die meisten Mitreisenden zuerst seekrank. Danach verlief die Reise ohne Zwischenfälle – mit einer Ausnahme, und diese hätte für Heinrich Lienhard ein böses Ende nehmen können. Aebli und er wollten sich eines Tages mittels einer Pumpe, die ausserhalb des Schiffbugs befestigt war, mit Meerwasser waschen. Lienhard stieg als Erster hinunter, stellte sich unter die Pumpenröhre und hielt sich mit der linken Hand an einem Tau fest; dann rief er Aebli zu, langsam mit Pumpen zu beginnen. Da stürzte das Wasser mit solcher Wucht auf ihn nieder, dass er vor Schreck seinen Halt fahren liess und nur noch reflexartig mit der andern Hand das Tau wieder packen konnte. Es stellte sich heraus, dass oben ein irischer Matrose Aebli von der Pumpe weggedrängt hatte, um diese sogleich mit aller Kraft selbst zu betätigen. Der Schock blieb Lienhard zeitlebens in Erinnerung: «Die See war allerdings ganz ruhig und fast spiegelglat, aber da ich nicht Schwimmen konnte, weiss ich doch nicht, wie es mir ergangen, wäre ich hinab gestürzt.»92
Als sie sich nach der Atlantiküberquerung der Karibik näherten, griff der Kapitän immer öfter zum Fernrohr, und eines Tages ertönte endlich der Ruf: «Land in Sicht!» Langsam tauchte am Horizont die östliche Spitze der Insel Hispaniola auf, doch zu Lienhards Bedauern passierten sie diese in grosser Entfernung. Heinrich Lienhard war von der ersten Seereise an ein begeisterter Schiffspassagier. Bei all seinen Schiffsreisen zählte er am Morgen stets zu den Ersten, die an der Reling standen, und abends zu den Letzten, die ihre Schlafstelle aufsuchten. Und wenn der Mond hell genug schien, verbrachte er, in eine Wolldecke gehüllt, oft die ganze Nacht auf Deck, um nichts zu verpassen. Er liebte es, im Vorbeiziehen die Küsten und Inseln zu betrachten, und immer wieder beobachtete er fasziniert die vielen Tiere in Luft und Wasser, die in der Nähe von Land das Schiff lange begleiteten.
Im Golf von Mexiko erwartete sie stürmisches Wetter. Während mehrerer Tage lavierte die «Narragansett» in den Wellen, und der Kapitän bemühte sich, nicht zu weit nach Westen zu geraten, wo nach seinen Worten Gefahr bestand, auf eine Sandbank aufzulaufen. Als sich die See endlich beruhigte und das Wasser seine dunkle Farbe verlor, dauerte es nicht lange, bis sich ihnen ein kleines Lotsendampfboot näherte. Die Besatzung der «Narragansett» zog die Segel ein, befestigte ein dickes Tau an der «Black Star», und diese schleppte nun das grosse, dreimastige Segelschiff zur Mündung des Mississippi River. Dort kam ein Arzt an Bord, der die Gesundheitskontrolle vornahm. Auf der «Narragansett» musste er weder Kranke noch Tote registrieren, sondern konnte sogar einen zusätzlichen Passagier verzeichnen: Während der Umrundung der Ostspitze Kubas (Kap Antonio) war nämlich ein kleiner Antonio zur Welt gekommen, Sohn eines jungen Paares aus dem süddeutschen Baden. Somit hatte die Seereise nach 47 Tagen ein glückliches Ende gefunden, und nach einer weiteren Schleppfahrt mit der «Black Star» erreichten sie zwei Tage später den Hafen von New Orleans.93
Während fast alle Franzosen in New Orleans zurückblieben, hielten sich die Schweizer und Deutschen nur kurz in der Stadt auf, um sich dann an Bord des Dampfers «Meridian» zu begeben. Zehn Tage dauerte die Fahrt flussaufwärts bis nach St. Louis, Missouri. Um von hier nach Neu-Schweizerland zu gelangen, setzte man mit einer Fähre auf die Illinois-Seite des Mississippi über, danach blieben noch knapp dreissig Meilen94 zu Fuss oder mit einem privaten Fuhrwerk landeinwärts zu bewältigen. Reisende nach Highland warteten in St. Louis mit Vorteil im «Switzerland Boarding House», wo Farmer von Highland jeweils vorbeischauten, wenn sie ihre Produkte nach St. Louis brachten. Es dauerte denn auch nicht lange, bis zwei Schweizer aus der Siedlung erschienen und sich bereit erklärten, die neu eingetroffenen Landsleute und ihre schweren Koffer mitzunehmen.
Da sie die Strecke nach Highland in zwei Etappen zurücklegen wollten, machten sie gegen Abend Halt in einem Wäldchen. Sie bereiteten sich auf eine ungemütliche Nacht vor, denn im Wagen gab es keinen Platz zum Schlafen, der Erdboden war feucht, und es fing auch noch zu regnen an. Sie holten ihre Regenschirme hervor und versuchten, sich an einem Feuer zu wärmen, wobei einer der Farmer namens Buchmann einen Krug mit Whisky zirkulieren liess. Dann begann er von den Männern, Frauen und Kindern zu erzählen, die auf ihrer langen Reise über den amerikanischen Kontinent während Monaten noch viel härtere Strapazen auf sich nahmen, um im Fernen Westen eine neue Heimat zu suchen: «Er erzählte mir, wie die Emigranten über die Ebenen und Felsengebirge nach Oregon und Californien fünf bis sechs Monate lang mit Ochsen- und Mauleselfuhrwerken auskampieren müssten, wie sie sich mit Lebensmittel, Zelten, Gewehren und Waffen versahen, wie sie verschiedenen Indianern begegneten, von den Buffalos, Antilopen, Hirschen u.s.f. Er sagte, dass schon seid zwei bis drei Jahren im Frühjahr sich Leute in wo möglich grössern Gesellschaften zusammen fänden, und noch mehr verschiedene Einzelnheiten über jene geheimnissvollen Regionen.»95
Farmer Buchmann hätte sich keinen aufmerksameren Zuhörer wünschen können als Heinrich Lienhard. Das Wort»California» muss diesen wie ein Blitz getroffen haben, denn es liess ihn in den folgenden Jahren nicht mehr los. «Ich war also noch nicht an dem Endziele meiner Reise angekommen», erinnert er sich, «und doch empfand ich bereits Lust, vielleicht bald eben dieselbe Reise zu wagen.»96
Erste Jahre in Amerika: Illinois 1843–1846
Heinrich Lienhard und Jakob Aebli erreichten Neu-Schweizerland um den 20. November 1843 und wurden von Aeblis Verwandten, Familie Schneider, freundlich aufgenommen. Lienhard verbrachte zwei Wochen bei ihnen und benutzte die Zeit, um sich eine Arbeit zu suchen. Seine erste Stelle fand er bei einem Solothurner namens Mollet, der ihm als Lohn für den Anfang zwar nur Kost und Logis anbot, ihm später aber, wenn er sehe, dass Lienhard es verdiene, auch einen Lohn bezahlen wollte.97 Mollet arbeitete neben seinem Beruf als Wagenmacher auch als Zimmermann, und Lienhard freute sich auf die neue Herausforderung, zumal Mollets Frau Amerikanerin war und er deshalb hoffte, rasch mit der englischen Sprache vertraut zu werden.
Die kommenden Wochen erwiesen sich als schwieriger Anfang in der neuen Heimat. Der strenge Arbeitstag begann früh am Morgen, lange vor dem Frühstück, und hätte nach des Meisters Vorstellung bis abends um neun Uhr gedauert. Das Essen war eintönig und ungesund; es bestand aus «stark ausgebratenem und dabei sehr gesalzenem Speck, Kornbrod, ohne Salz und Fett bereitet, und dabei schlechten Weizencaffee mit allerhöchstens zehn Tropfen Milch auf die Tasse, so dass man kaum eine Verenderung der schwarzen Kaffeefarbe zu sehen vermochte.»98 Als Ersatz für Fett und Salz wurde das Maisbrot mit dem «ausgeschmolzenen Fett des verbratenen Specks» begossen.99 Diese Mahlzeit kam dreimal täglich an sieben Tagen pro Woche auf den Tisch, «so Regelmässig, als ob ein strenges Gesetz irgend etwas Anderes verböte».100
Lienhard bekam Magenschmerzen, fühlte sich schlecht behandelt, war unglücklich und enttäuscht. Nach zwei Monaten bei Mollet fand er, dass er nun zwar die «Schattenseite» von Neu-Schweizerland kenne, aber noch nichts von der «Sonnenseite» bemerkt habe.101 Als er den Meister eines Tages bei einer groben Tierquälerei beobachtete und vergeblich versuchte, ihn davon abzuhalten, verliess er dessen Haus für immer.
Die Monate Februar und März 1844 verbrachte Heinrich Lienhard bei Familie Leder102, mit deren Sohn Jacob er sich befreundet hatte. Der Vater, Johann (John) Leder, war als «Rigi-Leder» bekannt, da er am Nordhang eines «Rigi» genannten Hügels eine Farm besass. Hier fühlte sich Lienhard bald heimisch, umso mehr, als Vater Leder Klarinette und Trompete spielte und in seinem Haus am Abend oft musiziert und getanzt wurde.103 Allerdings arbeitete Lienhard auch bei Leders wieder ohne Lohn, und das bescheidene Vermögen, mit dem er nach Amerika aufgebrochen war, nahm langsam, aber stetig ab104: «Ich war jetzt nahe an zwei Monate bei Leders gewesen, und obschon ich mit den Leuten zufrieden war, sagte mir mein gesunder Verstand, dass ich auf diese Art nicht bestehen konnte. Bis dahin war ich Sonntags wie andere meiner Freunde dann und wann in das Wirthshaus gegangen und hatte auch ein paar Bällen beigewohnt, wobei ich immer etwas Geld brauchte, dagegen noch keines verdient hatte. Mit bedauren betrachtete ich da meine 20-Franken-Stücker, wenn ich eines davon aus meinem Gurt trennte, welchen ich immer am Körper trug. Ich kam mir fast als ein Vergeuder vor, und doch war ich eigentlich durchaus kein solcher.»105
Lienhard fand, dass (Salomon) Köpfli die Verhältnisse in der Siedlung «viel zu paradisisch»106 beschrieben habe und dass auch in den Briefen der Familie Schneider an ihre Verwandten zu Hause alles viel vorteilhafter dargestellt worden sei, als es sich in der Realität erweise. Es herrschte zwar kein Mangel an Lebensmitteln, doch zirkulierte sehr wenig Geld, so dass ein einfacher Farmgehilfe im günstigsten Fall mit einem Lohn von sechs bis sieben Dollar pro Monat rechnen konnte – und nicht selten fehlte den Farmern sogar noch diese kleine Summe Bargeld. Lienhard spielte zu dieser Zeit mit dem Gedanken, nach Le Havre zurückzukehren, Französisch zu lernen und dann nach Brasilien auszuwandern. Indessen sollten sich auch in Highland die Dinge bald zum Besseren wenden.
Nachdem er sich entschlossen hatte, nur noch bezahlte Arbeit anzunehmen, blieb ihm die Wahl zwischen den Brüdern Ambühl aus dem Kanton Graubünden107 und dem Berner Jakob Schütz108. Die Ambühls waren als «tüchtige, aber sehr hart arbeitende Farmer» bekannt, «welche viel Land besässen, für damahlige Zeiten gute Löhne bezahlten, aber auch bis in alle Nacht hinein Arbeiteten».109 Jakob Schütz, so hiess es, zahle zwar keinen grossen Lohn, dafür behandle er einen anständigen Arbeiter eher wie einen Sohn als einen Knecht, und «da das Wort ‹Knecht› auf mich ein widerlicher Eindruck machte und da ich in der Farmerei nämlich die Behandlung der Pferde, Pflügen etc. noch erst zu lernen hatte, entschloss ich mich sogleich, zuerst bei Schütz anzufragen.»110
Lienhard hatte Jakob Schütz bald nach seiner Ankunft in Neu-Schweizerland einmal getroffen, als er wie Schütz und andere Siedler zu gemeinnützigen Strassenarbeiten aufgeboten worden war.111 Man hatte ihm einen schweren Zweizollbohrer in die Hand gedrückt, mit dem er über längere Zeit arbeitete, dann aber ermüdete und begann, zwischendurch kurze Verschnaufpausen einzuschalten. Dem Strassenmeister Jacob Durer112, Wirt des Hotels Helvetia in Highland, missfiel dies offensichtlich, denn er forderte ihn jedesmal sogleich zum Weiterarbeiten auf. Dabei unterschätzte er aber das Temperament seines jungen Landsmannes: «Einige Mahl liess ich es mir gefallen», so Lienhard, «doch da ich fand, dass er mich zu seinem besondern Ziele auserlesen zu haben schien, erlaubte ich mir, ihm zu sagen, dass, wenn ihm meine Arbeit nicht genügend sei, werde ich ganz aufhören; dass ich mehr gethan habe als er selbst und so viel als irgend einer der Anwesenden [und] dass es mir vorkomme, man sei sehr hungrig, weil man Leute, welche kein Land besitzen und kaum angekommen seien, sogleich zu Straassenarbeiten auffordere.»113 Lienhards Ton schien Durer und seinem Kollegen Joseph Suppiger, einem Mitbegründer Neu-Schweizerlands, noch weniger zu gefallen; ein Wort gab das andere, und es entbrannte ein heftiger Streit, in dessen Verlauf Lienhard drauf und dran war, den grossen Bohrer hinzuwerfen.
In diesem Moment trat Jakob Schütz dazwischen: «Der kleine Mann, welcher bis dahin zugehört hatte, erhob sich nun ebenfalls, und ich glaubte, am Ende würde er auch noch gegen mich auftretten. Aber ich traute meinen Ohren kaum, als ich ihn sagen hörte, dass es ein rechter Unverstand sei zu verlangen, weil ich ein fetter junger Mann sei, dass ich mich nicht ein wenig ausruhen dürfe, nachdem ich bereits mit dem Zweizollborer so lange im Eichenholz gebohrt habe. Sie sollen es selbst einmal versuchen, damit werden sie bald genug ausfinden, ob sie ruhen möchten oder nicht. Auf die beiden grossmauligen Herren Squire114 Supiger und Helvetia Hotel Wirth Turer wirkten diese wenigen Worte des schlichten Farmers Jakob Schütz eigenthümlich beruhigend, denn sie hielten ihre Schimpfmäuler sogleich ruhig und hatten nachher durchaus nichts mehr gegen meine Arbeit einzuwenden. Was mich anbelangte, hätte ich den Schütz um den Hals fassen und Küssen mögen, weil er der Einzige war, der das Herz hatte, den grossmäuligen Herren die Wahrheit zu sagen. Natürlich fand dieser Mann ein warmer Platz in meinem Herzen. Ich ahnte aber damahls noch nicht, dass ich diesen Mann noch mehr lieb und werth schetzen lernen sollte.»115
Schütz erklärte sich einverstanden, Lienhard auf seiner Farm anzustellen. Als Lohn versprach er ihm viereinhalb Dollar im ersten Monat, danach, wenn er mit ihm zufrieden sei, fünf Dollar pro Monat. Sein Arbeitsbeginn wurde auf den 15. März 1844 festgesetzt, ein Tag, dem Lienhard mit Bangen entgegensah. Er hatte in den vergangenen Monaten ohne Lohn so viel gearbeitet, dass er sich nun fragte, was man künftig wohl für bezahlte Arbeit von ihm verlangen werde. «Am Abend des 14. Tag Merz fuhr mich mein Freund sammt meinem Gepäck hinüber zu Jakob Schütz. Während ich auf dem Wagen sass, regte sich in mir ein Gefühl, gleich als gienge ich nun dirreckt in die Sklaverei, und jedenfalls fühlte ich mich sehr erniedrigt.»116
Als er am nächsten Morgen erwachte, sprang er schnell aus dem Bett, denn obwohl es noch dunkel war, befürchtete er, verschlafen zu haben. Schütz, der im gleichen Raum schlief, erwachte und fragte ihn erstaunt, was er denn so früh anfangen wolle. «Ich antwortete, ich wolle das Vieh und die Pferde füttern, allein Schütz lachte darüber, hiess mich nur wieder zu Bette gehen, es sei Zeit genug zum Aufstehen mit dem Sonnenaufgang. Ich hätte nach dem wohl noch zwei volle Stunden schlafen dürfen, allein ich fürchtete, er möchte dann am Ende aufstehen und an die Arbeit gehen, während ich mich dann verschlafen könnte, daher zog ich vor, wach zu bleiben. Ich hatte mich jedoch in der Zukunft bald so gewöhnt, dass ich fast regelmässig mit Sonnenaufgang erwachte, und ich kann mich nicht erinnern, dass mir Schütz je zum Aufstehen gerufen hatte.»117
Mit Jakob Schütz hatte Heinrich Lienhard in Neu-Schweizerland das grosse Los gezogen. Sein Meister war ein verständnisvoller, freundlicher Mann Mitte fünfzig, der ihn, wie man es ihm vorausgesagt hatte, nicht nur gut, sondern wie ein Familienmitglied behandelte. Schütz war als guter Farmer bekannt und besass einige Meilen südwestlich der Stadt Highland eine eigene grosse Farm mit gutem Waldland. Er hatte diese aber, als Lienhard zu ihm kam, noch verpachtet und bewirtschaftete die sogenannte Ruef-Farm118 eine Meile westlich der Stadt Highland. Schütz fütterte und behandelte seine Tiere gut, weshalb sie zu den besseren der Gegend gehörten. Er kannte sich auch mit Tierkrankheiten aus, wurde oft von Farmern in den Stall gerufen und half immer, wenn es möglich war, obwohl ihn nicht alle dafür bezahlen konnten. «Der Charakter von Schütz war aufrichtig», schreibt Lienhard, «Personen, welche mit Lügen umgiengen, Schmeichler, Wucherer, Betrüger und hochmüthige, falsche Personen überhaupt, verachtete er. Armen, dürftigen Personen half er gern, soviel es seine Mittel ihm erlaubten, und wurde irgend Jemand von Andern Hart oder Ungerecht behandelt, konnte er sicher sein, in Schütz einen Beschützer und Freund zu finden.»119
Karte von «Highland oder Neu Schweizerland» und Umgebung von 1847 (Ausschnitt) mit den Namen der Siedler, unter anderen westlich der Stadt Ruefs Farm («Ruff»), die Jacob Schütz 1843 noch bewirtschaftete,
südwestlich davon dessen eigene Farm und im Südosten Seneca Gales Farm. Nördlich der Stadt die Farmen der Gebrüder Ambühl.
Schütz war seit einigen Jahren mit der verwitweten Tochter eines Schweizer Farmers verheiratet,120 eine Verbindung mit einer besonderen Geschichte. Die Frau hatte vier oder fünf Monate nach der Hochzeit eine Tochter geboren, worauf Schütz, der sich getäuscht und betrogen fühlte, sie aus dem Haus weisen wollte. Erst jetzt erfuhr er von ihr, dass sie vor der Heirat mit einem anderen, mittellosen jungen Mann verlobt gewesen sei und diesen auch habe heiraten wollen. Ihr Vater habe sie aber, obwohl er von ihrer Schwangerschaft gewusst habe, gezwungen, ihren Verlobten aufzugeben und stattdessen den wohlhabenden Schütz zu heiraten. Nachdem seine Frau ihm alles erzählt hatte, gab Schütz ihrem Bitten nach, und sie durfte mit dem Sohn Fritz aus erster Ehe bei ihm bleiben. Lienhard erinnert sich, dass Schütz und seine Frau zwar getrennt, aber doch unter einem Dach und in gutem Einvernehmen lebten. Die kleine Tochter Maria allerdings wurde bei einer anderen Familie untergebracht.
Als Schütz im März 1844 einmal am Haus jener Familie vorbeiritt, sah er das kleine Mädchen spielen. Er ging zu ihm hin, sprach einige Worte mit ihm, worauf Maria so spontan und freundlich reagierte, dass sie sein Herz offenbar im Sturm eroberte und er beschloss, die Kleine in seinem Haus aufzunehmen. Als Lienhard mit Jacob Leder Anfang März bei Schütz um Arbeit nachgefragt hatte, war Maria erst ein oder zwei Tage bei ihm, und das Bild, das sich ihm und Jacob damals bot, blieb ihm unvergesslich: «Wir fanden das Kind fast beständig an der Hand des alten Schütz, der ihre vielen Fragen kaum alle beantworten konnte. Aber er sah Glücklich aus, musste oft lachen und freute sich offenbar, endlich ein Kind gefunden zu haben. Gleich als ob das kleine Mädchen das Unrecht ihrer Mutter an Schütz wieder gutmachen wollte, war es überall bereit und zur Hand, ihrem väterlichen Wohlthäter behülflich zu sein, und zeigte nicht die geringste Scheu oder Furcht vor fremden Menschen, weder vor Pferden oder Vieh, so dass der Anblick dieses kleinen, lebhaften Wesens besonders geeignet war, das Antlitz des Vater Schütz aufzuheitern.»121 Nur den Schwiegervater, bemerkt Lienhard, habe er in Schütz’ Haus nie angetroffen.
Heinrich Lienhard lernte viel auf der Farm, sowohl im Umgang mit Pferden, was ihm später in Kalifornien zugute kam, als auch in der Landwirtschaft. Eine neue Arbeit erklärte ihm Schütz jeweils kurz und überliess ihn dann bald sich selbst. Im April 1844 gingen sie eines Morgens zusammen auf ein grosses Maisfeld, auf dem Lienhard die Maisstengel bereits abgehackt und zerkleinert hatte, und Schütz zeigte ihm nun, wie er mit Pferd und Pflug umzugehen habe, um das Feld noch zu pflügen. Nach ein paar Runden fand Schütz, Lienhard werde jetzt schon allein zurechtkommen, und liess ihn verdutzt allein zurück. Sein erster Impuls war, alles stehen zu lassen und Schütz ins Haus zu folgen; er entschied sich dann aber, vorher wenigstens eine Runde zu versuchen. «Ich lenkte meine Pferde so gut es eben gieng, und es gieng natürlich schlecht genug, da ich meinte, ich könne meine Augen nicht zu gleicher Zeit auf die Pferde und den Pflug halten. Zudem wurde der Pflug anfangs jeden Augenblick durch die vielen sich zusammenstauenden Maisstengel aus der Furche gehoben. Da gab es dann eine schöne Wülerei: Haufen [von] Maisstengeln mit Grund vermischt, der Pflug oft fast bis an den Baum im Grunde oder im nächsten Augenblick ganz aus Demselben, und die Furchen (wenn sie überhaupt diesen Namen verdienten) bald rechts, bald links aus der Richtung. Mit Schweiss förmlich bedekt, hatte ich endlich die erste Runde gemacht, und fast glaubte ich, schon eine geringe Verbesserung wahrzunehmen. Die Zweite Runde folgte, und jetzt war ich überzeugt, dass es bereits besser gieng. Mit jeder Runde wurden die Furchen besser, und mit jeder Besserung wuchs mein Eifer und schwand meine Verzagtheit, und noch ehe man mir mit dem Horn zum Mittagessen blies, war ich zu der Ansicht gekommen, dass ich wahrscheinlich ebenso gut pflügen könne als fast jeder Andere, und das Pflügen war mir bald mehr zum Vergnügen als zu einer anstrengenden Beschäftigung geworden.»122
Dank Schütz fühlte sich Lienhard nach einem halben Jahr richtig wohl in Neu-Schweizerland: «Der Monat April war sehr schön und Angenehm, und ich fühlte mich beim Pflügen mit meinen zwei vortrefflichen Pferden so glücklich, wie ein junger Mensch mit gutem Gewissen [und] voll Hoffnung für die Zukunft nur kann. Ich wetteiferte mit den Lerchen des Feldes im Singen und Pfeifen und pflügte dabei drauflos, dass es eine wahre Freude war. Selbst die Pferde schienen meine Stimmung zu theilen, die ganze Natur war voll fröhlichen Lebens.»123 Schütz erklärte ihm eines Tages, dass er seine Pferde nicht so streng brauchen dürfe und dass die Tiere mittags wenigstens eine Stunde mehr Ruhezeit brauchten. Er solle nachmittags deshalb nicht vor zwei oder drei Uhr an die Arbeit zurückgehen. Erstaunt fragte ihn Lienhard, was er denn in der Zwischenzeit arbeiten solle, worauf Schütz lachend erwiderte, er könne tun, was ihm gefalle, nur zu arbeiten brauche er nicht.
Zu Beginn der Sommermonate begann in Highland regelmässig die gefürchtete Fieberzeit. Das Wechselfieber, eine Art von Malaria, war «eins der grössten Übel, die die Einwanderer zu ertragen hatten»,124 und es forderte Jahr für Jahr zahlreiche Todesopfer. Lienhard lernte das Fieber bereits im ersten Sommer in all seinen Varianten kennen. Über Tage und Wochen wechselten sich heftige Fieberschübe mit nicht minder heftigen Schüttelfrösten ab, und die starken Kopfschmerzen trieben ihn fast zur Verzweiflung. Fühlte er sich zwischendurch etwas besser, liess der nächste Rückfall bestimmt nicht lange auf sich warten. Es dauerte fast drei Monate, bis er wieder ganz gesund war. Schütz und seine Frau pflegten ihn über die ganze Zeit, weshalb er für die Sommermonate keinen Lohn annahm.
Im Spätherbst 1844 zog es Heinrich Lienhard fort von Neu-Schweizerland. Schütz bot ihm zwar an, den Winter als Gast bei ihm und seiner Familie zu verbringen, doch Lienhard wollte versuchen, in St. Louis eine Lehrstelle als Möbelschreiner, Sattler oder Koffermacher zu finden. In der Stadt angekommen, stellte er bald fest, dass viele andere junge Männer ebenfalls Arbeit suchten, darunter mehrere Landsleute, die wie er im Switzerland Boarding House logierten. Alle Stellen waren besetzt, und da wenig Geld im Umlauf war, gab es kaum eine Möglichkeit, zwischendurch etwas zu verdienen. Mit zwei anderen Schweizern unternahm er einmal den Versuch, neu eingetroffenes Treibholz zu Cordholz125 zu verarbeiten. Doch sie gaben bald wieder auf, denn das mit Wasser vollgesaugte Pappelholz liess sich, einmal zu Cordholzlänge verarbeitet, selbst mit ihren neu gekauften Äxten nicht spalten.
Schliesslich nahm Lienhard eine schlecht bezahlte Stelle bei einem schwäbischen Metzger namens Christ an. Dabei tröstete er sich mit dem Gedanken, dass es ihm in Zukunft vielleicht von Nutzen sein könnte, wenn er schlachten lernte. Er merkte aber bald, dass sich seine Erwartungen nicht erfüllen würden, denn Christs Hauptgeschäft bestand darin, in der nahen Schlachterei Abfälle wie Schweinsköpfe, Schweinsfüsse und Innereien abzuholen und daraus Würste herzustellen; diese Ware verkaufte er dann in einem Park. Als er Lienhard zum ersten Mal auf seine Tour mitnahm, um ihm alles zu zeigen, fuhren sie auf dem Rückweg durch ein Wäldchen, wo Christ ihn anwies, hier künftig bei jeder Fahrt Holz aufzuladen und mit dem Fuhrwerk nach Hause zu bringen. Lienhard fragte ihn darauf, ob das Holz ihm gehöre, was Christ verneinte und hinzufügte, die Besitzerin des Wäldchens sei eine reiche Witwe, die den Verlust nicht bemerke. Auf Lienhards Einwand, er werde kein Holz stehlen, befahl es ihm Christ in barschem Ton. Zu Hause angekommen, packte Lienhard entrüstet seine Sachen und zog am folgenden Morgen wieder ins Switzerland Boarding House. Er hatte nun einen Monat in St. Louis verbracht, war um einige unangenehme Erfahrungen reicher und um zehn Dollar ärmer. Er beschloss, die unbefriedigende Situation zu beenden, und fuhr bei der nächsten Gelegenheit nach Highland zurück.
Im Januar 1845 verpflichtete er sich für zwei Monate bei einem Farmer namens Gale, in der Hoffnung, bei einer amerikanischen Familie besser Englisch zu lernen. Seneca Gale offerierte ihm zwar nur zwei Dollar Lohn pro Monat, wollte ihm aber nach dem Abendessen regelmässig Englischunterricht erteilen. Gale hatte früher als Lehrer gearbeitet und war nach Lienhards Worten ein aufgeklärter und belesener Mann. Anfänglich unterrichtete Gale ihn selbst, dann übernahm mehr und mehr seine 23-jährige Tochter Mariet126 diese Aufgabe. Sowohl Mariet als ihr Vater versicherten Lienhard, dass er es, wenn er ein ganzes Jahr bei ihnen bliebe, in der englischen Sprache mit jedem Einwanderer in Neu-Schweizerland würde aufnehmen können.
Trotz strenger Arbeit auf der Farm fühlte sich Heinrich Lienhard bei den Gales so zufrieden, dass es ihn nicht einmal mehr am Sonntag zu seinen Freunden nach Highland zog. Oft erhielt die Familie Besuch von anderen jungen Männern, und es blieb ihm nicht verborgen, wem diese Aufmerksamkeit galt. Er sah es deshalb mit Genugtuung, dass Mariet keinen der Besucher besonders zuvorkommend behandelte: «Sie sagte mir dann auch selbst, was ich wahrgenommen zu haben glaubte, und wenn sie mich dann wegen meiner schöner Feuer lobte und [mir] zudem kleine Gefälligkeiten erwies, empfand ich immer mehr Zuneigung zu ihr, und diese Zuneigung ward, wie mir schien, erwiedert. Aber ich war damahls noch ein armer Kerl, und der Gedancke, mich mit einem Mädchen näher einzulassen, befor ich vollständig im Stande sein würde, eine Frau selbst zu erhalten, hielt mich von jeder zu grossen Zutraulichkeit ab, und ich blieb daher immer ein wenig Zurückhaltend.»127
Mr. Gale wollte Lienhard für den Sommer 1845 verpflichten und ihm pro Monat sechs Dollar bezahlen, ein guter Lohn für damalige Zeiten. Aber ein Berner namens Christian Wenger hatte Lienhard aus Galena128 geschrieben, dass man dort in den Bleiminen zehn bis zwanzig Dollar pro Monat verdienen könne. Gale äusserte sich zwar skeptisch über diese Nachricht und riet ihm von der Reise ab, doch Lienhards Neugier war stärker, auch wenn ihm die Entscheidung nicht leichtfiel: «Die Mariet hatte nicht gern, dass ich weggieng, und schien der Ansicht zu sein, dass ich nicht genug Anhänglichkeit besitze. Und ich gestehe, dass ich wirklich gar nicht gern von da wegging. Mir war es, als ob ich nicht ganz recht handle, von dieser Familie wegzuziehen, wo ich doch so gut behandelt wurde; ich wusste daher kaum, was ich thun sollte. Dachte ich aber wieder an die 10–12 Dollars per Monat anstatt der $ 6.–, so konnte ich doch in sechs Monaten viel mehr verdient haben als bei Highland, zudem konnte ich mehr von der Welt sehen. Obschon ungern, entschloss ich mich doch zum gehen und glaube, dass ich der Familie Gale, besonders der Mariet, damit Wehe gethan habe.»129
Anfang März 1845 fuhr Lienhard nach St. Louis und bestieg ein Dampfschiff nach Galena. Während dieser Fahrt flussaufwärts erblickte er zu seiner Rechten zum ersten Mal die Stadt Nauvoo, wo er sich gut zehn Jahre später, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, niederlassen und den Rest seines Lebens verbringen würde. Nauvoo war 1845 der grösste Ort in Illinois und hauptsächlich von Mormonen bewohnt. Ihr neuer Tempel stand kurz vor der Vollendung, und das prächtige Bauwerk erhob sich majestätisch über die Stadt und den Fluss.130
Das obere Mississippital, wo Lienhard 1845 unterwegs war.
In Galena angekommen, fand er zusammen mit Wenger und einem anderen Schweizer, dem Bündner Christian Theus, Arbeit bei zwei Grubenbesitzern, die gemeinsam ein Stück Land gepachtet hatten. Der eine war ein Engländer, der andere ein Schweizer namens Bühler, und ihre Gruben befanden sich einige Meilen ausserhalb der Stadt. Lienhard und Theus arbeiteten mit dem Engländer in einem Schacht, der bereits über zwanzig Meter tief war und in dem ein zweiter Querstollen vorgetrieben wurde. Als Arbeitsgeräte standen eine Winde, Bottich, Hammer, Bohrer und Sprengmaterial zur Verfügung. Während einer der beiden Gehilfen beim Grubeneingang die Winde betätigte, musste der andere unter Tag dem Engländer zur Hand gehen. Lienhard schauderte es, als er in das dunkle Loch hinunterblickte, und er war erleichtert, dass man ihm die Arbeit an der Winde zuwies: «Obwohl das Aufwinden der Unten gesprengten Felsensplitter [und] der arbeitenden Männer aus der 60 Fuss tiefen Grube einige Kraftanwendung verlangte, so hätte ich doch nicht mit dem Teuss tauschen mögen, welcher dem Engländer in der Grube zu helfen hatte.»131
Eines Tages fühlte sich Theus aber nicht wohl, und Lienhard musste für ihn einspringen. «Als ich Unten ankam, war mir Schwindlig, ich fiel gegen die Seite der Höhle, und mir war es, wie einem Betrunkenen sein muss, welcher bei finsterer Nacht gegen eine Steinmauer fällt. Ich wurde jedoch von meiner halben Treumerei durch die Worte des Engländers aufgeweckt, welcher mir zurief, in gebükter Stellung [mich] ihm zu nähern, da ich mir sonst mein Kopf an dem Felsen anschlagen würde. Ich blickte mich erst jetzt recht um und sah endlich der matte Schein eines Lichtes in einiger Entfernung. Halb kauernd näherte ich mich demselben; der Seitenschacht mochte vier bis vier und einhalb Fuss hoch und vielleicht ebenso weit sein. Der Engländer setzte jetzt den gestählten Steinborer an, und ich musste in äusserst unbequämer Stellung mit dem schweren Eisenhammer auf denselben losschlagen. War das geborte Loch tief genug, wurde sogleich geladen, und ich rief in die Höhe hinauf, dass Teuss mich hinauf ziehe. Ich stellte mich in den Zuber, erfasste das Seil und rief dann: ‹Auf!› Alsobald gieng es langsammen Tempos höher. Hatte ich halbwegs oben die alte Seitenhöle erreicht, schwang ich mich in dieselbe, liess Seil und Zuber los, welcher sofort wieder auf den Boden der Grube zurück gelassen wurde. Der Engländer war dann gewöhnlich bis dahin mit laden fertig, zündete die Schwefelschnur an, begab sich ebenfalls in den Bottich, nach Oben das Zeichen zum Aufziehen gebend, und bald befand er sich an meiner Seite. Es dauerte in der Regel nicht lange, so Donnerte es in der Tiefe, oft die Felsen um uns erschütternd, nach welchem für einige Minuten ein dichter Pulverrauch folgte. War dieser im Abnehmen, wurde zuerst der Engländer, dann ich wieder hinunter gelassen. Unten angekommen, räumten wier die losen Felsentrümmer hinweg, und der Mann an der Winde bekam wieder frische Arbeit.»132
Lienhard gefiel weder der Ort noch die Beschäftigung, und er fand auch den Lohn von zehn Dollar pro Monat für diese gefährliche Tätigkeit gering. Nach ein paar Wochen in «dieser einsammen, überall durchlöcherten Gegend»133 teilte er Wenger mit, dass er sich nach einer anderen Beschäftigung umsehen wolle. Wenger schien der Arbeit in der Grube auch überdrüssig zu sein, denn er machte seinen beiden Kameraden jetzt einen neuen Vorschlag. Sie könnten zu dritt, meinte er, in den Fichtenwäldern am Black River, einem weiter nördlich gelegenen Zufluss des Mississippi, Holz schlagen und es nach St. Louis flössen. Dies sei eine einträgliche Tätigkeit und würde bestimmt jedem von ihnen einen Gewinn von mehreren hundert Dollar bringen. Er versicherte, sich über alles genau erkundigt zu haben und gut Bescheid zu wissen, so dass Lienhard und Theus sich mit dem neuen Plan einverstanden erklärten. Der Engländer und Bühler liessen ihre drei Gehilfen bereitwillig ziehen, denn seit Lienhards Ankunft war kein einziges Pfund Blei zu Tage gefördert worden.
In den nächsten Tagen beschafften sich die Männer das nötige Werkzeug, versahen sich mit einem grossen Vorrat an Lebensmitteln und brachten alles auf das kleine Dampfboot «Otter», das damals die Verbindung zwischen Galena und Fort Snelling134 beim Zusammenfluss des Mississippi und Minnesota River aufrechterhielt. Zu Lienhards Erstaunen fuhr die «Otter» dann aber sowohl am Black River als auch an allen weiteren Zuflüssen vorüber, ohne die Fahrt auch nur zu verlangsamen. Auf seine Fragen, weshalb nicht gehalten werde, wie man doch vereinbart habe, nannte man ihm verschiedene Gründe: Einmal hiess es, die Uferwälder seien schon zu sehr abgeholzt, ein andermal sollte das Flössen an der betreffenden Stelle zu schwierig sein, dann wieder warnte sie der Schiffsclerk vor den Indianern, die gerade an diesem Fluss den Weissen besonders feindlich gesinnt seien. Schliesslich erreichten sie die Endstation der «Otter» bei den St.-Croix-Fällen, wo sie erfuhren, dass sich diese Gegend für ihr Vorhaben am wenigsten eigne, indem sie hier mit all den früher genannten Problemen gleichzeitig rechnen müssten. So kam es, dass sie ihr bereits gelandetes Gepäck wieder auf die «Otter» brachten und das Fichtenwald-Projekt endgültig aufgaben.
Auf der Fahrt flussabwärts lernten sie einen Amerikaner namens John Minter kennen. Der Mann erzählte ihnen, dass er sich unterhalb der St.-Croix-Mündung auf zwei Inseln im Mississippi mit Holzfällen beschäftige; er brauche gerade Hilfe und würde ihnen 50 Cents pro Cord bezahlen, wenn sie für ihn arbeiten wollten. Da sie alle drei ohne Arbeit waren und es zudem wenig Sinn machte, die gesamten Lebensmittelvorräte nach St. Louis zurückzubringen, nahmen sie Minters Angebot kurz entschlossen an. Die beiden Inseln befanden sich unterhalb von Prescott135 (im späteren Staat Wisconsin), aber näher beim rechten Ufer (später Minnesota). Sie lagen rund zwei Meilen auseinander, und während Lienhard und Wenger auf der unteren Insel blieben, begaben sich Minter und Theus zur oberen.
Lienhard und Wenger stellten bald fest, dass fast die ganze Insel schon abgeholzt war und ihre Vorgänger nur das besonders harte Holz oder die zum Fällen ungeeigneten Bäume zurückgelassen hatten. Schlimmer aber war, dass es in den folgenden Tagen nicht mehr zu regnen aufhörte und der bereits Hochwasser führende Fluss in einem fort weiter anstieg. Bald trennte sie ein bedeutender Strom von der hohen Uferbank, das Wasser begann die Insel zu überschwemmen und näherte sich nach und nach auch ihrer Hütte. Da weder Lienhard noch Wenger schwimmen konnten, wurde ihre Lage immer bedrohlicher: «Wir versuchten, durch Umhacken von Bäumen eine Art provisorische Brücke bis zur hohen Uferbank zu formiren, allein die kleinen Bäume wurden vom Wasser sogleich weggeschwemt, und da es ausser diesen nur ganz grosse gab, welche uns viele Arbeit gegeben und womit wier unser Zweck wahrscheinlich doch nicht erreicht haben würden, gaben wier diese Idee auf. Ich brobierte, ob unsere Hausthüre ein Mann tragen könnte, allein sie sank mit mir unter. Somit blieb uns nichts übrig, als geduldig zu warten.»136
Als sie am folgenden Morgen erwachten, fanden sie in der Hütte «1–2 Fuss tief Wasser, in welchem unsere Kleiderkoffern und andere Gegenstände herum fluhteten».137 Die Hütte war rundum von rasch fliessendem Wasser umgeben, so dass sie sich aufs Dach flüchteten und inständig hofften, Minter oder Theus kämen noch rechtzeitig zu ihrer Rettung. Nach bangem Warten sahen sie endlich Minter in seinem grossen Kanu sich der Insel nähern. Er fuhr durch die offene Tür in die Hütte hinein, brachte sie und ihre Habseligkeiten auf der Uferbank in Sicherheit und beförderte dann zuerst Lienhard zur oberen Insel.
Diese Kanufahrt auf dem angeschwollenen Mississippi sollte Lienhard nie mehr vergessen: «Minter hiess mich in das Cano steigen, welches sehr schwer be laden war. Es war das Erstemal in meinem Leben, dass ich ein solches Fahrzeug betrat, und ich fand, dass das Cano durch das vermehrte Gewicht von Minter und mir selbst bedenklich tiefer ins Wasser sank und dass kaum 3–4 Zoll Holz noch über dem Wasser war. Das Wasser des Mississippi floss reissend schnell, und indem ich ein völliger Neuling in einer solchen Bootfahrt war, schwankte das Fahrzeug so bedenklich, dass ich jeden Augenblick erwartete, das Cano werde umstürzen. Ich bot Alles auf, um ja recht aufrecht und ruhig zu sein; da ich aber helfen musste, das Cano vorwärts zu rudern, welches ich früher auch noch niemals gethan hatte, blieb das Hin- und Herschwanken, und zwar derart, dass Minter hinter mir jeden Augenblick ausrief: ‹Pass auf – oder wir leeren noch aus!› Ich glaube nicht, dass ich in meinem ganzen Leben je so viel Bange hatte als bei dieser ersten Canofahrt. Der Schweiss floss mir in Ströhmen über das Angesicht herab, und ich getraute mir nicht einmal, denselben abzuwischen, weil ich fürchtete, dadurch eine Unregelmässigkeit hervor zu bringen.»138
Obwohl der Fluss weiter stieg, arbeiteten sie auch auf der oberen Insel während mehrerer Tage weiter. Sie versuchten, das bereits gehackte Holz vor den Fluten zu retten, fällten – bis zur Hüfte im eiskalten Wasser stehend – weiter Bäume und verarbeiteten diese zu Cordholz. Dann kam auch hier der Moment, wo nur noch der höchste Punkt der Insel, auf dem die Hütte stand, aus dem Wasser ragte und sie gezwungen waren, ihre Arbeit zu unterbrechen, um das Ende des Hochwassers abzuwarten. In den folgenden Tagen fand Lienhard reichlich Gelegenheit, den Umgang mit dem Kanu zu lernen, denn sie verbrachten ihre Zeit mit Fischen und der Jagd auf Wasservögel, Fasane und andere Tiere, die sie mit dem Kanu aufspüren konnten.
In diese Zeit auf der Insel fielen Lienhards erste Begegnungen mit Indianern, besonders mit den Dakota der etwas weiter südlich liegenden Ortschaft Red Wing. Wenn Bewohner aus dem Dorf in ihren Kanus an der Insel vorüberfuhren, hielten sie manchmal an und kamen in ihre Hütte, wo sie dann um etwas Mehl, Salz oder andere Kleinigkeiten baten. Alle Begegnungen verliefen friedlich, wenn auch die Waffen immer griffbereit blieben. Die weissen Männer liessen ihre Besucher nie aus den Augen, und als einmal einige Indianer darum baten, ihr Abendessen in der Hütte zubereiten zu dürfen, verfolgten sie deren Aktivitäten mit angespannter Aufmerksamkeit. Näherten sich Einheimische auf dem Fluss in Überzahl, herrschte höchste Alarmstufe: «Es war da keine Zeit zu verlieren, schnell hatte ich meine Büchse Schussfertig gemacht und hinter die Türe gestellt, mein scharfes, grosses Metzgermesser hatte ich an meinem Körper verborgen, um, sollte es nöthig werden, es tüchtig gebrauchen zu können. Teuss hatte leider jetzt noch keine Schiesswaffe, hatte aber wie ich ein Messer zu sich genommen, hatte auch eine Axt fertig gemacht, mit welcher er sich, wenn nöthig, verteidigen wollte. Wier blieben ausserhalb der Hütte, denn ich war der Ansicht, dass wier keine unnöthige Furcht zeigen sollten, obschon etwelche der Indianer ein eigenthümliches Jauchzen vernehmen liessen.»139
Wie schnell eine Situation hätte eskalieren können, erlebte Lienhard am Tag seiner Ankunft auf der oberen Insel. Nachdem Minter nochmals zur unteren Insel gefahren war, um auch Wenger zu holen, erschien Letzterer plötzlich in einem Kanu, das von drei Indianerinnen gerudert wurde. Bei der Insel angekommen, stiegen sowohl Wenger als die Frauen aus: «Wier mussten Jeder fünf Cents und ein Blechbecher voll Mehl geben, weil sie den Wenger mitgebracht hatten, da Minter gefunden hatte, dass unser Canoe schon ohne den Wenger fast zu tief im Wasser gieng. Wenger sagte uns, Minter komme nach und müsse bald da sein; doch noch ehe die Indianerinnen unser Platz verliessen, hörten wier mein Namen rufen und endekten auf der Höhe des östlichen Ufers unsern Minter, welcher mir zurief, die Indianer zu töden, denn sie hätten den Wenger auch getödet. Wenger antwortete, dass er nicht tod und dass Alles in der Ordnung sei.»140
Die Indianer kannten die Gewaltbereitschaft der Weissen und waren in deren Nähe ebenfalls auf der Hut. Lienhard und Theus befanden sich eines Tages in einiger Entfernung ihrer Hütte an der Arbeit, als sie ein Kanu sich nähern sahen: «Die Squaw141 ruderte das Canoe, [während] er ein kleiner Karobiner ladete, wahrscheinlich, um einen Schuss fertig zu haben, wenn es nöthig werden sollte, währenddem er mit den weissen Männer in Berührung zu kommen gedachte. Es war der Häuptling der Sioux-Indianer von Redwing142. Er war an einem Auge blind, mochte etliche vierzig Jahre alt sein und war eher Klein als Gross, aber zimmlich untersetzt.» Lienhard und Theus wussten, dass sich Minter in der Hütte befand, weshalb sie ihre Arbeit nicht unterbrachen; nachher erfuhren sie aber, dass der Dakota in die Hütte gekommen sei und ein Beil mitgenommen habe. «Wier waren unzufrieden mit Minter, weil er uns nicht gerufen hatte, als der Häuptling uns das Hatchet nahm. Wier erwarteten nicht, dass wier es wieder zu sehen bekommen würden. Eines abends, wier waren gerade daran, unser Nachtessen zu nehmen, da trat ein stattlicher und schöner junger Indianer in unsere Hütte mit unserem Hatchet in der einen Hand, welches er bei Seite legte, währenddem er etwas sagte, was wier wieder freilich nicht zu verstehen vermochten, welches wahrscheinlich aber Dankesworte waren.»143
Bereits im Verlauf dieser ersten Kontakte konnte Lienhard auch die oft unfreundliche, herablassende Art beobachten, mit der viele Weisse den Indianern begegneten. Als damals die vielen Kanus ihre Insel passierten, näherte sich eines davon durch einen Seitenarm des Flusses ihrer Blockhütte: «Es enthielt nur einen ausgewachsenen Indianer, eine Frau, ein Knabe von zirca 12 Jahren und ein kleines Knäblein von vielleicht zwei Jahren. Der Indianer schien geglaubt zu haben, er könne zwischen den Baumstämmen hindurch in den Hauptstrohm hinaus, [doch] er landete bei unserer Hütte, und [sie] traten in dieselbe ein. Alle waren für Indianer gut gekleidet, hatten verschiedene Zierarten an sich, besonders das kleine Knäblein, welcher der besondere Liebling Aller zu sein schien. Teuss hatte seine grosse Tabackspfeiffe im Munde. Ich bemerkte, dass der Indianer öfters nach ihm hinblickte, als ob in der Erwartung, dass Teuss diese ihm als Friedenszeichen reichen würde, damit er auch einige Züge daraus rauchen soll. Da Teuss aber keine Anstallten dazu machte, sagte der Indianer dem grossen Knaben etwas, worauf dieser sich entfernte, aber sogleich mit einer langstämmigen Tabackspfeiffe und einem Beutel voll Taback zurück kehrte, die Pfeiffe füllte, sie anzündete, sie dann dem Indianer hinreichte, welcher daraus einige Züge that [und] sie dann mir reichte. Ich that natürlich Dasselbe, denn ich nahm an, dass dieses ein Friedenszeichen sei, und gab sie dann dem Jungen, welcher unserm Beispiel genau folgte und sie dann dem Ältern wieder zurück gab. Teuss war somit von der Friedenspfeiffe ausgeschlossen, wahrscheinlich, weil er seine Pfeiffe nicht zum Zeichen des Friedens und Wohlwollens herum geboten hatte. Vielleicht wollte [der Indianer] damit dem Teuss bessere Manieren lernen.»144
Der Mississippi hatte sich endlich wieder in sein Flussbett zurückgezogen. Wenger war abgereist, Lienhard und Theus wollten auf der oberen Insel noch eine Weile weiterarbeiten. Doch auf die Flut folgte eine Plage anderer Art: Dichte Schwärme von Moskitos fielen über die Männer her, und zwar mit einer solchen Angriffslust, dass es vom Morgengrauen bis weit in die Nacht kein Entrinnen vor ihnen gab. Sie krochen in Mund, Nase, Augen, Ohren und unter die Kleider, ja selbst durch diese hindurch stachen sie zu. Nachts schlüpfte Lienhard in seinen Bettstrohsack und drehte ihn über seinem Kopf zu, um ein wenig Ruhe zu finden, hörte aber Theus und Minter fortwährend heftig gegen die lästigen Angreifer schimpfen.
Die Moskito-Plage wurde so schlimm, dass Lienhard und Theus übereinkamen, die Insel bei der nächsten Gelegenheit zu verlassen. Sie hatten beide gut über 20 Cord Holz gehackt, und Lienhard war entschlossen, ihren Arbeitsort nicht ohne den hart verdienten Lohn zu verlassen: «Die ‹Otter› war endlich angekommen und hatte in der Nähe unserer Hütte angelegt. Unsere Sachen waren zum Einladen bereit am Ufer, aber wier hatten unsere Bezahlung noch nicht, und es schien mir, als ob Minter lieber gesehen haben würde, wenn unser Eigenthum sogleich aufs Boot gebracht worden wäre. Ich erklärte aber entschieden, dass wier unser Gepäck erst, nachdem wier Zahlung erhalten hätten, auf das Boot werden bringen lassen. Minter mochte wohl ahnen, dass, sollten wier verhindert werden, mit der ‹Otter› wegzukommen, er nachher auf unsere Freundschaft nicht gar viel mehr zählen dürfte, worin er sich gewiss nicht geirrt haben würde. Da Minter endlich einzusehen schien, dass er uns nicht so leicht los würde, wie er gehofft zu haben schien, liess er sich vom Clerk des Bootes das nöthige Geld geben und zahlte uns damit aus, wonach alle unsere Sachen auf die ‹Otter› geladen wurden, welche sogleich den Fluss hinab dampfte. Somit hatte unsere Pinnien-Spekulation ihr Ende erreicht, und obschon wier zirca zwei Monate Zeit verloren und wier dabei trotz dem Holzhacken noch Geld eingebüsst hatten, waren wier Beiden froh, den Musquitos, Indianern, Insel und Schlangen Lebewohl sagen zu können.»145
Zurück in Galena – es war inzwischen Ende Juli geworden –, arbeitete Lienhard einige Wochen bei einem württembergischen Schlosser namens Mack, der mit einer Schweizerin verheiratet war. Lienhards eindrücklichstes Erlebnis in dieser Zeit war eine mehrtägige Fussreise von Galena nach Guttenberg146, die er im Auftrag seines Meisters unternahm. Dessen Schwager hatte sich dort eine Parzelle schönes Regierungsland gekauft, und Mack beabsichtigte, es ihm gleichzutun, weshalb er Lienhard beauftragte, sich das noch käufliche Land für ihn anzusehen und ihm dann Bericht zu erstatten. Die Strecke von rund fünfundsechzig Meilen (105 km) nach Guttenberg wollte Lienhard entlang dem linken, den Rückweg nach Galena entlang dem rechten Flussufer zurücklegen. Unterwegs stellte er bald fest, dass keine eindeutige Route nach Guttenberg existierte, und sein Vorankommen wurde in der Folge zu einem sehr beschwerlichen Abenteuer. Über weite Strecken waren weder Weg noch Strasse vorhanden, und wenn es welche gab, fand sich bei Verzweigungen selten jemand in der Nähe, den er hätte um Rat fragen können. Er verirrte sich deshalb mehrmals und machte lange Umwege durch unwirtliche Gegenden, bis er sich endlich daran erinnerte, dass er einen Kompass in der Tasche trug. Zwar konnte er nun einigermassen die Richtung einhalten, doch das tagelange Gehen über Stock und Stein in der Sommerhitze war mit grossen Strapazen verbunden. Die Füsse schmerzten ihn, er zerriss seine Hosen samt Hosenträger, verlor seine Jacke, stürzte einmal beinahe über einen hohen Uferfelsen und erreichte sein Ziel erschöpft und mit völlig verschmutzten Kleidern erst am dritten Tag um die Mittagszeit.
Für den Rückweg, den er drei Tage später antrat, nahm er sich vor, die Distanz von fünfzig Meilen (80 km) zwischen Guttenberg und Dubuque in einem Stück zu bewältigen. Doch nach einem langen Tagesmarsch bei wiederum hochsommerlichen Temperaturen musste er zehn Meilen vor dem Ziel kapitulieren. Selbst Macks sonst munterer Hund, der ihn begleitete, schien gegen Abend am Ende seiner Kräfte: «Mein Hund schien womöglich noch müder als ich, er suchte mir einigen Vorsprung abzugewinnen, legte sich dann hin, liess mich zirca 100 Schritte vorausgehen, dann erhob er sich wieder, und wieder Dasselbe, immer aufs Neue.»147 Zum Glück fand Lienhard bei einem freundlichen Farmer Aufnahme für die Nacht, und nach einem guten Frühstück erreichte er anderntags gegen elf Uhr morgens Dubuque, von wo er mit der Fähre auf das linke Ufer des Mississippi wechselte und nach weiteren fünfzehn Meilen wieder in Galena eintraf.
Im Anschluss an diese «verrückte Fussreise»148 arbeitete Lienhard nur noch kurze Zeit für Mr. Mack. Er wollte nach St. Louis fahren, wo eine kleine Geldsendung aus der Schweiz für ihn eingetroffen sein musste, danach auch Highland besuchen. Er wusste zwar, dass er dort in die schlimmste Fieberzeit geraten würde, doch der Gedanke an das Geld liess ihm keine Ruhe, denn er hatte gehört, dass ein Bekannter versuchen wolle, es in seine Hände zu bekommen. Da Lienhard beabsichtigte, später nach Galena zurückzukehren, liess er sein Gepäck bei Mack und fuhr mit der «War Eagle», «einem der besten Boote von damals»,149 nach St. Louis. Dort konnte er im Geschäft von Kaufmann Böschenstein150 erleichtert sein Geld in Empfang nehmen, wobei dieser ihm erzählte, dass der betreffende Landsmann tatsächlich versucht habe, es an seiner Stelle abzuholen.
In Neu-Schweizerland fand Lienhard wieder Aufnahme und Arbeit bei seinem Freund Schütz. Die vielen bleichen Gesichter, denen er in der Siedlung begegnete, verhiessen nichts Gutes, und wie befürchtet, erkrankte er nur wenige Tage nach seiner Ankunft ebenfalls wieder am Fieber: «Das biliöse151 und nachher das Wechselfieber waren in diesem Jahre 1845 so Allgemein, dass keine Familien davon verschont blieben und in denselben kaum ein einzelnes Glied. Es gab Fälle, wo mehrere Glieder einer Familie dem heftigen Fieber erlagen.»152 Die mangelhafte medizinische Versorgung hatte zur Folge, dass sich die Krankheit wie im vorigen Sommer über viele Wochen hinzog. In besseren Momenten half Lienhard seinem ebenfalls fieberkranken Freund Schütz die nötigsten Arbeiten auf der Farm verrichten.
Auch die Freundschaft mit Familie Gale erneuerte Lienhard nach seiner Rückkehr, und nicht ganz ohne Wehmut erinnert er sich an einen seiner letzten Besuche dort: «Die Mariet und ich ritten per Pferden durch den Sugar Kreek Wald, um irgend einen Auftrag von Mr. Gale an Squire Tomkins zu verrichten, welcher an der anderen Seite des Waldes am Saume der Shoalkreek Prairie wohnte. Wären damals meine Vermögensverhältnisse in solchem Zustande gewesen, dass ich im Stande gewesen wäre, eine Frau und folglich eine Familie zu ernähren, so würde es zwischen uns zu einer sichern Erklärung gekommen sein, und ich bedauerte aufrichtig, dass nur die nöthigen Mittel dazu fehlten. Denn ich liebte dieses Mädchen nicht nur aufrichtig, sondern ich hatte grosse Achtung vor ihrem guten Charakter, vor ihrem angenehmen Wesen und von ihrer Tüchtigkeit, eine Haushaltung zu führen. Dass ich die von mir gewünschten Mittel damals nicht besass, meinte Miss Gale, könnte am Ende kein positiver Grund sein, dass zwei sich liebende Personen [sich] nicht verbinden sollten. Sie gab mir als Beispiel ein junger benachbarter Amerikaner, welcher nicht einmal das Geld hatte, den gesetzlichen Erlaubnissschein zu bezahlen, sondern dieses zu dem Zwecke habe borgen müssen. Durch Fleiss und treues Zusammenhalten könne gar viel verrichtet werden. Ich meinerseits hatte wirklich nicht so viel Selbvertrauen, denn zwei Jahre hintereinander war ich krank mit diesem bösen galligen Fieber, und war ich sicher, ob ich nicht noch viel mehr an Krankheiten zu leiden haben würde? Und wie würde ich da im Stande sein, eine Familie zu erhalten? Der Gedanke, dass ich durch Krankheit in Verhältnisse kommen könnte, wodurch ich nicht nur eine Frau nicht erhalten [könnte], sondern eine Frau mich erhalten müsste, war mir Unausstehlich und auch Entscheidend gegen meine Wünsche. Nur eine schwache Hoffnung hegte ich: dass es mir vielleicht doch bald gelinge, eine gewisse Unabhängigkeit zu erlangen, dann meine alte Liebe zu erneuern, und sollte diese Person noch ledig sein, sie dann um ihre Hand zu fragen.
Wie man spähter finden wird, wurden meine vermögens Verhältnisse allmälig besser. Aber da ich keinen Briefwechsel mit den Gales unterhielt und nur durch andere Personen Erkundigungen über sie einzog ohne ihr Wissen, mag die Miss Gale zu dem Gedanken gekommen sein, dass ich sie schon lange vergessen habe, und so gab sie ihre Hand einem Andern. Diese Nachricht erhielt ich kurze [Zeit] vorher, als ich mein Ziel bald erreicht zu haben glaubte. Es gibt halt auf der Welt kein vollkommenes Glück – diese Erfahrung wurde mir wie jedem Menschen zutheil!»153
Im Oktober fuhr Lienhard nach Galena zurück, um sein Gepäck abzuholen. Er traf sich dort auch wieder mit zwei Schweizern, die er im Sommer kennen gelernt hatte. Beide lebten schon mehrere Jahre in den USA, waren aber, wie er selbst, noch nicht zur Ruhe gekommen. «Der Eine hiess Heinrich Thomen154 [und] war gebürtig aus Biberstein, Canton Aargau. Er war kaum von mittlerer Grösse, hatte röthliche Haare und war in seinem Gesicht ein wenig Sommersprossig. Er war ungefähr acht Jahre älter als ich, aber sein Wesen hatte etwas Ansprechendes für mich. Der Andere war aus Kienberg, Canton Soloturn, mit Namen Jakob Ripstein.155 Er war ein grosser, schlanker und schöner Mann mit dunkeln, ein wenig scharfen Augen [und] dunkeln, etwas lockigen Haaren. Er war rasch in seinen Bewegungen, schien lebhaften, aufgeregten Temperamentes und war ebenfalls um acht Jahre älter als ich.»156
Gemeinsam diskutierten sie die Vor- und Nachteile verschiedener Reiseziele wie Oregon, Kalifornien und Südamerika, wobei Letzteres bald in den Hintergrund rückte, da eine Reise dorthin damals noch mit grossen Schwierigkeiten und Risiken verbunden war. «Mit Oregon oder California war das etwas Anderes. Um dahin zu gelangen, hatte man kein Meer zu kreuzen, keine Wellen, stürmische hoche See zu befürchten; das Schiff, welchem man sich anvertraute, war ein solider, starker Wagen, entweder mit Mauleseln oder Ochsen bespannt, das Steuer waren die Leitseile oder eine gute Ochsenpeitsche. […] Mit diesen zwei Männern sprach ich mehrere Mal über eine Reise dorthin, besonders nach California, denn damals hatte man bereits einige glühende Berichte über Californien gelesen, welche von einem Schweizer Captain Sutter geschrieben waren, und nach diesen Berichten hätte dieses Wunderland ein halbes Paradis sein müssen.»157 Oft erinnerte er sich auch noch an jene regnerische Nacht im November 1843, als er das magische Wort «California» zum ersten Mal gehört hatte und am liebsten sogleich in das geheimnisvolle Land am Pazifik aufgebrochen wäre. Obwohl die Verwirklichung dieser Pläne nun näher zu rücken schien, verliess er Galena ohne konkrete Abmachung mit seinen Freunden.
Lienhard führte das gescheiterte Fichtenwald-Projekt des vergangenen Sommers zu einem guten Teil auf seine noch immer mangelhaften Englischkenntnisse zurück. Zu oft musste er sich bei wichtigen Auskünften auf andere verlassen, und dies wollte er nun endgültig ändern. In den Wintermonaten 1845/46 nahm er deshalb keine feste Arbeit an, sondern besuchte zuerst in Greenville, rund zwanzig Meilen nordöstlich von Highland, den Sprachunterricht der öffentlichen Schule, auch nahm er dort Kost und Logis bei englischsprachigen Familien. Als die Schule schloss, setzte er den Unterricht noch eine Weile in Highland fort. Als er hier wieder am Wechselfieber erkrankte, das jetzt der Jahreszeit entsprechend «Winterfieber» genannt wurde, kam er zur Überzeugung, dass er in dieser Gegend wohl nie mehr ganz gesund würde, und die Ärzte, die er darüber befragte, bestätigten seine Befürchtungen.
Jakob Schütz allerdings wünschte sich, dass sein junger Freund in Neu-Schweizerland bliebe. Er beabsichtigte nämlich, bei seiner Farm158 einen Laden und eine Poststelle einzurichten, deren Leitung er Lienhard als Partner überlassen wollte. Die nötigen Kenntnisse sollte sich dieser in St. Louis erwerben, wozu sich, so Schütz, Kaufmann Böschensteins Geschäft gut eignen würde. Er wollte Lienhard deshalb so bald als möglich nach St. Louis begleiten, um persönlich mit Böschenstein zu reden.
Nun wurde es eng für Lienhards eigene Pläne, und das Angebot von Schütz machte ihm die Sache nicht leichter: «Dieser Idee, obschon insoweit angenehm für mich, pflichtete ich doch nur so halb bei, dazwischen drängte sich bei mir immer der Gedanke an Californien.»159 Von Unruhe getrieben, fuhr er zuerst noch einmal allein nach St. Louis, suchte die verschiedenen Marktplätze auf und erkundigte sich nach Personen, die beabsichtigten, bald die Landreise nach Kalifornien anzutreten. Doch die Reaktion der Leute fiel durchweg enttäuschend aus: «Ich fürchte, dass damals mehr als Einer der Befragten sich einbildete, es müsse mit mir nicht richtig in meinem Hirn sein, denn viele staunten mich an, als ob ich sie um eine Luftbaloonreise nach dem Mond gefragt hätte. ‹Nach Californien reisen? Wo ligt denn solch ein Land?› Auch keine einzige der befragten Personen schien etwas entweder von California oder Oregon, noch von Personen, welche nach jenen Gegenden reisen wollten, zu wissen. Ich war daher gezwungen, mein seit Jahren gehegter Gedanken, selbst dorthin zu reisen, aufzugeben, so ungern ich dieses that.»160
So kam es, dass er im März 1846 bei Böschenstein eintrat, um das Verkaufsgeschäft zu erlernen. Der Kaufmann hatte gerade einen neuen Gehilfen gesucht und Lienhard auf die Empfehlung von Schütz sogleich angestellt. Lohn wollte er ihm allerdings erst später bezahlen, wenn er ihn besser kenne und mit seiner Arbeit zufrieden sei. Immerhin war er bereit, Lienhard die Kost im Switzerland Boarding House zu bezahlen und ihn in seinem Laden schlafen zu lassen. Lienhard hatte sich inzwischen mit der Situation abgefunden und ging guten Mutes an die neue Aufgabe: «Unser Store war ein gemischter oder was man unter Dry goods and Groceries versteht, und wie ich glaube, ist ein solcher für ein junger Mann der Beste, um darin zu lernen. Was mich anbelangte, fand ich es durchaus nicht schwer, zu begreiffen und zu erlernen, was man mir einmal gezeigt hatte. […] Morgends, nachdem ich alles in den gehörigen Stand gesetzt hatte, kam dann Herr Böschenstein schon vom Frühstück, und ich gieng nach meinem Kosthaus, um mein Frühstück einzunehmen. Den Gedanken, dieses Jahr nach California zu gelangen, hatte ich bereits fallen lassen als Unausführbar, denn von Thomen und Ripstein hatte ich nichts mehr erfahren.»161
Nahezu drei Wochen waren vergangen, als Lienhard sich eines Morgens wie gewöhnlich zum Frühstück im Switzerland Boarding House einfand. «Da man noch nicht zum Essen geläutet hatte, setzte ich mich ein wenig in dem Vorzimmer auf einen Stuhl nieder, als plötzlich in der Thüre ein frisch angekommener Mann erschien und ich in demselben einen meiner Bekannten von Galena sogleich wieder erkannte. Es war Heinrich Thomen von Biberstein, der mich ebensobald erkannt hatte und mir sagte, dass Ripstein auch da sei und dass sie sich jetzt zu einer Reise nach California fertig machten. Man kann sich wol kaum vorstellen, welche Gefühle dadurch mit einem Mal wieder in mir wachgerufen wurden.»162 Es waren durchaus gemischte Gefühle, denn einerseits wünschte er sich nichts sehnlicher, als sich seinen zwei Landsleuten anzuschliessen, anderseits fragte er sich, ob und wie er die erst vor kurzem angetretene Stelle werde verlassen können, «ohne dadurch die Gefühle meines Prinzipalen zu verletzen».163 Auch waren seine finanziellen Mittel nahezu erschöpft, so dass er sich ausserstande sah, sich am Kauf von Ochsen und Wagen zu beteiligen. Doch Thomann und Rippstein beschwichtigten seine Bedenken, und mit ihrer Hilfe sowie einer kleinen List, ähnlich wie damals in Stäfa, gelang es ihm, ohne Streit von Böschenstein loszukommen.164 Seinen Beitrag an die Ausrüstung wollten die beiden Kameraden ihm leihen.
Beschwingt marschierte Lienhard nun die vierundzwanzig Meilen zur Farm seines Freundes in Neu-Schweizerland zurück. «Als ich bei der Farm ankam, war Schütz westlich vom Hause mit irgend etwas beschäftigt. Wie war er überrascht, als ich so ganz unerwartet zu ihm über die fence hineinstieg! Mit einem halb verlegenen Lächeln sah er mich an, [und] als ich ihn rathen liess, warum ich gekommen sei, meinte er, das könne er nicht sagen. Als ich ihm darauf erzählte, dass ich in Gesellschaft [von] mehrern andern jungen Leute über land nach California wolle, da that es ihm wirklich leid, denn er habe etwas Anderes mit mir vorgehabt.»165 Schütz erzählte ihm, dass er beabsichtigt habe, ihm, wenn er bei ihm geblieben wäre, später seine Farm zu vermachen. «Die gütige Absicht des guten alten Mannes rührte mich»,166 gesteht Lienhard. Doch es gab nun nichts mehr, was ihn noch hätte umstimmen können. Seinem grosszügigen Freund erklärte er, dass er wünsche und hoffe, sich eines Tages auch aus eigener Kraft eine Existenz aufbauen zu können.
Bevor er nach St. Louis zurückfuhr, kaufte sich Lienhard eine gute Doppelflinte und ein Waidmesser, «wie die Schweizerischen Scharfschützen sie tragen»,167 dann verabschiedete er sich von seinen Freunden in der Siedlung und schliesslich auch von Jakob Schütz und seiner Familie: «Schütz hatte mir noch ein paar Dollars in meine Hand gedrückt und bemerkte, dass es ihm recht leid thue, gerade arm an Geld zu sein, da er mir sonst mehr gegeben haben würde. Der Postwagen war jetzt angekommen, worin ich Platz fand und der mich bald von meiner zweiten Heimath und von meinem gutmeinenden zweiten oder amerikanischen Vater hinweg führte.»168
1 Conrad Leonhardt (?–1686) ist in den Quellen mit dem Vermerk «Tagwenmann von Bilten, am Nussbühl» aufgeführt. Er heiratete 1664 die einheimische Verena Leuzinger und erhielt ein Jahr später das Bürgerrecht der Gemeinde Bilten. Kubly-Müller, Genealogie des Kantons Glarus.
2 Kaspar Lienhard (1784–1873) war in zweiter Ehe mit Dorothea Becker (1793–1842) von Bilten verheiratet. Seine erste Frau, Anna Margaretha Stüssi von Niederurnen und Bilten, war 1811, nur wenige Tage nach der Geburt ihres ersten, tot geborenen Kindes gestorben. Kubly-Müller, Genealogie des Landes Glarus.
3 Dies waren Johann Heinrich (19.4.–17.8.1815), Johann Heinrich (1.5.–15.5.1817) und Johann Jacob (15.6.–25.8.1828).
4 Manuskript 1/1.
5 Manuskript 1/2.
6 Manuskript 1/3.
7 Manuskript 1/3.
8 Manuskript 1/4.
9 Manuskript 2/1.
10 Manuskript 2/1.
11 Manuskript 1/2.
12 Manuskript 2/2.
13 Manuskript 2/4.
14 Pfarrer Johann Rudolf Schuler (1795–1868) bekleidete das Pfarramt der Gemeinde Bilten von 1820 bis 1862. Zur Entwicklung des glarnerischen Schulwesens und zu Pfarrer Rudolf Schuler siehe Gottfried Heer, Geschichte des glarnerischen Volksschulwesens, Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus, Heft 18 (1881) und Heft 19 (1882).
15 Die Gemeinde bildete damit noch für viele Jahre eine Ausnahme. So setzte beispielsweise der Nachbarort Niederurnen – eine Fabrikgemeinde – 1832 die Schulpflicht bis zum 12. Altersjahr fest und reduzierte sie ein Jahr später sogar auf das 11. Altersjahr, «theils aus Rücksichtnahme gegen die Herren Fabrikanten, welche bei der rasch aufblühenden Industrie die Kinder brauchten, theils aus dem vorwiegenden Interesse der Eltern selbst an dem Verdienste, den ihnen die Kinder heimbrachten». Heer, Geschichte des glarnerischen Volksschulwesens, Heft 18, 133.
16 Heer, Geschichte des glarnerischen Volksschulwesens, Heft 18, 134.
17 Manuskript 3/2. – Heer beschreibt Pfarrer Schulers grossen Einsatz für die Gemeindeschule mit lobenden Worten, bringt mit Verweis auf Pestalozzi aber auch eine kritische Bemerkung an. Heer, Geschichte des glarnerischen Volksschulwesens, Heft 18, 135, Anm. 1.
18 Die Bankreihen waren offenbar gestuft und die oberste war den besten Schülern vorbehalten.
19 Pfarrer Schuler legte grossen Wert auf die sprachliche Förderung der Kinder. Bei den erwähnten «Gegensätzen» handelte es sich vermutlich um Wortpaar-Übungen.
20 Manuskript 3/3 f.
21 Manuskript 3/4.
22 Manuskript 3/4.
23 Manuskript 4/1.
24 Manuskript 3/4–4/1 f.
25 Heer, Geschichte des glarnerischen Volksschulwesens, Heft 18, 135. – Heer bemerkt zum Widerstand gegen Pfarrer Schuler: «Auch bei andern Anlässen trat die Gemeinde Bilten ihrem Pfarrer Schuler und seinen Bemühungen in den Weg; eine aus andern Gründen herrührende Entzweiung mit einer zahlreichen Partei der Gemeinde, die in den frühern Jahren seiner Wirksamkeit zu einer ganzen Anzahl von Rathsvorständen führte und am Schlusse seiner vieljährigen, eifrigsten Thätigkeit ihn im Streit aus seiner Stelle scheiden liess, erschwerte ihm auch seine Thätigkeit für das Schulwesen, das in ihm einen so eifrigen Förderer besass. Einige Entschädigung für Misskennung in der Nähe mochte ihm die von auswärts werdende Anerkennung bieten; selbst Fellenberg und Wessenberg (Constanz) besuchten seine Schule, die damals als Musterschule galt.» Heer, Geschichte des glarnerischen Volksschulwesens, Heft 18, 135f., Anm. 2.
26 Manuskript 3/3.
27 Manuskript 2/2.
28 Manuskript 4/3.
29 Heinrich Schindler entzog sich 1833 durch seine Auswanderung einer unglücklichen Ehesituation. Schindler und Lienhard trafen sich 1849 in New York (Manuskript 183/3f.).
30 1836 wanderten Peter Lienhards 18-jähriger Sohn Peter und Jakob Lienhards 23-jähriger Sohn, der ebenfalls Peter hiess, in die USA aus. Manuskript 12/3; Kubly-Müller, Genealogie des Landes Glarus.
31 Manuskript 3/1.
32 Es handelte sich um eine Neuauflage des Buches: Johann Evangelist Fürst, Der wohlberatene Bauer Simon Strüf, eine Familiengeschichte. Allen Ständen zum Nutzen und Interesse, besonders aber jedem Bauer und Landwirthe ein Lehr- und Exempel-Buch, 5., verb. Aufl., Augsburg: Kollmann, 1841.
33 Manuskript 6/3f.
34 Manuskript 4/4.
35 Peter Lienhard heiratete am 21. Februar 1837 die achtzehnjährige Elisabeth Speich von Luchsingen. Sie starb am 20. Juli 1838, eine Woche nach der Geburt ihres ersten Kindes, das seine Mutter nur um wenige Tage überlebte. Kubly-Müller, Genealogie des Landes Glarus.
36 Manuskript 4/4.
37 Manuskript 4/4.
38 Lienhards gelegentliche Schreibweise «Achs» für Axt wird hier und im Folgenden korrigiert.
39 Manuskript 7/2.
40 Manuskript 6/2.
41 Heinrich Lienhards Grosseltern väterlicherseits waren Peter Lienhard (1759–1828) und Afra Lienhard-Aebli von Bilten (1764–1797). Von ihren zwölf Kindern starben sieben im ersten Lebensjahr. Afra Lienhard-Aebli starb bei der Geburt ihrer Tochter Afra (1797–1802). Kubly-Müller, Genealogie des Kantons Glarus.
42 Satz korrigiert.
43 Manuskript 8/4.
44 Manuskript 2/3f.
45 Manuskript 8/4.
46 Manuskript 8/4–9/1.
47 Manuskript 9/1.
48 Heinrichs ältere Geschwister Peter und Barbara hatten am 22. Oktober 1839 die in Schänis wohnhaften Geschwister Dorothea und Jakob Ackermann geheiratet. Kubly-Müller, Genealogie des Kantons Glarus.
49 Eine Art von Typhus, bedingt durch die Versumpfung der Linthebene.
50 Manuskript 8/2.
51 Manuskript 8/2.
52 Peter hatte gegen den Willen des Vaters mit dem noch minderjährigen Bruder Kaspar vereinbart, dass dieser ihm sein Heimwesen, das er bei der Heirat erworben hatte, abkaufen würde. Dadurch war Peter in der Lage, Heinrichs Land, das an sein von der Mutter geerbtes «Heimatgut» grenzte, zu kaufen.
53 Manuskript 9/3.
54 Lienhard macht diese Angaben mit der Bemerkung «wenn ich nicht irre». – Manuskript 9/3.
55 Manuskript 9/3f. – Das Verb «traktiren» verwendet Lienhard mehrmals in der heute veralteten Bedeutung von «beschenken», oft im Sinne von «etwas zu trinken spendieren».
56 Manuskript 9/4.
57 Manuskript 9/4–10/1.
58 Manuskript 10/3.
59 Manuskript 10/3.
60 Manuskript 10/1.
61 Manuskript 10/1. – Satzstellung leicht korrigiert.
62 Manuskript 10/4.
63 Manuskript 10/4.
64 Manuskript 11/3.
65 Manuskript 11/3.
66 Manuskript 11/4.
67 Manuskript 12/1f. – Als Lienhard sieben Jahre später zu Hause auf Besuch weilte, traf er in Stäfa zufällig seinen früheren Lehrmeister Pfenninger, der ihn wegen der seinerzeit «etwas harten Behandlung» um Verzeihung bat. Manuskript 178/2.
68 Manuskript 12/2.
69 Manuskript 12/3.
70 Manuskript 12/3.
71 Manuskript 12/3.
72 Die Siedlung Neu-Schweizerland in Illinois, USA, wurde 1831 von der Familie Dr. Kaspar Köpfli aus Sursee, Kanton Luzern, Köpflis Neffen Joseph und Anton Suppiger sowie vier anderen Personen gegründet. Zu Neu-Schweizerland siehe Max Schweizer, Neu-Schweizerland 1831–1880: Genese und Funktion einer schweizerischen Einwanderersiedlung in den Vereinigten Staaten von Nordamerika (Madison County, Illinois).
73 Manuskript 12/4.
74 Die Wendung «jemandem den Garaus machen» (jemanden töten) ist aus dem Ruf «gar aus!» («vollständig aus!») hervorgegangen, mit dem seit dem 15. Jahrhundert in Süddeutschland die Polizeistunde geboten wurde.
75 Manuskript 12/4.
76 Reise-Pass. Schweizerische Eidgenossenschaft. Kanton Glarus. In Privatbesitz.
77 Manuskript 13/1.
78 Berichtigte Orthografie. Diminutiv von «Chaise» (zweiachsige Kutsche mit halbem Verdeck).
79 Manuskript 13/1.
80 Manuskript 13/1.
81 Manuskript 13/2f.
82 Manuskript 13/3.
83 «Highland war der Name der ersten, 1837 gegründeten Stadt der Siedlung Neu-Schweizerland. Er wurde schon bald auch anstelle von «Neu-Schweizerland» oder «New Switzerland» verwendet und ersetzte diese Bezeichnung später ganz. So schreibt auch Lienhard für die Siedlung meistens «Highland».
84 Salomon Köpfli, Neu-Schweizerland in den Jahren 1831 und 1841. Luzern 1842. Der Autor der «Broschüre» war ein Sohn des Siedlungsgründers Dr. Kaspar Köpfli. Lienhards Bezeichnung «Neu Helvetia» ist etwas verwirrend, weil eines seiner späteren Reiseziele, Sutters Fort in Kalifornien, «New Helvetia» hiess. Die Siedlung in Illinois erscheint in Quellen und Literatur stets unter den Namen «Neu-Schweizerland», «New Switzerland» oder «Highland».
85 Manuskript 13/4.
86 Lienhard schreibt, von der englischen Aussprache beeinflusst, meistens «Quatier» für «Quartier». Das Wort wird im Folgenden durchweg in seiner richtigen Form geschrieben.
87 Manuskript 14/4.
88 Manuskript 15/1.
89 Manuskript 15/1.
90 Das Schiff war nach dem Volk der Narragansett auf Rhode Island benannt, und diese Schreibweise wird, Zitate ausgenommen, im Folgenden verwendet. Der handschriftliche Eintrag auf der Passagierliste lautet «Naragansett». – Heinrich Lienhards Name, der in den amerikanischen Quellen in vielen Varianten zu finden ist, erscheint auf der Passagierliste der «Narragansett» als «Jean Lehnhart».
91 Brief vom 14. Juni 1985 von Philippe Manneville, Centre Havrais de Recherche Historique. Les Amis du Vieux Havre.
92 Manuskript 16/4.
93 Lienhards Angabe von 47 Tagen stimmt mit den Quellen überein, das heisst, die Reise von Le Havre bis zur Mississippi-Mündung dauerte vom 20. September bis zum 5. November 1843. Zwei Tage später, am 7. November 1843, unterzeichnete Kapitän Destebecho in New Orleans, wo die Zollabfertigung stattfand, zuhanden des Schiffskassiers die Passagierliste.
94 Lienhard bezeichnet die Distanz weiter unten mit 24 Meilen.
95 Manuskript 20/3.
96 Manuskript 20/3.
97 Michael Mollet (1818–1888) aus Unteramsern (heute Unterramsern), Kanton Solothurn, verheiratet mit Rebecca Mollet. Abbott, New Worlds to Seek, 252; Schweizer, Neu-Schweizerland, 263.
98 Manuskript 21/2.
99 Manuskript 21/2.
100 Manuskript 21/2.
101 Lienhard spielt hier auf den Titel von Kaspar Köpflis Bericht über seine Siedlungsgründung an: Die Licht- und Schattenseite von New-Switzerland in Nordamerika, Sursee, 1833. Gemäss Max Schweizer wurde der Siedlungsgründer dem im Titel erhobenen Anspruch, beide Seiten aufzuzeigen, jedoch gerecht. Schweizer, Neu-Schweizerland, 89ff. Abbott, Herausgeber von New Worlds to Seek, teilt Schweizers Auffassung. Er ist überzeugt, dass Lienhard sich hier zwar auf den bekannten und eingängigen Titel von Vater Köpflis Bericht beziehe, nicht aber auf den Bericht selbst, sondern auf die «Broschüre» seines Sohnes Salomon, die Lienhard bei der Ankunft in Sisseln erwähnt. Abbott schreibt, dass Lienhards Kritik in diesem Fall berechtigt war: «[Kaspar Köpflis Bericht,] written at the beginning of the settlement, makes an honest and intelligent effort to provide prospective emigrants a realistic picture of life in the new environment. The same cannot be said of Salomon Köpfli’s 1842 work, and Lienhard’s scorn and disillusionment regarding the ‹paradise› that [he] expected and did not find is justified.» Brief von John Abbott vom 8. August 1994.
102 Johann Leder aus Oberflachs oder Schinznach, Kanton Aargau.
103 Jacob Eggen berichtet über diese Zeit vor 1843, als es noch keine Strassen nach Highland gab, dass man sich zur Orientierung in der Umgebung markante Wegzeichen wie beispielsweise bestimmte Hügel merkte, und er fügt hinzu: «Geschah die Rückfahrt bei Nacht, so war man herzlich froh, wenn der alte Vater Leder noch spät auf der Klarinette seine lustigen Weisen, als Richtung in weite Ferne hören liess, der nahe dem Rigi seine Farm hatte, man war dann sicher, die richtige Richtung eingehalten zu haben.» Eggen, Aufzeichnungen aus Highlands Gründungszeit, 11. – Jacob Eggen (1803–1890) kam 1833 nach Neu-Schweizerland und heiratete drei Jahre später Kaspar Köpflis Tochter. In den 1880erJahren verfasste er seine Erinnerungen an die Gründungszeit der Siedlung. Daraus sind zwei gedruckte Berichte hervorgegangen: Jacob Eggen, Aufzeichnungen aus Highlands Gründungszeit zum Fünfzigjährigen Jubiläum 1887. Gedruckt in der Dampfdruckerei der «Highland Union», 1888, und: ders.: Die Schweizer-Kolonie Highland in Illinois, in: Deutsch-Amerikanische Geschichtsblätter, Heft 1–3 (Januar, April, Juli 1905); darin Eggens Erinnerungen: Heft 3, 15–36.
104 Lienhard schreibt an anderer Stelle (Manuskript 107/3), dass er «3 oder 4 hundert Dollars» von zu Hause mitgenommen habe.
105 Manuskript 24/2f.
106 Manuskript 23/1.
107 Paul und Nikolaus Ambühl. Abbott, New Worlds to Seek, 249.
108 Jakob Schütz (1789 –1865) stammte aus Sumiswald, Kanton Bern. – Der Name «Jakob» erscheint in alten deutschsprachigen Texten – Quellen und Literatur – sowohl in der Form «Jacob» wie «Jakob», in amerikanischen in der Regel als «Jacob». Lienhard schreibt den Namen auf beide Arten. Wo möglich wird im Kommentar die von ihm vorwiegend verwendete Form übernommen, ansonsten die Schreibweise in der benutzten Literatur.
109 Manuskript 24/3.
110 Manuskript 24/3.
111 Die Bewohner Highlands wünschten, dass die Postkutsche von und nach St. Louis über Highland (statt Marine) verkehren sollte. Dazu, so die Antwort des Generalpostmeisters, müssten sie für die Errichtung einer durchgehend befahrbaren Strasse zu den von der Post bereits bedienten Ortschaften Pocahontas und Troy sorgen, zwischen denen Highland lag. Diese Strassen wurden 1843 unter grossem Einsatz der Bewohner Highlands gebaut: «Die fünf gesetzlichen Strassenarbeitstage, die jeder zu leisten hatte, genügten jedoch nicht, die Arbeit fertig zu bringen; es musste daher freiwillig noch mehr als die gesetzlichen Tagwerke nachgearbeitet werden.» Eggen, Aufzeichnungen aus Highlands Gründungszeit, 33; Abbott, New Worlds to Seek, 234, Anm. 20. – Lienhard, der im November in Neu-Schweizerland eintraf, wurde für die Abschlussarbeiten an der Strasse aufgeboten.
112 In der amerikanischen Literatur meistens «Durer», gelegentlich «Durrer».
113 Manuskript 23/1.
114 Squire: Person mit lokaler Obrigkeitswürde.
115 Manuskript 23/1.
116 Manuskript 24/4.
117 Manuskript 24/4.
118 Jakob Schütz kam im Mai 1834 mit Familie Ruef aus Burgdorf nach Neu-Schweizerland. (Lienhard schreibt «Ruf», in der amerikanischen Literatur ist meistens die Form «Ruef» zu finden.) Ruef zog noch im gleichen Jahr nach St. Louis und liess Jakob Schütz als Stellvertreter auf seiner Farm zurück. Lienhard beschreibt Schütz als eine ganz besondere Persönlichkeit mit grossen menschlichen Qualitäten. Eggen teilte im Winter 1834/35 eine Blockhütte mit ihm und bezeichnet ihn als «echten Emmenthaler […], der nebst der Landwirthschaft in allen möglichen Holzarbeiten Bescheid wusste, und auch ein vortrefflicher Jäger war. Die Wände unserer Blockhütte waren gut gemacht, das Dach liess den Regen nicht durch […]. Der Feuerherd war ein 6 Fuss breiter und 3 Fuss tiefer Kamin, so dass man Holzblöcke von ähnlicher Grösse hineinbringen und so ein tüchtiges Feuer unterhalten konnte. Mit Tisch und Stühlen waren wir versehen, und Jeder hatte sein eigenes gutes Bett. Und dabei Lebensmittel jeder Art in Hülle und Fülle. An Wildprett hatten wir Überfluss. Truthühner, Hirsche, Hasen, Eichhörnchen schoss Schütz so viel, dass er davon nach St. Louis schicken konnte. Bei uns herrschte Arbeitstheilung. Schütz sorgte für Rohmaterial zum Lebensunterhalt, und mir wurde dessen Zubereitung zu theil […]. Wir führten ein Leben wie die Vögel im Hanfsamen; doch müssig waren wir nie.» Besucher blieben immer gerne zum Essen, «denn einen Extra-Bissen hatte ich stets vorräthig. Das ewige Einerlei der Amerikaner – Speck und Maisbrot – behagte uns nicht; wir waren an bessere Küche gewöhnt, mein Emmenthaler vom Tisch der Familie Ruef, ich von Köpfli’s her.» Eggen, in: Die Schweizer-Kolonie Highland in Illinois, 28f.
119 Manuskript 26/1.
120 Schütz hatte am 8.9.1840 Maria Meyer aus Hilterfingen, Kanton Bern, geheiratet. Abbott, New Worlds to Seek, 235, Anm. 30; Schweizer, Neu-Schweizerland 1838–1880, 262.
121 Manuskript 26/2f.
122 Manuskript 25/3.
123 Manuskript 25/3f.
124 Eggen, in: Die Schweizer-Kolonie Highland in Illinois, 30f.
125 Gehacktes Brennholz, das in cords (Mass für Brennholz, Klafter) verkauft wird. 1 Cord entspricht 3,62 Kubikmetern.
126 Ihr Name war «Marietta». Abbott, New Worlds to Seek, 240, Anm. 35. Lienhards Schreibweise entspricht wohl der mündlichen amerikanischen Form.
127 Manuskript 32/3.
128 Galena liegt 416 Meilen nördlich von St. Louis im Nordwesten von Illinois und verdankt seine Entstehung (1826) den reichen Bleivorkommen jener Region. Die Stadt zählte Mitte der 1840er-Jahre 15000 Einwohner, und die Bleigewinnung im Umkreis von 60 Meilen erreichte 1845, also in ebendiesem Jahr, mit 54500 000 Pfund ihren Höhepunkt. Henry Lewis, Valley of the Mississippi Illustrated, 202, auch Anm. 2.
129 Manuskript 32/3f.
130 Der Aufenthalt der Mormonen im Nauvoo des 19. Jahrhunderts ging zu jenem Zeitpunkt bereits seinem Ende entgegen. Knapp ein Jahr vorher, im Juni 1844, waren der Kirchengründer Joseph Smith und sein Bruder Hyrum ermordet worden. Unruhen zwischen den Mormonen und ihren Gegnern folgten, und im Herbst 1845 wurden Erstere in einem Manifest aufgefordert, Stadt und County zu verlassen. Ihr Auszug aus Nauvoo Richtung Westen begann im folgenden Winter 1845/46 und endete im Sommer 1847 am Grossen Salzsee. Ihr Tempel wurde im April 1846 fertiggestellt, als die meisten von ihnen Nauvoo bereits verlassen hatten. Ida Blum, Nauvoo, An American Heritage (1969), 7f.; Gordon B. Hinckley, Truth Restored (1979), 67, 77ff.
131 Manuskript 33/2f. – Der Bleiabbau bei Galena wurde sehr unprofessionell betrieben. Die Regierung wies jeder Person, die im «land office» einen entsprechenden Antrag stellte, ein Stück Land zu, worauf sogleich mit Graben begonnen werden konnte. Henry Lewis wunderte sich sehr über die Methoden des Bergbaus bei Galena: «The people here lack technical knowledge. If the mining and smelting had been carried on, as it is in Europe, by the application of chemical and geological knowledge, thousands of dollars and thousands of acres of land could have been saved.» Lewis, Valley of the Mississippi Illustrated, 202f.
132 Manuskript 33/3.
133 Manuskript 33/3.
134 Fort Snelling liegt nach modernen Messungen (auf dem Wasserweg) 665 Meilen nördlich von St. Louis. Die amerikanische Regierung kaufte das Land bei der Mündung des Minnesota River (damals noch St. Peter River) 1805 von den Dakota und begann 1819 mit dem Bau eines Forts, der sich über mehrere Jahre hinzog. Fort Snelling war die einzige Militärstation in der Gegend und bis 1849 das nördlichste Fort am oberen Mississippi. Lewis, Valley of the Mississippi Illustrated, 55f., auch Anm. 2 und 4; Abbott, New Worlds to Seek, 236, Anm. 46.
135 Philander Prescott errichtete 1827 bei der Mündung des St. Croix einen Handelsposten, der 1851 zu einem Dorf ausgelegt wurde. Abbott, New Worlds to Seek, 238, Anm. 20.
136 Manuskript 36/2.
137 Manuskript 36/2.
138 Manuskript 36/2.
139 Manuskript 36/3.
140 Manuskript 36/4.
141 Hier und im Folgenden berichtigte Schreibweise (Lienhard schreibt das Wort später richtig). Das Wort «Squaw» für «Frau» stammt aus der Algonkin-Sprache. Es erfuhr bereits im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine negative Bedeutung.
142 Manuskript 39/2. – Der Dakota-Vorsteher von Red Wing besuchte die Männer auf der Insel öfter. – Die Bezeichnung «Sioux» (Abkürzung der französisch-kanadischen Form «Nadouessioux») wird zwar weiterhin verwendet in der Literatur, ist aber nicht unumstritten. Es geht dabei um ein Wort, das von der Proto-Algonkin-Form «*na·towe·wa» abgeleitet in einigen Tochtersprachen als «kleine Schlangen» gedeutet wird und deshalb als abwertend gilt. Das Wort könnte aber auch von «*-a·towe·» abgeleitet sein und «eine fremde Sprache sprechen» bedeuten. Gale Encyclopedia vertritt die Version der abwertenden Bedeutung und bezeichnet «Sioux» als irrtümlichen Namen für die Nationen der Lakota, Dakota und Nakota. – Sämtliche Angaben zu den einzelnen einheimischen Völkern auf dem Gebiet der späteren USA stammen, wo nicht anders vermerkt, aus folgendem Werk: The Gale Encyclopedia of Native American Tribes, 4 Bde., 1898.
143 Manuskript 39/2.
144 Manuskript 36/3.
145 Manuskript 39/4.
146 Guttenberg entstand an der Stelle des früheren Prairie la Porte (im späteren Staat Iowa). In der neu gegründeten Stadt liessen sich vor allem deutschsprachige Einwanderer nieder, weshalb der Ort nach Johannes Gutenberg, dem deutschen Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, benannt werden sollte. Ein Fehler auf der ersten Druckplatte in den County Records hatte zur Folge, dass daraus «Guttenberg» wurde. Abbott, New Worlds to Seek, 237, Anm. 8.
147 Manuskript 44/3.
148 Manuskript 45/1. – Die Erlebnisse dieser Reise entlang dem Mississippi füllen fünfzehn Manuskriptseiten (41/2–44/4).
149 Manuskript 44/1.
150 John Böschenstein kam um 1834 in die Vereinigten Staaten und besuchte auch Neu-Schweizerland: «Um diese Zeit kam auch Herr Böschenstein hierher, sich umzusehen, kehrte jedoch schon am nächsten Tage nach St. Louis zurück, wo er mit Schoch einen Store anfing.» Eggen, in: Die SchweizerKolonie Highland in Illinois, 25.
151 Biliöses Fieber: mit Gelbsucht einhergehende fieberhafte Erkrankung.
152 Manuskript 45/4.
153 Manuskript 45/4. – Marietta Gale heiratete am 11. Oktober 1846 Andrew B. Parker. Aufgrund von Nachlassdokumenten wird vermutet, dass Gale Anfang Oktober 1844 gestorben sei. Abbott, New Worlds to Seek, 240, Anm. 35. Nach Lienhards Angaben ist dies aber nicht möglich, da er im Winter 1844/45 für Gale arbeitete und im Sommer 1845 zusammen mit Mariet diesen Auftrag für ihn ausführte. Lienhard schreibt, Gale sei im Spätherbst 1845 gestorben, und er erzählt, dass er im Winter 1845/46 Mariet und ihre Mutter, die zu jenem Zeitpunkt noch in Highland lebten, besucht habe. Die beiden Frauen hätten die Farm aber nicht allein bewirtschaften können und diese an eine Glarner Familie verkauft. Anschliessend seien sie auf die benachbarte Marine Prairie gezogen. Manuskript 48/3.
154 Heinrich Thomann (1814–1883) von Biberstein, Kanton Aargau. Er wanderte 1836 in die USA aus.
155 Jakob Rippstein von Kienberg, Kanton Solothurn. Er beantragte am 15. März 1841 im Alter von 28 Jahren einen Reisepass für Amerika. Register für deutsche und französische Pässe, Passkontrolle 1822–1848, 117, Nr. 2614, Staatsarchiv des Kantons Solothurn.
156 Manuskript 47/2. – Satz leicht korrigiert.
157 Manuskript 47/2.
158 Schütz lebte seit Frühling 1845 auf seiner eigenen Farm. An der Stelle, wo er sich ein Haus baute, entwickelte sich später der Ort St. Jacob. Abbott, New Worlds to Seek, 235.
159 Manuskript 49/4.
160 Manuskript 50/1.
161 Manuskript 50/1.
162 Manuskript 50/2.
163 Manuskript 50/2.
164 Böschenstein war etwas enttäuscht, da er beabsichtigte, seinen Laden im Mai nach Highland zu verlegen, und gehofft hatte, Lienhard werde ihn dorthin begleiten. Manuskript 50/4. – Eggen erwähnt, dass Böschenstein 1846 nach Highland zog und sich dort ein Haus baute. Eggen, Chronicles of Early Highland, 153.
165 Manuskript 50/4.
166 Manuskript 50/4.
167 Manuskript 51/1.
168 Manuskript 51/1. – Lienhard und Schütz blieben in Freundschaft verbunden. Als Pate von Lienhards erstem Sohn Caspar Arnold (1852–1863) verzeichnet das Taufregister von Kilchberg, Kanton Zürich, einen Friedrich Schütz von Knonau, sesshaft in Zürich Aussersihl, möglicherweise ein Verwandter von Jakob Schütz. Jakob Schütz selbst wurde Pate von Lienhards zweitem, ebenfalls noch in Kilchberg geborenem Sohn John Henry (1853–1933), dessen Taufe am 29. Januar 1854 stattfand, wenige Monate vor der endgültigen Auswanderung der Familie in die USA. Pfarrbuch 1838–1863 von Kilchberg, Kanton Zürich, Nr. 74 und Nr. 84.