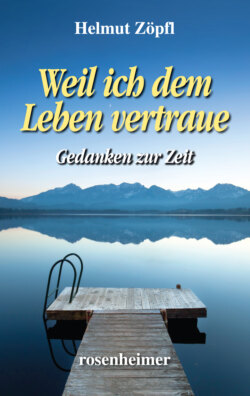Читать книгу Weil ich dem Leben vertraue - Helmut Zöpfl - Страница 7
ОглавлениеGrund zur Freude
Wer die Hauptüberschriften in der Presse liest, die Nachrichten hört, die Tagesschau sieht, der könnte fast auf den Gedanken kommen, dass unsere Welt nur mehr von Angst und Schrecken beherrscht wird. Dazu kommt, dass uns allenthalben Schlagworte wie »Zukunftsangst«, »Schulangst«, »Lebensangst« begegnen, und manchmal entsteht geradezu der Eindruck, dass man als Außenseiter angesehen wird, wenn man nicht ebenfalls ständig seine Angst, seine Lebensunlust, seinen Lebensunmut bekundet.
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Tatsächlich ist vieles in unserer Welt und besonders in unserer heutigen Situation nicht unbedingt dazu angetan, Jubel auszulösen. Und es hieße, die Augen vor den Realitäten verschließen, wollte man die vielen Ängste, die uns bei den verschiedensten Anlässen überkommen, als unbegründet abtun. Vielleicht war man auch lange Zeit zu optimistisch und hatte in einer bedingungslosen Fortschrittsgläubigkeit angenommen, die Welt würde immer besser und vollkommener werden, und es sei lediglich eine Frage der Zeit, bis sich das Paradies auf Erden einstellen würde. Hatte man also zunächst vielleicht in einem grenzenlosen Vertrauen auf irgendwelche anonyme Mächte wie Fortschritt, Technik usw. erwartet, »es« würde immer mehr aufwärts gehen, so herrscht heute oft die pessimistische Meinung vor, »es« ginge langsam, aber sicher immer mehr begab.
Gemeinsam ist diesen Haltungen eines: Man sieht sich häufig im Guten wie im Bösen überrollt von irgendwelchen Entwicklungen und steht in einer gewissen Passivität abwartend da. Zugegeben, es ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass wir trotz aller uns zuteilwerdenden Aufklärung vieles immer weniger verstehen, dass uns oft angesichts der Möglichkeiten der Technik im Guten wie im Bösen ein Ohnmachtsgefühl überkommt und dass wir manchmal einfach Angst bekommen, Angst vor dem Umgreifenden und Übergreifenden.
Was ist nun zu tun, wenn wir nicht immer mehr in Resignation verfallen wollen, wenn wir nicht als einzige Auskunft auf anstehende Probleme ein: »Da kann doch ich ohnehin nichts machen« hören wollen? Sollen wir wirklich bei der Bewusstmachung der Angst und Ängste stehenbleiben? Ich meine, dass es heute mehr denn je notwendig ist, sich auf die positiven Haltungen wie Hoffnung, Freude und Lebensmut zu besinnen. Gerade das Wörtlein »Freude« scheint in unserer Zeit ein arges Schattendasein zu führen. Albert von Schirnding stellte vor einiger Zeit die Frage, wo sie, der »schöne Götterfunke«, denn geblieben sei in unserer Welt, und vor einiger Zeit wurde von Meinungsforschern festgestellt, fünfzig Prozent der Befragten hätten sich am betreffenden Tag überhaupt noch nicht gefreut, 21 % hätten wenigstens am Tag zuvor Freude empfunden und sage und schreibe 9 % hätten Freude seit mindestens einem Jahr oder überhaupt noch nicht kennengelernt.
Im Streiflicht der Süddeutschen Zeitung machte man sich damals dazu folgende Gedanken:
»Liegt das Freudendefizit … am steigenden sozialen Anspruchsgedanken, das unterhalb eines sechsstelligen Lottogewinns keine echte Freude mehr akzeptiert. Oder ist nur das etwas altväterlich klingende Wort bei der jüngeren Generation schon so ›out‹, dass sie es nicht mehr mit Inhalten belegen kann, die zwar sachlich den Tatbestand der Lebensfreude erfüllen, aber unter andere Stichworte eingeordnet sind: Klasse, dufte, riesig, irre? Vielleicht sind die Menschen auch besser geworden, sodass der Verzicht auf kleine Bosheiten ihnen den Genuss der Schadenfreude schmälert. Die Tatsache, dass noch vor zehn Jahren ganze 66 % der Bundesbürger sich an eine Freude am gleichen Tag erinnern konnten, drängt freilich eher den Verdacht auf, die Jagd nach schablonierten Konsumfreuden brauche unsere Unzufriedenheit immer mehr als Motor« (SZ vom 22. April 1976).
»Unzufriedenheit als Motor« anstelle des »Lebensmotors Freude«? Stimmt es wirklich, dass wir in einer freudloseren Zeit leben als früher? Hat der Münchner Schriftsteller Sigi Sommer recht, wenn er von einer »mürrischen Generation« spricht? Oder ist das alles eine nostalgische Klage, dass eben früher in der »guten alten Zeit« alles besser, schöner und freudvoller gewesen sei?
Eines ist sicher, wir müssen uns vor Schwarz-Weiß-Malerei hüten. Gewiss gibt es auch heute Freude und ebenso gewiss gibt es auch noch genügend Anlässe zur Freude. Wir dürfen weder in die Einseitigkeit verfallen, nur die »Zeit« oder die »Gesellschaft« verantwortlich zu machen noch den »Menschen von heute« oder die »Jugend« pauschal als »un-freudig« hinzustellen. Wichtig scheint mir ohnehin, dass man den Schwarzen Peter nicht einfach weitergibt, sondern nach konkreten Möglichkeiten einer Verbesserung sucht. Eines ist sicher: Wenn wir das Negative überwinden wollen, müssen wir uns wieder stärker an das Lebenselixier Freude erinnern, uns der Freude öffnen. Sich der Freude zu öffnen bedeutet aber, sich aus einer gewissen Verkrampfung zu lösen, nicht einfach nur auf eine gute Stimmung zu warten, sondern zu suchen, die Augen aufzumachen und einer Sache, einem Erlebnis die positiven Seiten abzugewinnen. Wir brauchen deshalb nicht kritiklos die Augen verschließen vor irgendwelchen Mängeln in und um uns, müssen uns aber bewusst sein, dass wir Mängel nur überwinden können, wenn wir uns des »Treibstoffs« Freude bedienen.
Dazu ist es notwendig, den rechten Blickwinkel zu finden bzw. ein wenig hinter und über die Dinge zu schauen, mehr zu sehen. Ulrich Hommes gibt uns einen Tipp dafür:
»Die Dinge sind ja meist doch anders, als wir das in geschäftiger Hast und Gier für gewöhnlich meinen. Sie sind gar nicht so glanzlos und haben sehr viel mehr Licht bei sich, als wir gemeinhin erkennen. Sollten wir nicht … einmal fragen: Wozu habe ich denn Hände und Füße, den Mund, den Verstand und das Herz? Gibt es nicht etwas, das da ist für mich und das mich froh machen will –das Weiß einer Wolke am Himmel zum Beispiel, der Duft eines Strauchs vor dem Fenster, zu essen, zu trinken auch, und miteinander zu reden? Jeder Tag, der uns geschenkt wird, ist voll von solch neuen Möglichkeiten, wir müssen sie nur entdecken und sie auch wirklich ergreifen.«
Diese Bemühungen um eine positive Einstellung zum Leben sind wohl unübertroffen klar und klug in einem alten chinesischen Sprichwort ausgedrückt:
»Der Narr ärgert sich, weil der Krug schon halb leer ist. Ein Kluger freut sich, dass der Krug noch halb voll ist. Der Ärger füllt den Krug nicht auf, die Freude macht ihn nicht leerer. Aber der Freude schmeckt das köstlich, was dem Ärger bitter erscheint.«
»Nicht in jeder Wolke steckt ein Blitz«, heißt es in einem Spruch aus Usbekistan, und steckt er drin, so schlägt er vielleicht nicht ein, so vielleicht nicht bei uns, und wenn bei uns, so sengt er vielleicht nur, tötet aber niemand.«
Und Helen Keller sagt: »Mein Optimismus beruht nicht auf der Negation des Bösen, sondern auf dem frohen Glauben, dass das Gute überwiegt, und auf dem mächtigen Willen, immer mit dem Guten Hand in Hand zu arbeiten.«
Mit diesem Wort ist tatsächlich das Wesentliche gesagt. Niemand wird leugnen, dass es eine Verkürzung der Wirklichkeit wäre, nur das Gute zu sehen. Aber es kommt darauf an, die besseren Seiten des Lebens immer wieder zu suchen, nicht zu ermüden, sich auf den Weg zu machen und dem Leben positiv gegenüber zu stehen.