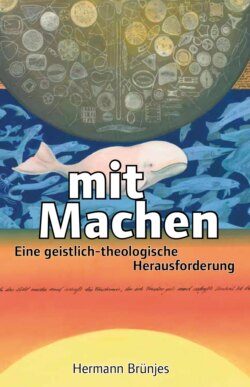Читать книгу mit Machen - Hermann Brünjes - Страница 9
2. Auf wen wir hören ...
Оглавление
»Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden.« (Mt. 16,25)
Erschreckt Sie so ein Satz? Macht Ihnen ein derart konsequenter Ansatz Angst?
Ich könnte das verstehen. Sein Leben erhalten, wer wollte das nicht?! Was tun wir nicht alles, um es zu erhalten? Ärzte, Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Versicherungen ... die Liste von Institutionen, die uns dabei helfen sollen, ist lang. Lebenserhaltende Maßnahmen werden bis zum letzten Atemzug eingeleitet. Genau dies will ich: Mein Leben erhalten. Und das sollte mit der Bindung an Jesus Christus nun anders werden? Als Christ soll ich mein ganzes Leben aufgeben?
Hören wir genauer hin: Da ist nicht nur von Aufgeben die Rede, sondern auch von einer riesigen Chance, das Leben zu finden. Welches »Leben« meint Jesus? Ein Leben in der »besseren Gerechtigkeit«, eines ohne den Stress der Selbsterlösung, ohne ständige Rechtfertigung vor mir selbst, anderen und Gott, ohne dauerndes Beweisen meiner Existenzberechtigung – und auch ein Leben ohne Angst, es wieder zu verlieren, ohne Todesangst. Ewiges Leben.
Was Jesus mit »Leben« meint, wird deutlich, wenn wir auf ihn selbst schauen. Natürlich ist auch »normales« Leben gemeint. Jesus ist ganz normal aufgewachsen, hat eine Kindheit im Kreis von Geschwistern und Eltern durchlebt und einen Beruf erlernt. Dann ist er konsequent seiner Berufung gefolgt und drei Jahre lang als Prediger, Lehrer und Heiler unterwegs gewesen. Er hat sich für Menschen eingesetzt, wurde enorm wichtig für sie. Er hat in einer Gemeinschaft gelebt, Freunde gehabt und ganz sicher sein Leben auch genossen (seine Gegner haben ihn sogar als »Fresser und Weinsäufer« verhöhnt).
Nie hat sich Jesus allerdings an das Diesseits geklammert, als gehe das Leben irgendwann zu Ende. Auch als es eng wurde, am Passah in Jerusalem, hat er sein Leben nicht verteidigt, sondern sich dem gestellt, was kommen sollte.
Immer hat Jesus das Leben im Horizont der Auferstehung gesehen. Ewiges Leben. Das Himmelreich auf Erden. Vor allem wenn wir die tiefe Einheit Jesu mit Gott wahrnehmen, erschließt sich, was er unter »Leben« verstand. Es ist die unauflösliche Verbindung mit dem, der das Leben geschaffen hat und es selber ist, mit Gott, dem Schöpfer und Vater.
Ein Freund von mir, früher Pastor in Uelzen, hat einmal einen Brief bekommen. In wackliger Handschrift stand dort: »Wenn Sie noch einmal vom Tod reden, passiert Ihnen was!«
Wer diesen Drohbrief geschrieben hatte, wurde nie geklärt. Vermutlich war es ein älterer Mann. Ob er Angst vor dem Tod hatte, vor dem Sterben? Ein Kirchgänger, dem die Predigt vom »Leben verlieren« zu nahe ging? Ich kann mir das denken. Nicht vorstellen kann ich mir allerdings, dass wir daraufhin das Thema Sterben und Tod ausblenden. Wenn es auch seinen Platz haben sollte und es noch viele andere wichtige Themen gibt – wir müssen auch über den Tod reden. Er ist es doch, der das Leben bedroht. Er ist der eigentliche Feind des Lebens und so lange er stärker als das Leben ist, haben wir verloren.
Doch Jesus ist auferstanden. Deshalb, nur deshalb kann er mit vollem Recht von »Leben« reden. ER ist das Leben.
Was übrigens logisch ist: Nur wenn der Tod wirklich besiegt wird, kann man davon sprechen, dass sich das Leben durchsetzt. Unser üblicher Begriff von »Leben« bleibt damit unscharf und greift viel zu kurz. Er meint immer das bedrohte Leben, das todgeweihte, das endliche und vergängliche Leben. Wir verteidigen es und erhalten es und wissen doch gleichzeitig, dass es irgendwann vergeht. Doch angenommen, Jesus hat den Tod tatsächlich überwunden und ihn durchbrochen – dann wäre eben dies eine, nein, die begründete Hoffnung auch für unser und mein Leben. Erst ein Leben, das der Tod nicht zerstört, trüge den Namen »Leben« zu Recht. Es bräuchte dann auch keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr, weil das Leben über den Tod hinaus ohnehin gesichert ist.
Auferstehung. Ostern.
Jesus sagt, dass man genau dieses Leben finden kann! In dieses Leben kann man eintauchen und es in Ewigkeit erleben.
Wie das geht? Unser Vers weist die Richtung.
Die einzig wirksame lebenserhaltende Maßnahme: Ich verliere mein Leben an Jesus Christus. Ich setzte alles auf ihn – auch den alten, irrtümlichen Lebensbegriff und das, an das ich mich im Moment festklammere wie an den berühmten rettenden Strohhalm.
Wieder wird, wie vorhin beschrieben, differenziert: Das Leben wird geschenkt. Weder kann es noch muss es selbst gemacht werden. Aber man kann und muss es sich schenken lassen. Im Empfangen ist man aktiv beteiligt. Solches »Leben finden« hat eine konkrete Gestalt und eine sichtbare Form und jenes »sein Leben um Jesu willen verlieren« ist mit konkretem Handeln verbunden.
Der Ruf in die Nachfolge
Sehr gut sieht man dies an den Berufungsgeschichten der Jünger Jesu (z.B. Mt. 4,12f. oder Lk. 5,1f.). Sie beginnen jeweils mit einer Aufforderung Jesu. Diese eröffnet eine neue Lebenswirklichkeit. »Komm, folge mir nach!«
Jesu Ruf zur Nachfolge war und ist keine Bitte. »Petrus, wenn du Lust hast, komm doch mit mir.« »Matthäus, bitte lass doch dein altes Leben hinter dir und folge mir nach.« »Nathanael, überleg es dir noch mal, lass dir Zeit.«
Nein, Jesu Ruf war und ist eine Herausforderung, eine Ansage – wenn man so will ein Befehl. Entweder man steht auf und geht mit – oder nicht. Es gibt jetzt nur Ja oder Nein.
Krass – oder? Ich denke, es lohnt sich, diese Radikalität einmal in Blick zu nehmen.
Für uns in Deutschland ist Christsein von solcher Klarheit oft weit entfernt. Wir sind einfach so ins christliche Abendland hineingeboren. Manche haben den Glauben schon »mit der Muttermilch aufgesogen«, andere sind über Kinder- und Jugendarbeit in die Gemeinde gekommen. Wieder andere haben sich in einem Glaubenskurs oder auf einer Jugendfreizeit ganz bewusst für Jesus Christus entschieden. Da gibt es so viele Unterschiede, wie es Biografien gib. Und das ist gut so. Wenn wir anfangen, die Zugänge zum Glauben zu untersuchen und womöglich zu bewerten, kommen wir »in Teufels Küche« (die Redewendung stammt aus dem Mittelalter und meint das Fegefeuer, in dem man keine Zukunft hat). Es kann also nicht darum gehen, unsere Biografien und die Wege zum Glauben miteinander zu vergleichen und in Konkurrenz zu bringen.
Auch die Art, wie wir zum Glauben einladen, unterscheidet sich von der klaren, rufenden Weise Jesu, jedenfalls in der Regel. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Jede und jeder macht sich sein eigenes Bild und macht was er oder sie will. Ich entscheide, was und wem ich glaube, folge und hinterherlaufe. Alles andere wäre Manipulation und Nötigung. Folglich ist der Glaube ein Angebot. In unserer pluralistischen Gesellschaft ist er ein Angebot unter vielen. Die einzig legitime Form des Rufes zum Glauben an Christus ist die Einladung. Wir werden weiter hinten noch darüber sprechen. Eine offene Einladung mit viel Freiraum zur Entscheidung für oder gegen – anders kann ich mir heute nicht vorstellen, Menschen zum Glauben und in die Nachfolge zu rufen.
Freiraum zur Entscheidung
Wir sind heute vorsichtig, wollen Freiräume nicht einengen oder zerstören. Deshalb ist unsere Weise, vom Glauben zu reden, manchmal vage und unbestimmt. Vielleicht wird deshalb eine Entscheidung für Jesus Christus immer wieder eher behindert statt begünstigt. Ich denke etwa an eine junge Mitarbeiterin, die mir nach Jahren Jugendarbeit vorwarf, ihr nie gesagt zu haben, was sie denn tun soll, um Christin zu werden. Vielleicht war ich tatsächlich zu vorsichtig.
Anders Jesus. Er macht klare Ansagen. Und jetzt entsteht ein Freiraum zur Entscheidung, den anzuschauen sich lohnt.
1. Freiraum – nur weil Jesus ruft
Erst seine Ansage, erst seine Einladung hat einen Raum für eine Entscheidung eröffnet. Wenn Jesus nicht ruft, nicht spricht und sich nicht zu Wort meldet, ergibt auch Nachfolge keinen Sinn. Wenn es nicht zu einer Begegnung mit ihm kommt, wäre jedes Aufgeben des alten Lebens Unsinn und jeder Gehorsam gegenüber Regeln und Forderungen wäre wieder nur Moralismus und Selbsterlösungsversuch.
Seien wir also vorsichtig, sofort von einem »Freiraum zur Nachfolge« zu reden. Wir machen diesen Raum in der Regel an den Menschen fest, die sich selbst die Freiheit nehmen. Ich definiere, ob ich mich frei fühle oder nicht. Wir gestalten in unseren Veranstaltungen (hoffentlich!) eine offene Atmosphäre, damit Menschen sich wohl fühlen und frei ... Vorsicht! Natürlich ist es dem Evangelium angemessen, solche Wohlfühl-Räume zu schaffen und auf Druck zu verzichten. Aber unsere Arrangements mögen gut gemeint sein – den Freiraum zur Entscheidung für Jesus eröffnen sie letztlich nicht.
Ihn bewirkt nur Jesus selbst. Es ist seine Gegenwart, es ist sein Wort, es ist seine persönliche Anrede, die Menschen vor die Entscheidung zur Nachfolge stellen. Und wieder entzieht sich das Wesentliche unserer Machbarkeit und treibt uns ins Gebet. Wir können die Einladung Jesu zum Glauben und in die Nachfolge aussprechen, können sie methodisch liebevoll und rhetorisch klar und freundlich einbetten – aber, dass Jesus dies alles zu seinem Ruf macht und dass sich nun so etwas wie »Berufung« ereignet, entzieht sich unserer Möglichkeit.
Allerdings – um nicht völlig ohnmächtig zu erscheinen – ich gehe davon aus, dass Jesus wie versprochen jetzt, hier und heute handelt. Folglich sprechen wir Menschen an und rufen sie in die Nachfolge. Wir werden sehen, was passiert ...
2. Anspruchsvoll herausgefordert
»Freiraum« – was sich schnell ein bisschen wie »fromm, fröhlich und frei« anhört, entpuppt sich als Anspruch, als Forderung. Die Begegnung mit dem Ruf Jesu wird gewissermaßen spannend, im Sinne von spannungsgeladen. Man hält die Luft an. Was passiert nun? Wie geht es weiter? Wie entscheidet er oder sie sich? So lange sie ihren Weg weitergehen wie bisher, fehlt eine solche Spannung. Petrus fischt Fische. Nathanael pflegt seine jüdischen Traditionen. Paulus agiert ideologisch und praktisch gegen die christlichen Abweichler. Alles hat seine Ordnung. Bis Jesus spricht. Jetzt kommt alles durcheinander.
Wer das selbst einmal erlebt hat, weiß, wovon ich rede. In »Herausforderung« steckt »Forderung«. Ich spüre: Jetzt kommt es darauf an. Jetzt geht es nur so oder so, für oder gegen, mit oder ohne. Wenn Jesus jemandem begegnet und der Freiraum zur Nachfolge entsteht, hat die Situation immer auch irgendwie etwas Zugespitztes, ja sogar Zwingendes. In der Theologie spricht man vom »göttlichen dei«. Das griechische Wörtchen »dei« bedeutet »muss«.
Ja, es gibt ein »göttliches Muss«. Da kann man es sich nicht mehr aussuchen. Da ist man bedrängt und gewissermaßen auch unter Druck. »Gottes Wort ist wie ein brennendes Feuer und wie ein Hammer!« (Jer. 23,29). Wenn Gott redet, wirkt er gleichzeitig hinein in die Geschichte, auch in unsere ganz persönliche Lebensgeschichte.
Der Ruf Jesu ist ein solches Reden Gottes. Ich werde vor die Wahl gestellt, vor die große Gelegenheit, die vielleicht sogar einmalige Chance. Für die alten Griechen war dies sogar eine eigene Zeit-Kategorie. »Kairos« nannten sie es. Der Zeitpunkt; die einmalige Gelegenheit; die Entscheidung; das Jetzt oder nie, auf das es unbedingt ankommt.
»Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht!« (Hebr. 3,15). Dieses »Heute« taucht in der Bibel immer wieder auf. Es ist der »Kairos«, in dem sich alles entscheidet. Er entsteht durch Gottes Anrede und provoziert hier und jetzt meine Antwort, meine Reaktion. Und es stimmt schon: jetzt wird es spannend, jetzt kommt es darauf an. Ich kann, ich soll und ich muss mich entscheiden.
Soll deshalb niemand sagen, es sei leicht, mit der Anrede Jesu umzugehen. Manchmal fließen Tränen, manchmal gibt es unglaubliche Widerstände, manchmal schlaflose Nächte, endlose Diskussionen und am Ende manchmal wieder Tränen. Der Freiraum, in den Jesus uns stellt, ist auch der, dies alles auszuhalten.
Übrigens: Solche »Kairos«-Momente gibt es nicht nur zu Beginn des Glaubens, beim Hören eines ersten Rufes des Auferstandenen. Sie wiederholen sich ständig. Und immer fordern sie mich heraus: Der Moment, als ich höre, ein Bekannter liegt im Krankenhaus. Besuche ich ihn oder nicht? Die Situation beim Feuerwehrball als jemand erzählt, dass er arbeitslos geworden ist. Höre ich ihm zu und nehme mir Zeit oder drängt es mich auf die Tanzfläche oder an die Theke? Die angekündigte Friedensdemo. Plane ich die Anreise oder überlasse ich anderen, sich politisch zu äußern? Die Bitte um Spenden für ein Patenkind. Fülle ich die Zusage aus oder überlasse ich das lieber anderen? Die Einladung zu einer kirchlichen Veranstaltung. Gehe ich oder nicht?
Immer wieder gibt es Situationen, die so einen »Kairos« in sich tragen. Sie sind Freiräume, Jesu Ruf zu ergreifen.
3. Jedes »Ja« ist auch ein »Nein«
Wir haben es schon geahnt (und gefürchtet?). Entscheidung für etwas bedeutet immer auch eine Entscheidung gegen etwas. Ein »Ja« beinhaltet zugleich ein »Nein«.
Wenn ich heirate, sage ich »Ja« zu meinem Partner bzw. meiner Partnerin. Meine alten Freundinnen und Freunde mögen mir noch nahestehen – aber eben nicht in Tisch- und Bettgemeinschaft als Geliebte. Wenn ich umziehe, werde ich vermutlich ein paar Beziehungen weiterpflegen. Aber so richtig ankommen werde ich im neuen Wohnort erst, wenn ich ganz und gar dort eintauche. Da ist es wichtig, das Alte wirklich hinter sich zu lassen. Dies trifft immer dann zu, wenn es sich um wirkliche Wendepunkte im Leben handelt. Mein »Ja« zum Neuen ist auch ein »Nein« zum Alten. Um wirklich anzukommen, will ich, ja muss ich, das Vorherige hinter mir lassen.
Für den Glauben und die Nachfolge Jesu gilt das ganz besonders. Es fällt auf, dass die gerade Gerufenen jeweils etwas hinter sich lassen. Lesen Sie nur einmal die kurze Passage der Jüngerberufung im Evangelium des Markus (Mk. 1,14-16).
Die Brüder Simon und Andreas hören Jesu Ruf und verlassen daraufhin ihre Netze. Jakobus und Johannes, ebenfalls Brüder, verlassen ihren Vater Zebedäus.
Auf uns wirkt solche Konsequenz nicht nur fremd, sondern sie erscheint vielen von uns geradezu fanatisch. »Übertreib es nicht!«, hat meine Mutter oft zu mir gesagt. Seinen Beruf an den Nagel hängen und nicht mehr Fischer sein, sondern »Menschenfischer« (Lk. 5,10), das war doch nun wirklich übertrieben! Ich vermute, die Reaktionen auf die Konsequenz der Fischer damals ähnelten jenen, denen auch ich mich stellen musste, als ich meinen Beruf als Speditionskaufmann aufgab und in eine theologische Ausbildung ging. Mein Vater meinte, als ich wieder einmal kein Geld für ein neues Auto hatte, dass ich als Speditionskaufmann längst einen flotten BMW fahren würde. Aus seiner Sicht hatte es sich nicht gelohnt, das alles aufzugeben.
Ich sehe das anders. Simon, später Petrus genannt, ganz sicher auch. Wir zwei wissen ja, was man gewinnt, wenn man sein Leben an Jesus Christus hängt. Die Liste jener großartigen Erfahrungen, Dinge und Menschen, die Gott einem sozusagen erstattet, ist viel, viel länger als jenes, was man um der Nachfolge Jesu willen aufgibt (Mt. 19,27).
Interessant: Jesus fordert die Jünger hier nicht direkt auf, dies oder jenes zu verlassen. Dennoch geht es nicht anders. Entweder ihm nachfolgen – oder ...
Ja, oder was, oder? Wir kriegen es doch gut hin, alles zu behalten. Auch wenn wir Christen sind, auch wenn wir uns engagiert für Jesus einsetzen: Wir leben mehr oder weniger geborgen in unseren Familien, gehen unserem mehr oder weniger Traumberuf nach, freuen uns über mehr oder weniger gute Gehälter, leben in meist schönen Wohnungen ... Von wegen, Nachfolge ohne Loslassen geht nicht und ein »Ja« zu Jesus schließt immer auch ein »Nein« mit ein. Unser Umgang mit dem Glauben beweist das Gegenteil. Christsein funktioniert auch ohne Loslassen – oder?
Ich bin vom Gegenteil überzeug: Dem Ruf Jesu zu folgen, bedeutet immer und immer wieder neu auch ein »Nein« zu jenem, was uns davon abhält und uns hindert, konsequent Christ zu sein.
Allerdings geht es jetzt keineswegs um ein Prinzip. Dies mag manchmal so erscheinen. Aus Prinzip muss man alles lassen, was vorher war: Den Beruf, die Familie, die Gewohnheiten, die schönen Dinge des Lebens, die Sicherheiten ... dies wäre sozusagen ein mönchischer Weg. Alles Irdische wird aufgegeben, um Jesus konsequent nachzufolgen.
In den Berufungsgeschichten entdecke ich etwas anderes. Die Gerufenen verlassen zwar alles, um ganz praktisch und damals ja auch physisch mit Jesus zu gehen – aber ganz spezielle Bindungen werden jeweils hervorgehoben.
Simon und Andreas verließen ihre Netze (Mk. 1,18). Auch sie haben sich von ihrer Familie getrennt, um ganz und gar für Jesus da zu sein. Erwähnt wird jedoch nicht ihre Familie, sondern der Beruf. Ihn und ihre Netze und Boote um Jesu Willen hinter sich zu lassen, war ganz offensichtlich ihre besondere und spezielle Herausforderung.
Die Söhne des Zebedäus haben ebenfalls ihre Boote und Netze verlassen. Für sie jedoch war eher das Verlassen ihres Vaters und ihrer Familie mit der gesamten Hofgemeinschaft (Mk. 1,20) die eigentliche Herausforderung.
Es werden also jeweils verschiedene Dinge losgelassen und es geht nicht um einen Generalverzicht aus Prinzip.
Gut wird dies auch in der Geschichte vom »Reichen Jüngling« (Mt. 19,16-22) deutlich. Dieser Mann sucht das Leben in seiner Fülle – aber er ist nicht bereit, seinen Reichtum herzugeben. Sein »wunder Punkt« ist das Geld und sein Besitz. Dies um Jesu willen aufzugeben, ist er nicht willens.
Ich fasse zusammen: Nicht im Prinzip des Loslassens, sondern in der Hinkehr zu Christus liegt das Heil, das Leben. Aber gerade diese Hinkehr bedeutet immer auch die Abkehr von jenem, was mich an der Nachfolge Jesu hindert. Was dies ist, kann man nicht pauschal beantworten, sondern das werden Sie selbst für sich herausfinden müssen. Nein, das wissen Sie jetzt vermutlich bereits sozusagen intuitiv. Jetzt wird es deshalb sehr konkret und bleibt nicht mehr eine bloße Theorie.
✪Stimmt meine Vermutung? Sie wissen oder ahnen bereits, was Sie eigentlich aufgeben müssten ...? Wenn ja, dann sagen Sie Gott im Gebet, was konkret Ihnen einfällt. Und ziehen Sie die Konsequenzen.
Simon, Andreas und manch andere geben ihren Beruf auf. Johannes, Jakobus und unzählige nach ihnen kappen die Abhängigkeit von ihrem Vater und ihrer Familie. Jemand wirft seinen Fernseher aus dem Fenster, ein anderer verkauft sein tolles Auto oder macht keine Flugreisen mehr. Jemand schichtet sein Geld um und investiert es sinnvoll in Hilfsprogramme oder soziale Projekte. Wieder jemand anders gibt eine Beziehung auf oder einen Freundeskreis und widmet sich fortan einem missionarischen Dienst ...
Ihnen allen ist nicht gemeinsam, worum es sich handelt und was sie aufgeben, lassen oder sogar bekämpfen. Gemeinsam ist ihnen, dass ihnen ihr Glaube und der Gehorsam Gott gegenüber wichtiger sind als alles andere.
4. Verweigerung mit Konsequenzen
Wenn jemand sehr wohl weiß, dass jetzt sein »Kairos« ist und er oder sie tun sollten, was dran ist – aber sie tun es nicht, verweigern sich oder kommen nicht zu einer Entscheidung? Was dann? Wenn ich genau weiß, was zu tun und zu machen ist – und setze es nicht um? Wenn Jesus ruft und ich antworte nicht oder sage einfach »Nein!« Was dann?
Dann hat das Konsequenzen:
Konsequenzen für Jesus
Ja, Sie haben richtig gehört. Die Ablehnung seiner Anrede und seiner Einladung in die Gemeinschaft mit Gott hat zuerst und vor allem für ihn selbst Konsequenzen.
Jener besagte »reiche Jüngling« ging damals traurig davon (Mt. 19,22). Er war nicht bereit, sein Leben umzustellen. Und Jesus? Sagt er: »Blödmann, selbst schuld!« Oder: »Er wird schon sehen, was er davon hat.« Mit Sicherheit nicht. Ich bin gewiss, Jesus standen damals genauso wie dem Jungen die Tränen in den Augen. Wie später, als er seine geliebte Stadt Jerusalem anschaut (Lk. 19,41). Er weinte über sie.
Wann immer ich dem Ruf Gottes eine Absage erteile und ihn nicht in mein Leben umsetze, schmerzt es Gott. Die Geschichten von der Suche nach dem Verlorenen (Lk. 15) machen das besonders gut deutlich. Das verlorene Schaf hat, so lange es etwas zu Fressen gibt, vermutlich noch gar nicht gemerkt, dass es verloren ist. Aber der Schäfer hat es gemerkt, läuft über Stock und Stein und leidet am Verlorenen. Dem verlorenen Goldstück ist es sowieso egal, wo es gerade liegt. Es kommt, wie’s kommt. Aber der Frau ist es nicht egal. Dieses Goldstück ist Teil ihres Hochzeitsschmucks und sie weint bis sie es wiederhat. Und der Sohn? Klar, als er bei den Schweinen landet, passt ihm das nicht. Vorher jedoch pfeift er auf seinen Vater und genießt einfach nur sein Leben. Sein Vater jedoch leidet. Ihm ist ein Stück von sich selbst abhandengekommen. Genauso leidet der Vater übrigens auch an dem älteren Sohn, weil der sich nicht mitfreuen konnte, als sein Bruder zurückkam.
Was wir meistens ganz zu Recht grundsätzlich auf die Beziehung zu Jesus Christus anwenden, möchte ich gerne auf jede einzelne Entscheidung im Umgang mit Jesu Herausforderungen erweitern. Immer dann, wenn ich »Nein« sage, tut es ihm nicht nur Leid, sondern richtig weh. Meine Absagen, meine Gleichgültigkeit, meine Trägheit, meine Sturheit gegenüber seinen Herausforderungen bereiten ihm Schmerzen. Sie zeigen ihm, dass er mir nicht wichtig ist, jedenfalls nicht so wichtig wie vieles andere. Sie zeigen ihm, dass er nicht die Nummer eins ist für mich, sondern irgendwo unter ferner liefen kommt. Und das schmerzt ihn. Wieder ein Schlag ins liebende Gesicht Gottes, wieder ein »kreuzige« und »weg mit ihm!« Mag sein, dass Sie dies überzogen finden – aber ich glaube wirklich, dass Gott mit Ihnen und mir eine ganze Menge auszuhalten hat. Und aushält.
Das ist ja das Wunder des Evangeliums. Jesus hält durch. Und wenn er dafür sterben muss. Er gibt mich nicht auf. Immer wieder geht er das Risiko ein, ein »Nein« zu bekommen. Er hört nicht auf zu rufen, zu werben, einzuladen und Freiräume des »Kairos« zu schaffen.
Ich weiß, vielleicht ist es auch einmal zu spät. Dies ist ja in der Zeitkategorie »Kairos« enthalten. Aber so lange Jesus redet und Momente und Situationen sich ereignen, die mich herausfordern, ist es noch nicht zu spät – jedenfalls nicht für jene, die solche Momente erleben.
Konsequenzen für Verweigerer
Der reiche Jüngling weinte. Er hat es also gespürt: Sein Geld und sein Besitz haben ihn voll im Griff wie eine Droge. Er schafft es nicht, davon loszukommen und das macht ihn traurig. Dabei hat er wahrscheinlich noch nicht einmal die Dimension seines Problems begriffen. Er hat sich ja nicht nur gegen einen Rabbi entschieden. Er hat sich gegen den entschieden, der ihm wirklich das Leben geben kann, ja der das Leben selber ist. Er hat sich gegen den Sieger über den Tod entschieden und seinen irdischen Reichtum dem ewigen vorgezogen.
Die Tragweite unserer Entscheidungen gegen Christus sehen wir selten. Auch für einzelne Herausforderungen, denen wir uns nicht stellen, gilt dies.
Es ist meistens müßig zu fragen: »Was wäre, wenn ...«?
Aber vielleicht hilft es doch manchmal, die Reichweite unseres Handelns- oder eben Nichthandelns zu erahnen. Wenn etwa meine Freunde damals den Leuten an jener Fabrikmauer diese Bananen nicht gekauft hätten – die Colonie Serapaka gäbe es heute nicht und diese Familien vielleicht auch nicht mehr ... Wenn ehrenamtlich Mitarbeitende 1985 im Pfingstcamp Hanstedt das Projekt »Teachers for Tribals« nicht begonnen hätten, wären später auch nicht tausende Kinder in indischen Kinderheimen für eine bessere Zukunft vorbereitet worden.
✪Überlegen Sie doch einmal: Welche Wirkungen hatte es in Ihrem Umfeld, weil jemand oder eine Gruppe eine Herausforderung Jesu angenommen hat – und was würde heute fehlen, wenn dies nicht geschehen wäre?
Diese Einsicht umzukehren lässt ahnen, was alles nicht passiert ist – und doch hätte geschehen können, wenn wir dem Ruf Jesu gefolgt wären. Es hat also Konsequenzen, wie wir mit der Anrede Jesu umgehen. Viel Segen geht verloren, Kräfte und Ressourcen werden verschwendet, Gaben liegen brach, Chancen werden nicht genutzt, Ziele können weder gefunden noch erreicht werden ... und so geht es weiter. Gott allein weiß, was wir alles verpasst haben, weil wir uns seinen Herausforderungen nicht gestellt haben.
Von Auswirkungen auf die Ewigkeit muss ich also gar nicht sprechen, wenn es um Konsequenzen unseres »Nein« geht. Die biblischen Zeugen sind da allerdings nicht so zurückhaltend wie ich. Sie zeigen immer wieder auf, dass wir ohne Christus tatsächlich verloren sind (z.B. Joh. 3,36).
Ich halte mich allerdings gerne aus mehreren Gründen zurück, die ewige Verlorenheit detailliert zu betonen:
Es ist Gottes Sache, über ewige Verlorenheit oder gar Verdammnis zu befinden – und meine Hoffnung ist, dass wir durch Christus am Ende alle gerettet werden.
Ebenso allein Gottes Sache ist es, zu bestimmen, wann es zu spät ist. Da haben wir Menschen schon oft daneben gelegen und gemeint, nun gäbe es keine neue Chance mehr und Gott sei mit seiner Geduld am Ende. Gott aber hatte Geduld.
Vom Verlorengehen zu reden, baut Ängste auf. Es kann bei psychisch labilen Menschen bis hin zur Psychose führen. Mag in der Vergangenheit solch »schwarze Pädagogik« auch zur Verkündigung gehört haben, für heute und für mich passt sie nicht zum Evangelium der Freiheit.
Wann immer vom »Gericht« Gottes im Neuen Testament die Rede ist, will Jesus und wollen die Autoren damit ihre Adressaten zur Umkehr bewegen, also retten. Es geht folglich nicht um das Festschreiben eines Urteils für die Ewigkeit.
Im »Endgericht« wird alles zu Recht gebracht, also gerichtet (wie beim Richt-Fest kommt alles ins Lot!). Folglich geht es nicht um Hinrichtung oder ewige Strafe. Die hat Jesus für uns durchlitten und getragen.
Ich erlebe, dass Freude und Dankbarkeit für empfangenen Segen ein viel stärkere und nachhaltigere Motivation zur Nachfolge Jesu und zum Handeln sind als Angst und Pflichtgefühl.