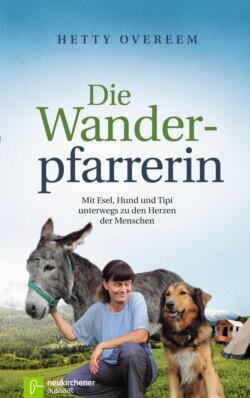Читать книгу Die Wanderpfarrerin - Hetty Overeem - Страница 18
ОглавлениеKAPITEL 10
ROVÉRÉAZ
Chantal kam vor einigen Wochenenden zu Besuch und fragte, ob sie die Strecke nach Lausanne mit mir gehen dürfe. Nun ziehen wir von Les Monts de Pully zusammen Richtung Rovéréaz. Es ist nicht weit, nur drei bis vier Kilometer. So brauchen wir uns nicht zu beeilen und haben viel Zeit zum Reden. Voraussichtlich werden wir schon in zwei Stunden in Rovéréaz, einem Stadtteil von Lausanne, ankommen. Hier hat ein Bauer von Lausanne, Jean-Luc Chollet, eine Wiese, wo wir mehr als willkommen sind.
Die Rechnung »schon in zwei Stunden« ist allerdings ohne den Wirt Speedy gemacht. Mein Esel geht zwar willig auf unserem ausgesuchten Waldweg mit, aber bei der Kreuzung mit einem klitzekleinen Bächlein entscheidet er sich, dass er hier vor einem äußerst gefährlichen wilden Strom steht. Und hält an. Und hält an. Und … na ja, und so weiter. Chantal und ich ziehen, locken, schieben, versuchen zu überzeugen, nehmen sogar die legendäre Karotte zu Hilfe, müssen aber feststellen, dass es sich in der Tat nur um eine Legende handelt.
Wer mit einem Esel wandert, muss wissen, wann er weichen muss. So gehen wir denselben Weg wieder zurück, suchen und finden auf der Karte eine Alternative. Aber wie gut die Alternative auch auf der Karte aussehen mochte, sie entpuppt sich als Sackgasse. Nun stehen wir auf einem Hügel mit schönster Aussicht auf die Straße, die in der Tat zur Chollet-Wiese führt, aber eben tief unter uns. Speedy klappert freudig mit den Ohren, Barou schnuppert nach Hasen, Chantal und ich inspizieren noch mal, aber fruchtlos unsere Karte. Kann man nichts machen. Also wieder zurück und dann eben an der großen Straße entlang, auch wenn das nicht ungefährlich ist.
Glücklicherweise gibt es einen, wenn auch schmalen, Fußgängerweg. Hier zeigt sich Speedy aber versöhnungsbereit. Willig quetscht er sich durch die Dornsträucher links und die Barriere rechts hindurch. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos hupt: Es ist Stef, der uns mit einem breiten Grinsen zuwinkt.
Nach insgesamt fünf Stunden stehe ich nun endlich auf der Wiese. Die Fenster der umliegenden Hochhäuser sehen mich wie unzählige Augen an: Hier kann ich nicht vom Klo aus die Aussicht genießen.
Es ist ein Wochenende voller Sonnenschein, voller Leute, voller Kinder. Und vor allem, »voll« Florian. Florian ist ein achtjähriger Junge, der gleich neugierig gucken kommt und danach nur noch widerwillig zum Schlafen nach Hause geht, so fasziniert ist er. Von den beiden Tieren. Vom Zelt. Vom Eselwagen. Aber auch – und das ist so schön und tut so gut – von den Tipi-Treffen. Er sitzt da, und alles an ihm ist offen: Ohren, Augen, Herz. Bei meiner Einladung »Hör mal, Florian, jetzt fängt das Tipi-Treffen an. Wenn du lieber nicht willst, kommst du einfach später wieder zurück, aber du kannst auch gerne bleiben« guckt er mich groß an und fragt: »Darf ich bitte bleiben? Ich möchte so gerne bleiben!«
Ich seufze tief und freudig. Nun ist es mal nicht das obligatorische »Je suis croyant mais pas pratiquant« – »Ich bin gläubig, aber gehe nicht zur Kirche«. Ich verstehe das zwar; die Formen des offiziellen Sonntagsgottesdienstes sind nicht unbedingt für jeden verlockend. Aber es wimmelt in diesem Kanton doch von Alternativen: Bibel-, Austausch-, Studien- und Lerngruppen, Alphakurse …
Ich habe das Gefühl, auch Gott seufzt tief und freudig bei diesem kindlichen »Ich möchte so gerne bleiben«.
Florian bleibt nicht allein. Schon bald nimmt er seinen Freund Benjamin, dann andere Kumpels mit. »Ich hab ihnen vom Tipi erzählt, und sie waren alle neugierig!« So mache ich an diesem Wochenende kein einziges Tipi-Treffen alleine. Immer sitzen fünf bis sechs Kinder im Zelt, die zuhören, Kommentare abgeben und mitjubeln. Wow! Was für eine tolle Herausforderung, das Evangelium so zu sagen, dass keiner ausgeschlossen ist, dass jeder es verstehen und sich angesprochen fühlen kann.
Das scheint übrigens ein Problem des »normalen Gottesdienstes« zu sein. So oft sagen mir Menschen: »Ich hab’s echt versucht, aber ich verstehe den Pfarrer einfach nicht.« Florian und seine Freunde stellen Fragen, nicken, wenn sie etwas verstehen, freuen sich, sagen auch, wenn sie etwas nicht verstehen, lachen über Ungereimtheiten, runzeln die Stirn, wenn es etwas komplexer wird, fassen dann manchmal in einem klaren Satz zusammen, was ich etwas lange und mühsam versucht habe zu erklären. Sie segeln fröhlich durch Gottes spannendes Königreich hindurch, um etwas später ihre Eltern mitzubringen. Diese gucken zuerst leicht skeptisch, aber Florians Eltern winken mir zu: »Er redet über nichts anderes mehr, da müssen wir doch selber mal zu Besuch kommen!« Und dann sind Eltern und Kinder, Erwachsene und Kleine, zusammen: ein Geschenk.
Am Sonntag verlasse ich ausnahmsweise mein Zelt, um zusammen mit einer Kollegin vom naheliegenden Universitätskrankenhaus den Gottesdienst zu halten. EEC hatte gefragt, ob wir im Krankenhausgelände selbst stehen dürften; vor allem die Kinder, so dachten wir uns, hätten sicher viel Freude an Tipi, Esel, Eselwagen und Hund. Aber Direktion und Kollegen waren nicht einstimmig begeistert gewesen, und so waren wir auf Jean-Luc Chollets Wiese gelandet. Die Kollegin bat mich dann aber, zusammen einen Bittgottesdienst um Heilung vorzubereiten.
Das Wort klingt für einige vielleicht komisch, so als wenn man das vorprogrammieren könnte: Da wird geheilt! Es handelt sich aber eher »nur« um Fürbitte. Nur?
Die reformierte Kirche vom Kanton Vaud war skeptisch hinsichtlich Gebete für Kranke im Gottesdienst. Aber seit den Konferenzen eines schweizerischen Theologieprofessors, Walter Hollenweger, war es, sagen wir, politisch korrekt geworden, im Gottesdienst konkret für kranke, traurige, müde Leute zu bitten. Und nicht nur, dass »Frau X oder Herr Y seine Krankheit in Frieden tragen könne«. Es wehte ein frischer Wind, sodass man sogar dafür beten »durfte«, dass Gott diesen Menschen tatsächlich heile. Nicht magisch. Nicht durch die »richtigen« Worte. Nicht unbedingt jetzt gleich an Ort und Stelle. Nicht indem man Gott dazu zwingen oder den Menschen zu einem künstlichen Glauben hochwinden wollte, als ob seine Heilung vor allem von seiner eigenen Glaubensleistung abhinge.
Aber mit einem echten Vertrauen, dass Gott in Jesus Christus heutzutage noch heilen will und heilen kann, auch wenn dies die Frage »Warum aber mich nicht?« nur umso dringender stellt.
Ein Bittgottesdienst um Heilung ist also heute für mich angesagt, mitten im riesigen Kantonskrankenhaus. Meine Kollegin, Virginie, wartet schon, das Abendmahl ist vorbereitet, das Salböl auch.
Salböl – noch so etwas. Zwar biblisch, aber für viele leicht verdächtig. Und es ist ja auch gut, dass man nicht alles kritiklos ausprobiert. Doch vor allem wir Reformierte sind so vorsichtig und alles muss so ausführlich diskutiert und analysiert, in dafür offiziell geschaffenen Gremien und Arbeitsgruppen bearbeitet und kommentiert und in Arbeitspapiere zusammengefasst, den kirchlichen Autoritäten präsentiert und von diesen ernsthaft geprüft und korrigiert und neu den Arbeitsgruppen delegiert werden, dass die einfache Handlung darin zu ertrinken droht. Dabei sehe ich, wie gut es den Leuten tut. Brot und Wein spürt man nicht mehr, wenn man sie einmal zu sich genommen hat. Segen trägt man mit sich mit nach Hause, Worte können haften bleiben. Aber der Geruch von einem schön duftenden Öl, der stundenlang anhält, erlaubt manchmal ein anderes Bild von Gott: Es erlaubt ein Gefühl von Schönheit, von Wichtigsein, von etwas Leichtem, Fröhlichem, ja, Zärtlichem. Und das bedeutet nicht wenig für Menschen, die vielleicht zu lange und zu fasziniert die kalten Kalkulatorgottesbilder in ihrer persönlichen Galerie betrachtet haben.
In diesem Gottesdienst sehe ich zum ersten Mal eine Frau, von der Bernard mir erzählt hat: Sœur (»Schwester«) Gabrielle de Grandchamp. Sie hat sich von Anfang an sehr für EEC interessiert und bedauert, dass sie selber nicht zum Tipi kommen kann: Sie sitzt in einem Rollstuhl und hat eine schwere Kopfoperation vor sich. Ich reiche ihr das Brot und den Wein, sie sagt: »Ich bin’s, Sœur Gabrielle!« Wir sehen uns an, und in diesem Augenblick entsteht eine Freundschaft.
»Möchtest du die Salbung?«
»Ja, gern!«
Wie toll wäre es gewesen, Herr, wenn ich jetzt erzählen könnte, dass während dieses Gottesdienstes Kranke geheilt wurden. Zu meiner eigenen Glorie? Ach, das spielt leider bestimmt mit, wir Menschen wollen so gerne wichtig sein. Aber doch auch wirklich zu deiner Ehre. Wenn die Menschen sehen würden, wer und wie du bist …
Nein, an diesem Tag gibt es keine sofortige Heilung. Kein außerordentliches Zeichen der Gegenwart Gottes. »Nur« fröhlich guckende Menschen, nur eine Sœur Gabrielle, die mir später erzählt, sie habe Kraft bekommen, um der Zukunft inklusive gefährlicher Operation vertrauensvoll entgegenzusehen.
Ich weiß noch, dass ich dachte: Das ist ja sehr schön, aber … nichts imVergleich zu einer echten Heilung. Und darum hatte ich ja schließlich gebetet, von ganzem Herzen, und Sœur Gabrielle wäre bereit gewesen, von Gott zu empfangen, was er ihr zugedacht hätte.
Dann denke ich: Okay. Ich geb’s in deine Hand. Du weißt, was du tust. Und meinAnteil ist es, genau das anzunehmen: dass du, Herr, ihr gegeben hast, was du ihr zugedacht hast.
Zurück zum Tipi, wo Florian sich auf mich stürzt. »Ich habe so gut auf Speedy aufgepasst und allen Besuchern von dir erzählt, und sie waren so interessiert!« Sein ganzes Gesicht strahlt. Er zeigt auf andere, neue Freunde. »Die hab ich mitgenommen zum Tipi-Treffen um 13 Uhr. Ich hab ihnen gesagt, es sei so cool! Dann wollten sie mit, les copains, die Kumpels!«
Und nochmals denke ich mir: Wenn doch nur alle Christen so freudig Reklamemachen würden.Nicht als Erstes für den Gottesdienst, obwohl das ja ein tolles Zeichen wäre für die Herzlichkeit, mit der eine Gemeinde Außenstehende empfangen würde und dann auch ihre Formen anpassen könnte. Sondern für das Evangelium, die wirklich frohe Neuigkeit von einem Gott, der sich zutiefst auf ein Treffen mit jedem einzelnen Menschenkind freut. Ein Treffen, das er vorbereitet, wofür er sich Strategien ausdenkt, wofür er bereit ist, sich wie Speedy in schmale und sogar dornige Wege hineinzuquetschen.
Viele Papiere habe ich gelesen zum Thema »Evangelisation heute«, an Gruppen und Diskussionsabenden habe ich teilgenommen und viele bestimmt richtige Sachen gehört. Aber eines hat mir immer gefehlt: das einfache Zugeständnis, dass kein noch so gelungenes Papier, keine noch so tolle Strategie denselben Effekt haben wird wie dieser Satz, der ja schon (okay, mit anderen Worten, aber bestimmt mit derselben Begeisterung) den skeptischen Nathanael (Johannes 1,47) überzeugte: »Ich hab gesagt, er sei so cool!«
Dann wollen Kumpels vielleicht sogar mit …