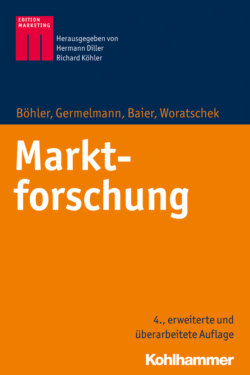Читать книгу Marktforschung - Heymo Böhler - Страница 19
2.1.3 Formulierung des Marktforschungsproblems
ОглавлениеDas Marktforschungsproblem ist hinreichend formuliert, wenn das Forschungsziel und der Informationsbedarf nach »Art, Qualität und Ausmaß« (Hammann und Erichson 2006, S. 53 ff.) festgelegt sind. Oft handelt es sich dabei um eine bloße Wiederholung des Marketing-Entscheidungsproblems. Besteht z. B. das Entscheidungsproblem in der Wahl zwischen zwei Neuproduktvorschlägen, so lautet das Marktforschungsproblem »Bewertung alternativer Neuproduktvorschläge«. Nicht selten liegen aber komplexere Entscheidungsprobleme vor. Wurde z. B. innerhalb der Problementdeckung und -präzisierung festgestellt, dass das alte Produkt sich in der Degenerationsphase seines Lebenszyklus befindet, so können mehrere Forschungsziele und umfangreiche Informationsbedürfnisse in die Formulierung des Marktforschungsproblems aufgenommen werden.
Die Liste der Forschungsziele beginnt z. B. mit dem Ziel, Marktnischen aufzuspüren, deren Aufnahmefähigkeit festzustellen sowie Anregungen für die Produktgestaltung zu liefern, und endet damit, dass Neuproduktalternativen sowie Werbekampagnen und verschiedene Preishöhen zu bewerten sind.
Die soeben skizzierte Aufgabe, dass am Anfang eines Marktforschungsprozesses eine präzise Formulierung des Marketing-Entscheidungs- und des Marktforschungsproblems zu erstellen sei, wird in der Wissenschaftstheorie unter dem Begriff der Hypothesenformulierung diskutiert. Da die dort aufgestellten Prinzipien zur Hypothesenformulierung von höchster Bedeutung für die Definition von Marktforschungsproblemen sind, ist in aller Kürze darauf einzugehen.
Hypothesen lassen sich gewissermaßen als Forschungsziele betrachten, die in die Form einer Behauptung gekleidet sind. Ein typisches Beispiel sind »Wenn-Dann-Aussagen« der Art »Wenn das Werbebudget um 10 % erhöht wird, dann steigt im gleichen Zeitraum der Marktanteil um 1 %«.
Die Wissenschaftstheorie stellt nun inhaltliche und formale Anforderungen an die Hypothesenformulierung und -überprüfung, die sicherstellen sollen, dass die aufgestellten Behauptungen in intersubjektiv befriedigender Weise nachgeprüft werden können. Was die Hypotheseninhalte anbelangt, so trifft man immer wieder die Forderung, dass »Wenn-Dann-Aussagen« aufzustellen sind, da nur hierdurch die Erklärung, Prognose und damit die Unterstützung von Entscheidungen möglich ist. Letztlich wird also die Formulierung und Überprüfung von Hypothesen über Ursache-Wirkungsverhältnisse gefordert. Zwischen diesen Forderungen der Wissenschaftstheorie und der Realität der Forschungspraxis klafft jedoch eine erhebliche Lücke:
Die verfügbaren Mittel, die Beschaffenheit der Daten und die technische Ausstattung des Forschers erlauben nicht immer die Aufstellung und experimentelle Überprüfung von Kausalhypothesen. Oftmals sind diese Behauptungen nur durch deskriptive Designs, d. h. durch die statistische Analyse von korrelativen Beziehungen überprüfbar. Daneben interessieren in der Marktforschungspraxis nicht nur Beziehungen zwischen Merkmalen. Recht häufig werden auch »deskriptive Hypothesen« formuliert, die sich auf die Ausprägungen eines einzelnen oder auch mehrerer Merkmale beziehen. Dies ist z. B. der Fall, wenn es um die Beschreibung von Markttatbeständen geht, etwa wenn die demographischen, sozioökonomischen und psychologischen Merkmalsausprägungen von Käufern zu erheben sind, oder wenn die Höhe des Marktvolumens ermittelt werden soll.
Noch weiter vom wissenschaftstheoretischen Forschungsideal des kritischen Rationalismus entfernt befindet man sich, wenn das Entscheidungsproblem nur sehr vage bekannt ist. Hier dient die explorative Forschung ja erst dem Zweck der Hypothesenfindung. Was vom wissenschaftstheoretischen Forschungsideal für die Formulierung des Marktforschungsproblems übrig bleibt, ist somit die Forderung, dass nach Abschluss der explorativen Phase von deskriptiven oder kausalen Hypothesen auszugehen ist. Denn unpräzise oder fehlende Hypothesen verhindern nicht nur die angemessene statistische Überprüfung der Ergebnisse, sie ermöglichen zugleich jedwede Manipulation durch den Forscher. Dies ist insbesondere der Fall, wenn zuerst alle möglichen Analysen durchgeführt werden, bis man halbwegs »plausible« und »signifikante« Ergebnisse gefunden hat. Für diese Ergebnisse werden dann nur noch die bereits »bestätigten« Hypothesen gesucht. Diese Vorgehensweise wird in der Forschung als HARKing bezeichnet (hypothesizing after results are known). Dabei führen vor allem das Cherry- Picking (die gezielte Auswahl von Datensätzen und Messinstrumenten, die besonders vielversprechend für die Bestätigung einer Hypothese erscheinen) und das Question Trolling (die Suche in den Daten nach Konstrukten, Messinstrumenten und Zusammenhängen, aus denen sich bestätigbare und möglicherweise publizierbare Hypothesen ableiten lassen) zu besonders starken Verzerrungen der Glaubwürdigkeit von Forschungsergebnissen (Murphy und Aguinis 2019).
Sind das Marktforschungsproblem und die damit einhergehenden Hypothesen formuliert, so ist nun zu entscheiden, ob und in welchem Umfang der festgestellte Informationsbedarf durch die Marktforschung zu befriedigen ist.