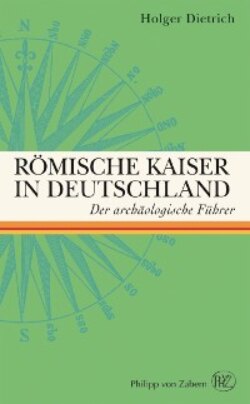Читать книгу Römische Kaiser in Deutschland - Holger Dietrich - Страница 11
Kaiser Tiberius und die Feldzüge der augusteischen Zeit
ОглавлениеAls Statthalter der Provinz Gallien ist in den Jahren 38/39 und 19 v. Chr. Marcus Vipsanius Agrippa bezeugt. Die politische Lage hatte sich zwischen beiden Statthalterschaften insofern geändert, als Octavius, der Adoptivsohn Caesars, sich in langen Bürgerkriegen gegen seinen Widersacher Marcus Antonius als Alleinherrscher durchgesetzt hatte und nun unter dem Ehrentitel Augustus der erste Mann im Reich war. An der persönlichen Nähe zwischen Augustus und seinem Feldherrn hatte sich nichts geändert, und so ging Agrippa daran, ausgestattet mit allen Vollmachten und damit gewissermaßen Mitregent, darüber hinaus Schwiegersohn des Kaisers, die Rheingrenze zu sichern. Dazu versicherte er sich, wo es ging, der Unterstützung germanischer Stämme und siedelte unter anderem die Ubier, zu denen bereits Caesar freundschaftliche Beziehungen gepflegt hatte, und möglicherweise auch die Bataver am linken Rheinufer an.
Indizien deuten darauf hin, dass auch die rechts des Rheins verbliebenen Chatten und Sugambrer vertraglich in ein Sicherheitssystem mit einbezogen werden sollten. Diese Maßnahmen richteten sich vorwiegend gegen die von der Elbe bis zum Rhein siedelnden Sueben, deren westwärts gewandtes Streben schon Caesar in seinen Kommentaren zum Gallischen Krieg beschrieben hatte.
In diese Zeit fallen auch die bis jetzt ältesten nachgewiesenen archäologischen Reste römischer Truppenlager am Niederrhein. Dabei handelt es sich zum einen um das Lager Noviomagus, heute Nijmegen an der deutsch-niederländischen Grenze und zum anderen um das Lager bei Neuss, an der Einmündung der Erft in den Rhein. Im Verbund mit den links des Rheins angesiedelten Ubiern und Batavern übernahmen diese Lager wichtige Kontrollfunktionen gegenüber den Germanen. Wie unter Caesar ist hier die römische Strategie zu beobachten, einerseits mit eigener Truppenpräsenz, andererseits mit der Ansiedlung fremder und vermeintlich loyaler Stämme das Vorfeld Galliens unter Kontrolle zu halten.
Der Auslöser für weitreichende Aktionen rechts des Rheins war die Niederlage des römischen Feldherrn Lollius im Jahr 16 oder 15 v. Chr. Die Vernichtung einer ganzen Legion durch die Sugambrer, Usipeter und Tenkterer führte offenbar dazu, dass sich Augustus selbst zum Eingreifen in Gallien gezwungen sah. Sein Aufenthalt ist dort für die Jahre 16 bis 13 v. Chr. bezeugt. Neben einer Neuordnung der Verwaltungsstruktur Galliens mit der Zusammenfassung der Provinzen Aquitania, Belgica und Lugdunensis zu den Tres Galliae und der Installation der Stadt Lyon/Lugdunum als deren politischen sowie kultischen Mittelpunkt rückten Legionen und Hilfstruppen in Standlager am Rhein vor. Es handelte sich dabei um die Lager Noviomagus/Nijmwegen, Xanten/Vetera, Moers-Asberg/Asciburgium, Neuss/Novaesium und Mainz/Mogontiacum. Für nunmehr 6 Legionen bildete der Rhein die Operationsbasis.
Gleichzeitig besetzten römische Truppen die Alpenpässe und das Alpenvorland: Drusus zog mit seiner Truppenmacht 15 v. Chr. von Aquileia kommend das Etschtal aufwärts und vereinigte sich mit den Truppen des Tiberius, der von Besançon/Vesantio über Kaiseraugst/Augusta Raurica nach Osten gezogen war und dabei wohl auch die Donauquellen passierte. Aus Anlass der Siege über die Raeter und Vindelicer errichtete man 7/6 v. Chr. bei La Turbie zu Ehren des Augustus ein Ehrendenkmal. Ebenfalls 15 v. Chr. befand sich Noricum bis zur Donau unter römischer Kontrolle. Harter Widerstand in Pannonien erforderte dort 13 v. Chr. die persönliche Anwesenheit des Agrippa. Nach dessen plötzlichem Tod im darauffolgenden Jahr wurde Tiberius mit dem Kommando betraut. Allerdings ist zwischen den Alpenfeldzügen und den Operationen im Norden keine direkte Verbindung festzustellen, offenbar war die Sicherung der Alpenpässe und des Alpenvorlandes als Verbindungsweg von West nach Ost schon seit längerer Zeit geplant.
Im Jahr 12 v. Chr. begann unter Drusus eine römische Offensive. Die Marschwege der Römer orientierten sich an den Flussläufen von Main und Lippe. An der Nordsee stach eine Flotte in See, die allerdings auf dem Rückweg in die Winterlager auf Grund lief. Im Jahr darauf drangen die Römer bis an die Weser vor, zogen sich aber aufgrund von Nachschubproblemen wieder zurück. Zwei Jahre später, 9 v. Chr., stieß das römische Heer unter Drusus bis zur Elbe vor. Dabei berührte das Heer vermutlich den Stützpunkt bei Hedemünden an der Oberweser. Auf dem Rückweg stürzte jedoch am 14. September der beliebte Feldherr vom Pferd und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu, an denen er kurz darauf verstarb. Sein herbeigeeilter Bruder Tiberius konnte Drusus noch lebend antreffen, übernahm das Kommando über die Truppen und führte diese nach Mainz zurück. Die Quellen berichten übereinstimmend, dass es Tiberius in der folgenden Zeit gelang, die Lage in Germanien zu konsolidieren.
Auf diese Zeit bezieht sich der viel zitierte Passus bei Velleius Paterculus, dem Hofberichterstatter des Tiberius:
„Er [Tiberius, d. Verf.] unterwarf Germanien so vollständig, dass er es fast zu einer steuerpflichtigen Provinz machte.“
(Velleius Paterculus 2, 97, 4; übers. Marion Giebel)
Die Aussagen des antiken Schriftstellers führen ins Zentrum einer Diskussion, die seit Jahrzehnten in der Forschung geführt wird: Zielte die römische Politik rechts des Rheins darauf ab, das freie Germanien als regelrechte Provinz einzurichten und wenn ja, wie weit war dieser Prozess zu Beginn des ersten nachchristlichen Jahrhunderts vorangeschritten? Oder sind die Angaben in den Quellen und die archäologischen Befunde eher dahingehend zu verstehen, dass die Römer mit ihren weit in germanisches Gebiet geführten Vorstößen lediglich das Vorfeld Galliens sichern und römische Macht demonstrieren wollten, wobei die Überführung des Gebietes in eine Provinz zu diesem Zeitpunkt keinesfalls angedacht war? Waren die beachtlichen Vorstöße bis an die Elbe sogar nur Ausdruck persönlichen Prestigestrebens der beteiligten Feldherren? Gerade das letzte Motiv, die persönliche Disposition der Handelnden in Verbund mit deren politischen Ambitionen darf in der römischen Geschichte nicht unterbewertet werden. Militärische Erfolge waren stets das beste Triebmittel für die Karriere.
Ein Nebeneffekt darf zudem nicht außer Acht gelassen werden: Die Feldzüge und Flottenmanöver tief in rechtsrheinischem Gebiet sorgten für eine immense Erweiterung des geografischen Wissens der Römer über die betroffenen Gebiete, was besonders in den Schriften Strabons deutlich wird, die gegenüber den manchmal recht vagen Angaben bei Caesar weitaus differenzierter das erweiterte Wissen der Zeit widergeben.
Ob nun das römische Vorgehen in Germanien von vorneherein auf das Ziel ausgerichtet war, das Gebiet jenseits des Rheins bis zur Elbe zu einer römischen Provinz zu machen und wenn ja, wie weit man dabei fortgeschritten war, scheint angesichts der Varusniederlage und der daraus resultierenden Kehrtwendung zu einer ausdrücklich defensiven und auf Bewahrung des Erreichten bedachten Strategie obsolet. Das Wort Provinz wird in den römischen Quellen jedenfalls nicht für eine Beschreibung des Ist-Zustandes verwendet, und das ist gerade an solchen Stellen von hoher Aussagekraft, an denen es durchaus angebracht gewesen wäre, auf den Provinzstatus hinzuweisen, wenn er denn existiert hätte. Festzuhalten bleibt: Germanien besaß nicht den Status einer Provinz, unterstand aber immerhin römischer Kontrolle; die römische Staatsmacht betrachtete sich dezidiert als Ordnungsmacht, deren Einfluss bis zur Elbe reichte.
Tiberius jedenfalls feierte am 1. Januar 7 v. Chr. in Rom einen großartigen Triumph, die sakrale Stadtgrenze Roms erfuhr als Zeichen für die Ausdehnung der römischen Herrschaft eine Erweiterung und dazu wurden die Erfolge in der Münzpropaganda gefeiert. Die römische Öffentlichkeit musste Tiberius durchaus als militärisch kompetenten Führer und möglichen Nachfolger des Augustus wahrnehmen.
Bemerkenswert ist der archäologische Befund des Truppenlagers Oberaden im Mündungsgebiet von Seseke und Lippe. Die Errichtung des Lagers fällt aufgrund der Ergebnisse dendrochronologischer Untersuchungen an den Hölzern der Holz-Erde-Mauer in das Jahr 11 v. Chr. und liegt demnach in der zeitlichen Abfolge des Drusus-Feldzuges. Doch bereits wenige Jahre später wurde das Lager aufgegeben, die Bauten niedergebrannt und die Brunnen vergiftet. Offenbar waren die römischen Soldaten selbst die Urheber der Zerstörungen. In derselben Zeit wurden andere rechts des Rheins befindliche Lager aufgegeben, wie die Nachschubbasis Rödgen bei Bad Nauheim oder das rechts des Hochrheins gelegene Legionslager Dangstetten.
Über die Alpenpässe und die Verbindung durch das Rhônetal über Lyon war der Nachschub für die am Rhein stationierten Truppen gesichert. Römisches Militär kontrollierte das Alpenvorland und den Rhein. Vielfach wurde argumentiert, die Aufgabe der Lager von Oberaden, Rödgen und Dangstetten erfolgte zugunsten der defensiveren Anlage der Lager bei Haltern, Bad Nauheim oder, im Falle von Dangstetten, Windisch/Vindonissa. Gerade Haltern dürfte aufgrund der Fundsituation weitaus mehr gewesen sein als ein mögliches Rückzugslager. Und nicht vergessen werden darf in diesem Zusammenhang die Existenz des Lagers Anreppen an den Lippequellen, ganz zu schweigen von vielleicht noch nicht entdeckten Fundplätzen dieser Zeitstellung in Germanien.
DAS LAGER OBERADEN
Das Lager wies einen unregelmäßigen, weil an die Geländegegebenheiten angepassten Umriss auf und umschloss eine Fläche von rund 56 ha. Hinter einem 5 m breiten und 3 m tiefen Spitzgraben erhob sich eine etwa 3 m breite Holz-Erde-Mauer, für deren Bau schätzungsweise 9.000 bis 25.000 Holzstämme erforderlich waren. Entgegen dem unregelmäßigen Umriss war das Lagerinnere regelmäßig bebaut. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich in der Lagermitte nicht etwa die Stabsgebäude befanden, was zu erwarten gewesen wäre, sondern ein Bau, der durch den Vergleich mit der Situation in Anreppen und Haltern als Praetorium interpretiert wurde. Die Errichtung der Kommandeurswohnung am prominentesten Ort des Lagers lässt an die Anwesenheit einer hochgestellten Persönlichkeit denken. Darüber, ob Drusus hier lebte, kann aber nur spekuliert werden. Die Stabsgebäude konnten inzwischen an anderer Stelle nachgewiesen werden. Auch die Ausmaße der Stabsgebäude übertreffen diejenigen anderer Lager um einiges. Sicher werden in Oberaden zwei Legionen untergebracht gewesen sein. Interessante Ergebnisse brachte auch die Untersuchung der Fäkalien aus dem Lager: Neben einheimischen Nahrungsmitteln wie Weizen, Hirse, Linsen, Äpfel oder Beerenfrüchten wurden auch die Reste aus dem Süden importierter Nahrungsmittel gefunden. Darunter befanden sich Oliven, Feigen, Trauben, Mandeln, Koriander und Pfeffer. Das 11 v. Chr. errichtete Lager könnte durchaus mit dem bei Cassius Dio (54, 33, 4) erwähnten Bollwerk identisch sein, dass „am Zusammenfluss von Lippe und Elison“ angelegt wurde. Das Lager wurde um 8/7 v. Chr. von den Römern verlassen. Dabei sind die Gebäude niedergebrannt und die Brunnen offenbar absichtlich von den Römern vergiftet worden, wie der Fund von Fäkalienresten und Tierkadavern in den Brunnen nahelegt, da diese nur von römischen Soldaten stammen können. Das Lager wurde folglich bewusst unbrauchbar gemacht.
Im Gebiet des ehemaligen Lagers befindet sich ein historischer Lehrpfad, Auskünfte erteilt das Stadtmuseum Bergkamen, Jahnstr. 31/Museumsplatz, 59192 Bergkamen-Oberaden.
Die nächste bemerkenswerte Nachricht stammt aus der Zeit um Christi Geburt. Lucius Domitius Ahenobarbus, Großvater des späteren Kaisers Nero, hatte auf seinem Feldzug in Germanien die Elbe überschritten. Er wies den Hermunduren neue Siedlungsplätze zu, möglicherweise handelte es sich dabei um Gebiete, aus denen in den Jahren zuvor die Markomannen nach Südwesten in Richtung des heutigen Böhmen umgesiedelt worden waren. Im selben Jahr brach ein gewaltiger Krieg (immensum bellum) in Germanien aus, in den ab 4 n. Chr. der aus dem Exil zurückgekehrte und mittlerweile offiziell zum Thronfolger erklärte Tiberius eingriff. Er wandte sich zunächst gegen die aufständischen Cherusker und gelangte im folgenden Jahr an die Elbe.