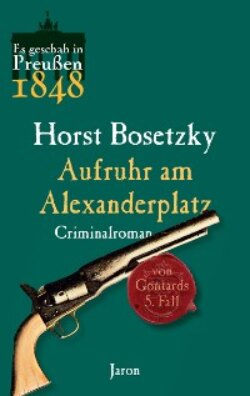Читать книгу Aufruhr am Alexanderplatz - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 5
Eins
ОглавлениеAls Christian Philipp von Gontard erwachte, brauchte er einige Sekunden, um sich zu orientieren. Die niedrige Zimmerdecke … Er war offensichtlich nicht auf seinem Gut in Wutike. Die Stille draußen … Das war auch nicht seine Wohnung in der Berliner Dorotheenstraße. Endlich erkannte er, wo er sich befand: in Wahn. Nicht etwa im Wahn, sondern in Wahn. Genauer gesagt, in der Wahner Heide nahe Köln. Er schlug die Bettdecke beiseite, setzte sich auf und massierte seine Schläfen. Der Abend mit den Kameraden war lang gewesen, und anderthalb bis zwei Flaschen Wein bei einer Feier war er nicht gewohnt.
Man schrieb das Jahr 1838, und man hatte ihn, den jungen Lieutenant des 3. Garde-Feldartillerie-Regiments, abkommandiert auf den Schießplatz Wahner Heide. Der war nach Ende der Freiheitskriege gegen Napoleon angelegt worden, als unter Prinz August von Preußen die Artillerie neu organisiert worden war. Man hatte eine möglichst gefechtsnahe Ausbildung und jederzeit einsatzbereite Truppen haben wollen und zu diesem Zweck in der Nähe von Garnisonsstädten Übungsplätze eingerichtet. Für die 1816 in Köln aufgestellte 7. Königlich Preußische Artilleriebrigade hatte die Gemeinde Wahn ab 1817 ein Gelände, das man als Truppenübungsplatz nutzen konnte, zur Verfügung stellen müssen. Die Größe dieses »Revue-Platzes« war der Reichweite der Geschütze und der Sprengwirkung der zur Verfügung stehenden Artilleriegranaten angepasst gewesen. Doch der rasante Fortschritt in der Militärtechnologie führte dazu, dass die Reichweite der Geschütze ständig zunahm.
Einquartiert hatte man Gontard im Dorf Altenrath östlich des Schießplatzes, und zwar beim Bäcker Georg Engels. Dessen Vorfahren waren allesamt Töpfer gewesen, doch nachdem dieses Gewerbe zum Erliegen gekommen war, hatte man sich anderen Betätigungen zuwenden müssen.
Gontard hatte gelacht, als ihm der Bäcker davon berichtet hatte. »Das Beschicken eines Ofens steckt Ihnen offenbar im Blut. Bei Ihren Ahnen waren es die aus Ton geformten Krüge, die in den Ofen kamen, bei Ihnen sind es die Brotlaibe.«
»Vor allem meine Kuchen. Den Kirschstreusel müssen Sie unbedingt einmal probieren!«
Viel lieber hätte Gontard Marie probiert, die Tochter des Bäckers, doch kaum hatte ihre Mutter seine begehrlichen Blicke bemerkt, warnte sie ihn auch schon: »Passen Sie nur auf, Herr Lieutenant! Unser Mariechen ist verlobt, und ihr Verlobter, der Drickes, ist ein Schmied, wo der hinlangt, da wächst kein Gras mehr.«
Also beschränkte sich Gontard darauf, Marie verstohlene Blicke hinterherzuwerfen. Seinem Freund Friedrich Kußmaul schrieb er nach Berlin, sie sei ein wahres Zuckerpüppchen.
Wenn die Engels’ mit Gontard redeten, bemühten sie sich, ein auch ihm verständliches Deutsch zu sprechen, wenn sie aber unter sich waren oder vergaßen, dass er mit am Tisch saß, dann verfielen sie in ihren rheinischen Dialekt.
So geschah es auch an diesem Morgen, als Gontard mit einiger Verspätung am Frühstückstisch erschien und sich dafür entschuldigte.
Die Bäckersfrau winkte ab. »Wer lang schlöf, dä schlöf sich wärm, wer fröh opsteit, dä friss sich ärm.«
Und gleich danach verkündete der Hausherr mit einem Blick aus dem Fenster: »Et Wedder wed jot: Die Aape klimme.«
Gontard sah ihn verständnislos an. »Wie?«
»Das Wetter wird gut: Die Affen klettern.«
Auch als Maries Mutter noch einmal auf ihren künftigen Schwiegersohn zu sprechen kam, konnte sich Gontard den Sinn ihrer Worte nicht so recht erschließen. »Wenn dä stirv, möht mer demm sing Mul extra dutschlage.« Das sollte heißen, dass der Drickes ein Schwaadlappe war – also einer, der dauernd schwätzte und dem man nach seinem Tod sogar noch den Mund totschlagen musste.
Marie fragte Gontard, ob er nicht zum Mittagessen vom Schießplatz zurück nach Altenrath kommen wolle.
Das Frühstück mit der Familie Engels hätte für ihn ewig dauern können, doch war es Zeit, sich zu erheben und zur Kirche St. Georg zu laufen, wo der Kutschwagen hielt, der ihn und seine Kameraden abholte und zum Schießplatz brachte.
Dort hatte Richard von Randersacker das Sagen, geboren am 4. Januar 1799 in Schramburg als Sohn eines Woiwoden und mit seinen Eltern aus Livland nach Preußen gekommen, nachdem man in Preußen und Österreich den Grafenstand der Familie anerkannt hatte. In Polnisch-Livland, Kurland und Litauen gehörte ihm ein von der Düna durchströmtes Gebiet von 35 Quadratmeilen mit rund 15 000 Seelen. Vermählt war er mit der Freiin Magdalene von Lixna.
Randersacker war nach dem Besuch der Liegnitzer Ritterakademie 1815 zur Artillerie gekommen. Am Ende der Befreiungskriege war er zur Garde-Artillerie nach Berlin versetzt worden. 1825 hatte man ihn zum Premier-Lieutenant befördert, danach reichte er seinen Abschied ein, weil ihm die Verwaltung und der Erhalt seiner Besitzungen sehr am Herzen lagen. Nach Ausbruch des Novemberaufstands in Polen Ende 1830 war er zur Landwehr einberufen worden und hatte die 5. Artillerie-Brigade übernommen. Dort war er 1833 zum Hauptmann ernannt worden und später zum Major aufgestiegen. Seit 1837 fungierte er als Director in der Abteilung für Artillerie-Angelegenheiten im Kriegsministerium in Berlin.
»Was ich Ihnen heute vorführen will, meine Herren, ist ein von Wahrendorff in Schweden neuentwickelter Kolbenverschluss, wie er in den nächsten Jahren für alle Hinterlader eingeführt werden soll. Ich will Ihnen aber nicht verschweigen, dass ich den Hinterladern skeptisch gegenüberstehe und für die Beibehaltung des guten alten Vorderladers plädiere. Warum wohl? Weil bei Vorderladern eine größere Treibladung benutzt werden kann und wir dadurch eine größere Reichweite und eine höhere Durchschlagsleistung erreichen. Quod esset demonstrandum!”
Randersacker hatte zu diesem Zwecke zwei Kanonen der unterschiedlichen Bauarten nebeneinander aufstellen lassen. Schon waren die bereitstehenden Kanoniere dabei, die Granaten in die Rohre zu schieben und diese auszurichten. Randersacker gab den Befehl zum Feuern.
In der Dorfschmiede von Altenrath gab es an diesem Vormittag für Meister Bernhard Büllersbach und seinen Gesellen viel zu tun. Ohne Unterlass waren sie unterwegs zwischen Feuer und Amboss, zogen mit ihren Zangen glühendes Eisen aus der Glut und formten daraus mit ihrem Hammer Hacken, Pflugscharen, Kettenglieder, Türscharniere und Hufeisen.
Doch immer wieder hielt der Geselle mitten in der Arbeit inne, starrte in Richtung der Engels’schen Bäckerei und musste von Büllersbach an die oberste Weisheit seines Berufes erinnert werden: dass man ein Eisen nur so lange schmieden konnte, wie es heiß war.
»Mensch, Drickes, wo bist du denn bloß mit deinen Gedanken!«, rief Büllersbach. »Bei Mariechen wieder?« Der Geselle bekannte, dass ihn die Eifersucht gepackt habe, denn in der Engels’schen Bäckerei habe man einen Berliner Lieutenant einquartiert, der seiner Verlobten schon den Kopf verdrehen könne. »Ein schöner Mann ist er – und adlig auch noch. Der kann sicher mem Aasch Nöss knacke. Den hätt se besser en dä Wald jespritz, do wör hä ne schöne Tannenboom jewoode.«
Der Schmied lachte. »Zänkt üch nit, schlot üch leever!« Der Geselle winkte ab. Sich mit dem Lieutenant zu schlagen, würde er nicht wagen, denn sein zweiter Schlag wäre schon Leichenschändung, und die Preußen würden ihn sicher unters Fallbeil schicken. Er versuchte, sich wieder zu beruhigen und auf seine Arbeit zu konzentrieren, doch andauernd drang vom Schießplatz Kanonendonner herüber, und er wurde immer wieder an Marie und ihren uniformierten Verehrer aus Berlin erinnert. Wer weiß, vielleicht kam der am helllichten Tage aus der Wahner Heide zurück und versuchte, Mariechen den Hof zu machen. Die Angst, seine Verlobte zu verlieren, wurde übermächtig. Er bat Büllersbach, für ein paar Minuten verschwinden zu dürfen, um zu sehen, ob die Marie auch wirklich im Laden stand und Brote verkaufte.
Büllersbach hatte volles Verständnis für Drickes’ Anliegen. Er solle nur laufen. »Jeh met Jott, äwer loss de Lieutenant levve, wenn er sich wirklich övver dat Marieche hergemaach hat!«
Drickes band seine Lederschürze ab und machte sich auf den Weg zur Engels’schen Bäckerei, die unweit von St. Georg gelegen war. Kaum hatte er den einstöckigen Backsteinbau im Blick, ließ ihn ein gedehntes Rauschen zusammenzucken, das sich anhörte, als würde ein Meteor niedergehen. Er kannte das vom Manöver her. Eine Granate! Instinktiv warf er sich der Länge nach auf den Boden. Da krachte es auch schon dicht vor ihm, und die Erde bebte. Eine Druckwelle ging über ihn hinweg, eine Staubwolke hüllte ihn ein. Als er sich wieder aufgerappelt und der Staub sich gelegt hatte, schrie er auf. Die Granate hatte die Bäckerei getroffen, Maries Elternhaus war nur noch ein einziger Trümmerhaufen. Er lief so schnell, wie er noch nie in seinem Leben gelaufen war. Vielleicht war sie noch zu retten. Herr, höre meine Worte, Herr, vernimm mein Schreien! Hilf mir um deiner Güte willen, lass Marie am Leben! Er war kein Kirchgänger, das Beten fiel ihm schwer.
Er war als Erster an der Engels’schen Bäckerei, und mit seinen gewaltigen Kräften warf er große Steinbrocken wie Kiesel beiseite und zersplitterte Balken wie Streichhölzer. Als die Nachbarn ihm zu Hilfe kommen wollten, hatte er seine Verlobte schon gefunden.
Doch er kam zu spät. Marie starb in seinen Armen.