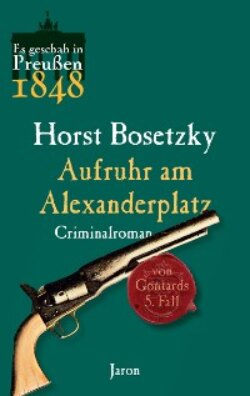Читать книгу Aufruhr am Alexanderplatz - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 9
Fünf
ОглавлениеEin Feuerland gab es 1848 nicht nur am südlichen Ende Südamerikas, sondern auch am nördlichen Rande Berlins, gleich vor dem Oranienburger Thor. Zuerst wurde hier 1804 die Königlich Preußische Eisengießerei in Betrieb genommen, dann hatten sich etliche Fabrikherren mit ihren Eisengießereien und Maschinenbauanstalten niedergelassen, so Franz Anton Egells (1826), August Borsig (1837), Friedrich Adolf Pflug (1839) und Johann Friedrich Ludwig Wöhlert (1842). Inzwischen zählte das Handelsministerium 33 Firmen mit über dreitausend Beschäftigten im Feuerland. Da alle Betriebe für ihre Produktion Eisen schmelzen, gießen oder bis zur Glut erhitzen mussten, brannten überall Feuer und aus unzähligen Schornsteinen stiegen Rauchschwaden in den Himmel, so dass im erfindungsreichen Berliner Volksmund das Areal bald den Namen Feuerland bekam.
Der König vom Feuerland war eindeutig August Borsig, geboren 1804 in Breslau und 1823 nach Berlin gekommen. Begonnen hatte sein Aufstieg mit der Produktion von Kleineisenteilen für den Gleisbau, dann hatte er englische und amerikanische Lokomotiven repariert, und schließlich baute er selbst welche. 1841 hatte die Borsig 1 auf der Strecke Berlin—Jüterbog eine Wettfahrt gegen eine Maschine des großen George Stephenson gewonnen, und schon 1846 war Borsigs hundertste Lokomotive aus der Halle gerollt. Wer bei Borsig arbeitete, war stolz darauf und rief gerne aus: »Ich bin kein Proletarier, ich bin Maschinenbauer!«
Einer dieser Maschinenbauer war Franz Watzlawiak. Er bediente eine der Drehbänke, an denen die Pleuelstangen der berühmten Borsig’schen »Schnellläufer«-Lokomotiven entstanden. Ringsum kreischten die Bohrer, dröhnten die Schmiedehämmer, in den Werkstätten nebenan flackerten die Schmelzöfen. Schlagartig aber brachen die Geräusche ab, als einer der Meister »Feierabend!« gerufen hatte. Es war Sonnabend, und ein jeder strebte voller Vorfreude auf das Wochenende seiner Wohnstatt entgegen. Watzlawiak hatte sich bei der Witwe Grimnitz in der Linienstraße eingemietet und eilte nun mit einer Geschwindigkeit durch das Oranienburger Thor, die die Wache denken ließ, hier sei ein Verbrecher auf der Flucht. Ein kleines Stück ging es die Friedrichstraße entlang, dann musste er nach links in die Linienstraße abbiegen. Die zog sich ewig an der nördlichen Berliner Peripherie entlang, erst hinter der Alten Schönhauser Straße war er am Ziel. Nur schnell aus den alten Klamotten raus, die er bei der Arbeit trug, sich waschen, etwas Anständiges anziehen, und dann ab zu Auguste. Er liebte es, sich als ganzer Mann zu geben, und so stand er auch Ende Februar an der Pumpe unten im Innenhof, die vor ein paar Tagen noch eingefroren war, und ließ sich das eiskalte Wasser über den nackten Oberkörper rinnen.
Über ihm wurde das Fenster aufgerissen, und die Witwe Grimnitz oben am Fenster begann zu zetern. »Sie, det is unschickllich!«
Watzlawiak lachte. »Sie müssen ja nicht hingucken. Weg vom Fenster, gleich wasche ich mich in den unteren Regionen!«
Das wagte er natürlich nicht, dennoch kreischte die Grimnitz und drohte wieder einmal, ihm zu kündigen. Er war sich aber sicher, dass sie ihre Drohung nicht wahr machen würde, denn er hatte den Ruf, ein gewalttätiger Mensch zu sein. Und darauf war er auch stolz. Als er mit seiner Wäsche fertig war, nahm er dennoch eine Rose aus Papier, die er bei einem Maskenball erbeutet hatte, und trat an, sich bei ihr zu entschuldigen.
Sie rollte mit den Augen. »Ihnen kann man auf Dauer nich böse sein …« Seufzend nahm sie die Papierblume entgegen und gestattete ihm sogar, in ihrer Vossischen zu blättern und nachzuschauen, was Berlin am 19. Februar 1848 an Amüsements im Angebot hatte. Es war eine Menge.
Im Königlichen Schauspielhaus gab es ein Lustspiel von Gustav zu Putlitz mit dem langweilig klingenden Titel Ein Hausmittel. Nein, das war nichts für seine Auguste. Eher wäre sie noch ins Königsstädtische Theater gegangen, wo die Compagnia Italiana gastierte, aber da fiel die angekündigte Oper wegen einer Unpässlichkeit der Signora Fodor heute aus. Schade.
Groß waren die Programme der Circusse angekündigt, zum Beispiel:
Circus von Alessandro Guerra
Große Damen-Vorstellung mit neuen Abwechselungen
Zum Schluß: Grand Steeple chase, geritten von 8 Damen der Gesellschaft
Anfang: 7 Uhr abends
Das klang nicht schlecht, aber wie immer war Watzlawiak knapp bei Kasse, und beim Kauf zweier Eintrittskarten hätte er sich wieder etwas von der Witwe Grimnitz borgen müssen. Ausgeschlossen! Weiter im Text. Einige Etablissements priesen Interessantes an. Nicht ganz klug wurde er aus dem, was die Erste Corso-Halle zu bieten hatte: Fortsetzung der eingeübten fahrenden Bedienung, wobei Prell’sches Bier in neuem Costüm verabreicht wird. Kamen da die Serviererinnen mit einer Draisine an die Tische? Kroll’s Garten kündigte für sieben Uhr abends schon den vorletzten Bal Masqué an: Der Königl. Tänzer Hr. Sergeois leitet die Tanzordnung. Die Herren Noack und Hoffmann werden eine vollständige Maskengarderobe aufgestellt haben. Angelangt bei Krumhorn’s Caffeehaus, bekam er das große Gähnen: Große Abendunterhaltung mit Gesang. Launige Vorträge von dem jetzt mit vielem Beifall aufgenommenen Herrn von Bergen nebst Kapelle. Das Maaß’sche Lokal und Sommer’s Salon boten auch nichts Aufregendes. So blieben für Auguste und ihn nur noch zwei Attraktionen:
Bude auf dem Alexanderplatz
Die 7 Wunder der Welt in sieben Bildern
5 großartige Gemälde von J. Lera
Die außerordentliche Naturerscheinung, ein 15 Jahr altes, lebendes Mädchen, welchem Theile eines zweiten Kindes angewachsen sind
Eldorado (Thorstraße 12)
Grand Bal masqué et paré
Nach der Pause: Bohnenfest: die Königin des Festes erhält ein werthvolles Geschenk
Anfang: 8 Uhr abends
Mit diesen Programmen im Kopf machte er sich auf den Weg zum Randersacker’schen Palais, um Auguste abzuholen. Es war ein gewaltiger Fußmarsch bis zur Wilhelmstraße, aber um sie in den Armen zu halten, wäre er auch bis ans Ende der Welt gelaufen. Über die Prenzlauer Straße kam er zum Alexanderplatz, dann ging es die Königstraße entlang zum Schloßplatz, weiter über den Werderschen Markt und den Hausvogteiplatz zur Mohrenstraße und schließlich in die Wilhelmstraße. Auch einem Kraftprotz wie ihm ging da die Puste aus.
»Da biste ja endlich!« Auguste hatte schon eine Viertelstunde auf ihn gewartet.
»Tut mir leid.« Er umarmte sie. Dabei streifte sein Blick die Fassade des Palais, und er sah Randersacker am offenen Fenster stehen. »Der lässt dich wohl nicht mehr aus den Augen …«
»Wer?«
»Na, dein Brötchengeber. Aber wenn er dir zu nahe treten sollte, findet er sich auf ’m Friedhof wieda, sag ihm dit!«
Auguste verfluchte die Eifersucht ihres Verlobten einerseits. Andererseits freute sie sich über die Morddrohungen, die er gegenüber allen ausstieß, die als Nebenbuhler in Frage kamen, waren sie doch ein Zeichen dafür, wie heiß und innig er sie liebte.
Paul Quappe, im Dienstgebrauch nur Kaulquappe genannt, teilte das Schicksal der Offiziersburschen, die es wie er nicht bis zum Gefreiten gebracht hatten: Er war Offizieren aller Dienstgrade, Militärärzten und Zahlmeistern zur persönlichen Bedienung zugewiesen. Quappe war im Jahre des Herrn 1828 auf die Welt gekommen.
Wenn er nach seinem Alter gefragt wurde, musste er jedes Mal mühsam nachrechen. Noch größere Probleme als mit Zahlen hatte er jedoch mit dem Schreiben und Lesen. Um das zu verbergen, hatte er eine Reihe von Techniken und Tricks entwickelt – und war dadurch ein recht schlaues Kerlchen geworden, viel schlauer, als ihn alle einschätzten. Schnell hatte er herausgefunden, dass er viel leichter durchs Leben kam, wenn er sich dumm stellte. Schwierige und kraftraubende Arbeiten wurden dann anderen übertragen. Außerdem brauchten die Preußen, insbesondere die Autoritäten, ihren Hofnarren. Wer andere zum Lachen brachte, war beliebt und konnte viele Vergünstigungen erwarten. Hätte Quappe ein paar Jahrzehnte später gelebt, dann hätte man ihn mit dem von Jaroslav Hašek ersonnenen braven Soldaten Schwejk vergleichen können. Mit dem tschechischen Bruder im Geiste hatte er nicht nur die Freude am exzessiven Erzählen von Anekdoten gemein. Sollte sich Schwejk der Einberufung dadurch zu entziehen versuchen, dass er im Rollstuhl zur Musterung erschien, so hatte Quappe den Ärzten einen Epileptiker vorgespielt – allerdings mit demselben Misserfolg wie der brave Soldat.
Quappe hatte zwei linke Hände, und wo er war, da war das Chaos. Dazu kam, dass man ihm als Kind zu viel von Till Eulenspiegel vorgelesen hatte und er seither danach trachtete, es dem großen Schalksnarren gleichzutun. Schon der Ort seiner Geburt war außergewöhnlich, wenigstens dem Namen nach: Schönschornstein. Das war ein Weiler südlich von Erkner, umfangen von der dort mäandernden Spree, die vor Köpenick und dem Zusammenfluss mit der Dahme kaum breiter war als ein Bach.
Abgesehen von der Leidenschaft für Streiche verband ihn noch ein besonderes Tauferlebnis mit Till Eulenspiegel: Auch seine Amme, die ihn im Anschluss an die Feier nach Hause trug, fiel mit ihm – ein wenig trunken, wie sie war – stracks ins Wasser, als man einen Kahn besteigen wollte. Die Quappes waren nämlich eine alte Schifferfamilie. »Nun ratet mal alle, ob ich damals ertrunken bin oder noch gerettet werden konnte«, sollte Quappe später immer wieder sagen. Mit Spreewasser war Paul Quappe also getauft – und vielleicht hatte der Pfarrer beim Schöpfen des Taufwassers wirklich eine Kaulquappe mit aus dem Fluss geholt, wie man schon in Erkner gespottet hatte, wo Quappe zur Schule gegangen war.
1842 hatte Paul Quappe in Frankfurt an der Oder beim Leib-Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm III. seine militärische Laufbahn begonnen – und war seitdem weitergereicht worden wie die berühmte heiße Kartoffel. Ende Januar 1848 war er dem preußischen Kriegsminister Ferdinand von Rohr als Bursche zugeteilt worden.
Ferdinand von Rohr saß in seinem Dienstzimmer im preußischen Kriegsministerium, Leipziger Straße No. 5–7, zwischen Wilhelmstraße und Pariser Platz, und quälte sich durch die ihm vorgelegten Akten. Endlos erschien ihm auch dieser Tag. Das Atmen fiel ihm immer schwerer. In der Schlacht bei Bautzen, 1813, hatte er einen Schuss in die Brust bekommen, und seitdem war seine Lunge spürbar geschwächt. Er schloss die Augen und versuchte, Bilder seiner Kindheit herbeizuzaubern. Die Domkirche St. Peter und Paul … der Roland … das Baden im Fluss … Am 17. Mai 1783 war er in Brandenburg an der Havel geboren worden. Mit vierzehn Jahren hatte er den Dienst beim Infanterieregiment Herzog von Braunschweig begonnen. Dann war Napoleon über Preußen hergefallen. Als Grenadieroffizier hatte Ferdinand von Rohr die Schmach von Jena und Auerstedt miterlebt und war danach als Hauptmann in den Stab des Generals von Yorck gekommen. Bei Halle und bei Großgörschen war er in die Schlacht gegen den Franzosenkaiser gezogen, bei Bautzen war dann Schluss gewesen.
Er hörte einen Schuss und fuhr hoch. Nein, die Ordonanz hatte gegen die Tür geklopft, nichts weiter. »Ja, herein!«
Draußen stünde ein entfernter Verwandter von ihm, ein Herr Leopold von Rohr.
»Ja, soll reinkommen.«
Wer eintrat, war sein Cousin Leopold. Sie hatten sich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, und so gab es mancherlei zu erzählen.
»Ich war erst Regierungsdirektor in Stettin und später Regierungspräsident in Stralsund«, berichtete Leopold von Rohr. »1833 bin ich dann in den Ruhestand getreten und nach Berlin gezogen. Seitdem verfasse ich Gedichte.«
»Ich habe davon gehört«, versicherte der Kriegsminister.
»Und du?«
Ferdinand von Rohr überlegte. »Du wirst wissen, dass ich schon einmal im Kriegsministerium gewesen bin: 1813 als Major und als Leiter der Bekleidungsabteilung. Schrecklich! Ich wollte wieder zurück in die Kaserne. Da war ich dann erst beim Alexander-Regiment hier in Berlin und dann in Glogau, wo ich eine neue Art der Ausbildung ins Leben gerufen habe: keine mechanische Dressur mehr, sondern eine Erziehung mit Verständnis für die Rekruten, auf dass sich alle ihre geistigen und körperlichen Kräfte voll entfalten können.«
»Davon wiederum habe ich gehört«, warf nun auch der Vetter ein.
»Von Glogau bin ich dann nach Breslau gegangen … Aber da haben meine Kräfte schon erheblich nachgelassen – und ich habe den Antrag gestellt, in den Ruhestand treten zu dürfen. Und was passiert? Man ernennt mich am 7. Oktober letzten Jahres zum Kriegsminister.«
Die Ordonanz klopfte abermals, bat um Entschuldigung und drängte den Minister, ein vorbereitetes Schreiben auf den Weg zu bringen. »Die Sache Randersacker.«
»Ich habe das Schriftstück schon unterschrieben. Der Quappe soll es sofort nehmen und hinbringen.«
»Sehr wohl!«
Paul Quappe eilte mit dem gesiegelten Kuvert zur Wilhelmstraße. Wo das Randersacker’sche Palais zu finden war, wusste er. Weit war es nicht. Nur ein paar Minuten, aber Zeit genug, sich einen jener kleinen Scherze auszudenken, für die er bekannt und gefürchtet war.
Als er am Dienstboteneingang des Palais am Klingelzug riss, öffnete ihm ein Dienstmädchen.
»Ick hab hier wat vom Kriegsminister Herrn von Rohr.« Damit reichte er dem Mädchen das Schreiben aus der Leipziger Straße. »Aba bitte nich den Boten umbringen, der die schlechte Nachricht übabringt!«
»Wat isset denn?«
»Herr von Randersacker is vom Könich rausjeschmissen worn und soll wejen Hochverrat vors Jericht.«
»Det is ja entsetzlich!«
»Ja, mehr als det.«