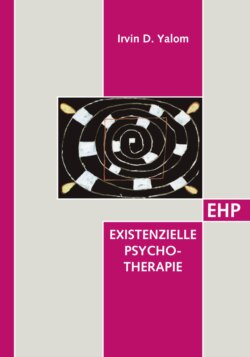Читать книгу Existenzielle Psychotherapie - Irvin D. Yalom - Страница 9
1. Kapitel: Einführung
ОглавлениеVor vielen Jahren meldeten sich einige Freunde und ich zu einem Kochkurs an, der von einer armenischen Matrone und ihrem betagten Diener gegeben wurde. Da sie kein Englisch sprach und wir kein Armenisch, war die Unterhaltung nicht einfach. Sie lehrte durch Demonstration; wir schauten zu (und versuchten fleißig, ihre Rezepte eins zu eins zu verstehen), während sie eine Reihe wunderbarer Auberginen- und Lammgerichte zubereitete. Aber unsere Rezepte waren unvollkommen, und so sehr wir uns auch bemühten, wir konnten ihre Gerichte nicht nachahmen. »Was war es«, fragte ich mich, »das ihrer Kochkunst dieses besondere Etwas gab?« Die Antwort entzog sich mir, bis ich eines Tages, als ich besonders aufmerksam beobachtete, was in der Küche vor sich ging, unsere Lehrerin mit großer Würde und Überlegtheit ein Mahl zubereiten sah. Sie übergab es ihrem Diener, der es wortlos in die Küche zum Ofen trug und ohne zu zögern eine Handvoll ausgewählter Gewürze und Zutaten nach der anderen hineinwarf. Ich bin überzeugt, dass jene heimlichen »Zugaben« den ganzen Unterschied ausmachten.
An diesen Kochkurs erinnere ich mich, wenn ich über Psychotherapie nachdenke, besonders wenn ich an die entscheidenden Zutaten erfolgreicher Therapie denke. Formale Texte, Zeitschriftenaufsätze und Vorlesungen beschreiben Therapie als exakt und systematisch, mit sich sorgfältig abzeichnenden Stadien, strategisch technischen Interventionen, methodischer Entwicklung und Wiederauflösung von Übertragung, Analyse der Objektbeziehungen und als ein sorgfältiges rationales Programm von Interpretationen, die Einsichten ermöglichen. Aber ich glaube wirklich, dass der Therapeut das »Eigentliche« hineinwirft, wenn niemand zuschaut.
Aber welches sind diese »Zugaben«, diese flüchtigen, außerplanmäßigen Extras? Sie existieren außerhalb der formalen Theorie, über sie wird nicht geschrieben, sie werden nicht ausdrücklich gelehrt. Die Therapeuten sind sich ihrer oft nicht bewusst; aber jeder Therapeut weiß, dass er oder sie es nicht erklären kann, warum viele Patienten Fortschritte machen. Die entscheidenden Zutaten sind schwer zu beschreiben, noch schwerer zu definieren. Ist es überhaupt möglich, solche Qualitäten wie Mitgefühl, »Präsenz«, Fürsorge, sich selbst öffnen, den Patienten auf einer tiefen Ebene berühren oder diese flüchtigste Qualität von allen – Weisheit – zu definieren und zu lehren?
Einer der ersten aufgezeichneten Fälle moderner Psychotherapie zeigt sehr anschaulich, wie Therapeuten diese Extras selektiv außer Acht lassen.1 (Spätere Beschreibungen von Therapien sind weniger brauchbar in dieser Hinsicht, weil sie so besessen von der richtigen Durchführung der Therapie waren, dass die außerplanmäßigen Manöver in den Fallberichten ausgelassen wurden.) 1892 behandelte Sigmund Freud erfolgreich ein Fräulein Elisabeth von R., eine junge Frau, die an psychogenen Gehschwierigkeiten litt. Freud erklärte diesen therapeutischen Erfolg ausschließlich mit seiner Technik der Abreaktion, der Aufhebung der Verdrängung bestimmter schädlicher Wünsche und Gedanken. Aber wenn man Freuds Aufzeichnungen studiert, ist man erstaunt von der Vielfalt seiner anderen therapeutischen Handlungen. Zum Beispiel beauftragte er Elisabeth, das Grab ihrer Schwester zu besuchen und bei einem jungen Mann vorbeizuschauen, den sie attraktiv fand. Um ihr Leiden zu erleichtern, »bekümmerte« er sich »freundschaftlich um gegenwärtige Verhältnisse«2 der Patientin und »suchte in solcher Absicht« Kontakt zu ihrer Familie: Er befragte die Mutter der Patientin und »bat sie inständig«, eine Möglichkeit der Kommunikation mit der Patientin zu eröffnen und ihr von Zeit zu Zeit zu erlauben, ihren Kummer auszusprechen. Er erfuhr von der Mutter, dass Elisabeth keine Chance hatte, den Mann ihrer verstorbenen Schwester zu heiraten, und teilte dies seiner Patientin mit. Er half dabei, das finanzielle Durcheinander der Familie zu klären. Ein anderes Mal drängte Freud Elisabeth, mit ruhiger Gelassenheit der Tatsache ins Auge zu sehen, dass die Zukunft für jeden unvermeidlicherweise unsicher ist. Er tröstete sie wiederholt, indem er ihr versicherte, dass sie nicht für unerwünschte Gefühle verantwortlich sei und dass der Grad an Schuld und Reue, die sie für diese Gefühle empfand, ein überzeugender Beweis ihres hochmoralischen Charakters sei. Als Freud schließlich nach Beendigung der Therapie hörte, dass Elisabeth zu einem privaten Tanzvergnügen gehen würde, verschaffte er sich eine Einladung, so dass er sie »in einem lebhaften Tanz vorbei wirbeln« sehen konnte. Man muss sich wirklich fragen, welches von Freuds Extras, die zweifellos wirkungsvolle Interventionen darstellten, Fräulein von R. halfen; sie aus der Theorie auszuklammern heißt, dem Irrtum Tür und Tor zu öffnen.
Es ist meine Absicht, in diesem Buch einen Zugang zur Psychotherapie vorzuschlagen und zu erläutern – eine theoretische Struktur und eine Reihe von Techniken, die aus dieser Struktur hervorgehen – der einen Rahmen für viele der Extras in der Therapie bereitstellt. Das Etikett für diesen Zugang, »existenzielle Psychotherapie«, widersetzt sich einer prägnanten Definition, denn die Grundlagen der existenziellen Orientierung sind nicht empirisch, sondern zutiefst intuitiv.
Ich werde zuerst eine formale Definition anbieten, und dann werde ich im gesamten übrigen Buch diese Definition erläutern:
Existenzielle Psychotherapie ist ein dynamischer Zugang zur Therapie, der sich auf die Gegebenheiten konzentriert, welche in der Existenz des Individuums verwurzelt sind.
Ich bin überzeugt davon, dass die große Mehrheit der erfahrenen Therapeuten, ganz gleich, ob sie einer anderen ideologischen Ausrichtung anhängen, viele der existenziellen Einsichten verwenden, die ich beschreiben werde. Die Mehrheit der Therapeuten ist sich beispielsweise der Tatsache bewusst, dass das Verständnis von unserer Endlichkeit oft eine bedeutende innere Verschiebung der Perspektive auslösen kann; dass es die Beziehung ist, die heilt; dass die Patienten von Entscheidungssituationen gequält werden; dass ein Therapeut Katalysator für den »Willen« des Patienten zum Handeln ist; und ebenso, dass die Mehrzahl der Patienten an Sinnverlust in ihrem Leben leidet.
Aber der existenzielle Ansatz ist mehr als ein subtiler Akzent oder eine implizite Perspektive, die die Therapeuten unwissentlich verwenden. Während meiner Vorlesungen für Therapeuten über verschiedene Themen fragte ich immer wieder: »Wer von Ihnen betrachtet sich als existenziell ausgerichtet?« Ein hoher Anteil der Zuhörerschaft, gewöhnlich mehr als fünfzig Prozent, antwortete zustimmend. Aber wenn diese Therapeuten gefragt wurden, »Was ist der existenzielle Ansatz?«, fanden sie es schwierig zu antworten. Die Sprache, die von Therapeuten verwendet wird, um irgendeinen therapeutischen Ansatz zu beschreiben, war nie berühmt für ihre Griffigkeit oder schlichte Klarheit; aber keine von all den therapeutischen Ausdrucksweisen kann mit der existenziellen in ihrer Vagheit und Verwirrung konkurrieren. Die Therapeuten assoziieren den existenziellen Ansatz mit solchen in sich unpräzisen und offensichtlich beziehungslosen Begriffen wie »Authentizität«, »Begegnung«, »Verantwortung«, »Wahl«, »humanistisch«, »Selbstaktualisierung«, »sich zentrieren«, »im Sinne Sartres« und »im Sinne Heideggers«; und viele Experten für geistige Gesundheit haben ihn lange Zeit für eine verworrene, »sanfte«, irrationale und romantische Orientierung gehalten, die, statt ein »Ansatz« zu sein, einen Freibrief für Improvisation gibt, damit undisziplinierte und ungenaue Therapeuten »ihr eigenes Ding machen können«. Ich hoffe, zeigen zu können, dass solche Schlussfolgerungen ungerechtfertigt sind, dass der existenzielle Ansatz ein wertvolles, effektives psychotherapeutisches Paradigma ist, das ebenso rational, in sich schlüssig und systematisch ist wie irgendein anderes.