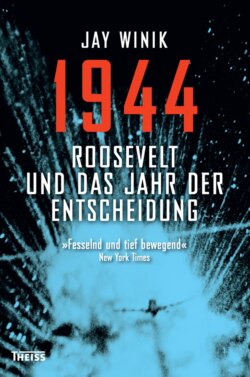Читать книгу 1944 - Jay Winik - Страница 10
Kapitel 1 Teheran
ОглавлениеFranklin Delano Roosevelt hatte nie nach Teheran reisen wollen. Den ganzen Herbst 1943 über nutzte der Präsident seinen viel gepriesenen Charme und sein Charisma, um die beiden anderen alliierten Staats- und Regierungschefs – Winston Churchill und Josef Stalin – dazu zu bewegen, irgendwo anders zusammenzukommen, bloß nicht dort. Die Konferenz, ihre erste gemeinsame überhaupt, war ein Jahr lang vorbereitet worden, und jetzt sah es wegen der heiklen Frage, wo sie stattfinden sollte, schon vor ihrem Beginn so aus, als stünde sie kurz vor dem Scheitern.
US-Außenminister Cordell Hull, der zu einem Besuch nach Moskau entsandt worden war, hatte die irakische Hafenstadt Basra vorgeschlagen, wohin Roosevelt leicht per Schiff hätte reisen können. Roosevelt selbst brachte Kairo, Bagdad oder Asmara, die Hauptstadt der ehemaligen italienischen Kolonie Eritrea am Roten Meer, ins Spiel. Dies seien, betonte der Präsident, allesamt Orte, wo er leicht in ständigem Kontakt mit Washington, D.C., bleiben könne, was für ihn als Verantwortlichen zu Kriegszeiten unerlässlich sei. Aber der sowjetische Führer Josef Stalin blieb ungerührt und konterte, er als Oberbefehlshaber der sowjetischen Streitkräfte müsse ebenso in Verbindung mit seinen Stellvertretern in Moskau stehen. Stalin behauptete darüber hinaus, dass die am Fuße des Elburs-Gebirges gelegene iranische Hauptstadt über Telegrafenund Telefonverbindungen nach Moskau verfüge. „Meine Mitarbeiter bestehen auf Teheran“, kabelte er unverblümt zur Antwort an Roosevelt und fügte hinzu, dass er unter dieser Bedingung jedoch einen Termin Ende November für das Treffen akzeptieren würde. Außerdem sei er mit der Entscheidung der Amerikaner und Briten einverstanden, sämtliche Pressevertreter auszuschließen.
Roosevelt, der noch immer hoffte, Stalin, den er „Onkel Joe“ nannte, umstimmen zu können, telegrafierte noch einmal wegen Basra: „Ich bitte Sie, daran zu denken, dass ich auch eine große Verpflichtung gegenüber der amerikanischen Regierung habe und die amerikanischen Kriegsanstrengungen in vollem Umfang aufrechterhalten muss.“ Die Antwort aus Moskau fiel kurz und bündig aus: Nein. Stalin war unnachgiebig, und er ließ nun durchblicken, dass er gegebenenfalls die ganze Vereinbarung einer dreiseitigen Konferenz platzen lassen könnte. Erst nachdem er, was Teheran betraf, seinen Willen bekommen hatte und Roosevelt sich anschickte, über den Atlantik in Richtung Mittelmeer in See zu stechen, beruhigte sich Stalin wieder. Unverzüglich telegrafierte Roosevelt an Winston Churchill: „Eben erfahre ich, dass Onkel Joe nach Teheran kommen wird. […] ich war mir doch noch im Zweifel, ob er seine frühere Zusage […] aufrechterhalten werde. […] jetzt besteht meines Erachtens kein Hindernis mehr, dass wir ihn zwischen dem 27. und 30. dort treffen.“1
So kam es, dass Roosevelt am Samstag, den 27. November, gegen 6.30 Uhr morgens auf dem Wüstenflugplatz bei den Pyramiden außerhalb Kairos an Bord der Sacred Cow ging, einer silbern schimmernden Douglas C-54 Skymaster, die 49 Passagiere und drei Mann Besatzung befördern konnte, um zur letzten Etappe seiner bedeutsamen Reise aufzubrechen. An deren Ende würde er insgesamt 28.000 Kilometer zurückgelegt und dabei fast acht Zeitzonen durchquert haben. Josef Stalin seinerseits brauchte bloß von Moskau aus genau nach Süden zu reisen. Seine Hin- und Rückreise würde nur knapp 5000 Kilometer umfassen. Aber all dies schien vergessen, da die Führer der drei Großmächte sich endlich und zum ersten Mal in mehr als vier Jahren Krieg von Angesicht zu Angesicht begegnen sollten, um politische Leitlinien festzuschreiben und das Gemetzel zu beenden. Es wurde die wichtigste Konferenz des Konflikts. Wie Churchill später schrieb: „Die aus der amerikanischen Verfassung erwachsenen Schwierigkeiten, der Gesundheitszustand des Präsidenten, die Hartnäckigkeit Stalins […], all das wurde von der zwingenden Notwendigkeit einer Dreieraussprache und der Unmöglichkeit, eine andere Lösung als den Flug nach Teheran zu finden, weggewischt. So erhoben wir uns im ersten Morgengrauen des 27. November bei herrlichem Wetter in Kairo in die Luft und trafen auf verschiedenen Routen und zu verschiedenen Stunden wohlbehalten am langgesuchten Treffpunkt ein.“2
Im Nachhinein ist es schwierig, die Strapazen und die Kühnheit dieser Reise zu ermessen. Der an den Rollstuhl gefesselte Präsident der Vereinigten Staaten flog in Kriegszeiten und ohne Geleitschutz durch Militärmaschinen über den Mittleren Osten hinweg, und das nicht einmal in seinem eigenen Flugzeug. Die erste offizielle Präsidentenmaschine mit dem Spitznamen Guess Where II war nichts weiter als ein umgebauter B-24-Bomber mit der Bezeichnung C-87A Liberator gewesen, und Roosevelt hatte sie nie benutzt.3 Nachdem eine andere C-87A abgestürzt war und man festgestellt hatte, dass die Konstruktion eine beunruhigende Feuergefahr barg, etwas, wovor sich Roosevelt besonders fürchtete,4 wurde Guess Where II stillschweigend aus dem präsidialen Dienst ausgemustert. Eleanor Roosevelt benutzte die Maschine allerdings auf einer Goodwilltour durch Lateinamerika, und auch höhere Mitarbeiter des Weißen Hauses flogen damit, nicht aber Präsident Franklin D. Roosevelt, der das Fliegen ohnehin verabscheute.
Der gelähmte Präsident zog fast jede Art des Reisens auf festem Boden vor, aber selbst hier hatte er Bedenken. Zunächst einmal konnte er es nicht ertragen, mit einem Zug zu fahren, der schneller als 50 Stundenkilometer fuhr. Wirklich sicher fühlte er sich nur in seinem Präsidentenzug, der über eine spezielle Aufhängung zur Stützung seines Unterkörpers verfügte, dessen Seitenwände gepanzert und dessen Scheiben kugelsicher waren. Als versierter Segler fühlte er sich auch auf dem Wasser wohl, wo er mit dem Stampfen und Rollen der Wellen zurechtkam. Aber Fliegen? Das war eine ganz andere Geschichte, eine mit beträchtlichem persönlichen Risiko. Schon Turbulenzen waren problematisch, weil sich der Präsident „nie […] mit seinen Beinen gegen die heftigen Stöße und Erschütterungen stemmen konnte“, erinnerte sich Mark Reilly, der Leiter von Roosevelts Secret-Service-Sonderabteilung. Und Roosevelt wusste sehr wohl, wie eingeschränkt er durch seine nutzlosen Beine war – er hätte ja nicht einmal die Chance gehabt, aus einem Flugzeugwrack zu kriechen.
Vor jener Reise von Kairo nach Teheran hatte Roosevelt erst zwei Flüge gewagt, einen davon nach Chicago im Jahr 1932, um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten anzunehmen. Auf diesem Flug waren bis auf Roosevelt und sein erwachsener Sohn Elliott sämtliche Passagiere luftkrank geworden. Vor dem Start hatten hilfsbereite Mechaniker einen der Sitze entfernt, um für Roosevelt mehr Platz zu schaffen, aber keiner der Passagiere hatte Sicherheitsgurte, sodass sich alle an die gepolsterten Armlehnen ihrer Aluminiumsitze klammern mussten, um nicht hin und her geschleudert zu werden, als die Maschine in Turbulenzen geriet. Der Motorenlärm in der Kabine war ohrenbetäubend, und die Höchstgeschwindigkeit der Maschine lag bei knapp über 160 Stundenkilometern. Zwei Militärflugzeuge, die als Geleitschutz fungierten, und eine Chartermaschine, die Reporter beförderte, kehrten angesichts von Gewittern und schweren Gegenwinden um, während die Maschine, in der Roosevelt saß, sich unermüdlich weiter durch die Unwetter kämpfte. Im Januar 1943 stieg Roosevelt dann abermals in den Himmel auf, um sich in Casablanca mit Churchill zu treffen. Seine achtköpfige Delegation startete von Miami in einem Flugzeug für 40 Passagiere, dem Dixie Clipper, machte einen Sprung über die Karibik nach Brasilien und überquerte dann in 19 Stunden den Atlantik von Südamerika nach Westafrika. Die Boeing 314 Clipper war ein Flugboot und besaß, obwohl sie über geräumige Kabinen und Schlafkojen einschließlich eines Doppelbetts für Roosevelt verfügte, keinen Druckausgleich, und in größeren Höhen wurde der Präsident stets kreidebleich und musste manchmal mit Sauerstoff versorgt werden.5 Jedenfalls war diese erste Flugreise eines amtierenden Präsidenten kaum geeignet, ihn zu bekehren. „Du kannst Deine Wolken haben“, schrieb er seiner Frau Eleanor, die im Gegensatz zu ihm eine begeisterte Fliegerin war, „mich langweilen sie.“6
Jetzt aber, nur zehn Monate später, befand er sich schon wieder hoch droben in den Lüften, diesmal in der Sacred Cow.
Die gut 2000 Kilometer lange Reise führte Roosevelt an jenem Morgen ostwärts, dröhnend durch den strahlenden Sonnenschein über den Suezkanal und die riesige Weite der Wüste Sinai hinweg. Dann ging der Pilot tiefer und kreiste in geringer Höhe über den heiligen Stätten Jerusalem und Bethlehem, die im morgendlichen Sonnenschein glitzerten. Anschließend stieg die Maschine über Ketten uralter Wadis, dann über die heilige Stätte Masada, jene markante Festung im Judäischen Gebirge, in der eine kleine Gruppe von Juden im Frühjahr des Jahres 73 n. Chr. den Tod der Sklaverei vorzog, nachdem sie einer ganzen römischen Legion fast drei Monate lang getrotzt hatten.7 Als das Flugzeug Bagdad erreichte, drehte der Pilot nach Nordosten ab und folgte anschließend der Fernstraße von Abadan nach Teheran, die das Flugzeug durch eine schwierige Abfolge zerklüfteter Gebirgspässe leitete. Doch es gab keine Alternative: Die Maschine musste unter 6000 Fuß bleiben, um die Sauerstoffversorgung für den Präsidenten stabil zu halten. Als Roosevelt aus dem Fenster des Flugzeugs starrte, ragte unter ihm eine Kette von Bergen aus einer Steinwüste auf, die einer braunen, verblichenen Mondlandschaft glich. Das Land lag weit und leer, abgesehen von dem erhebenden Anblick von Zügen und Lastwagenkolonnen, die mit Kriegsmaterial aus amerikanischer Produktion beladen unterwegs waren Richtung Ostfront.
Um drei Uhr nachmittags landete die Maschine des Präsidenten endlich auf einem Flugplatz der Roten Armee in Teheran, wo Stalin bereits wartete. Er war 24 Stunden vor den Briten und Amerikanern in der Stadt eingetroffen und hatte sich in der russischen Gesandtschaft niedergelassen, um persönlich die Verwanzung einer privaten Zimmerflucht zu überwachen, welche der amerikanische Präsident beziehen würde.8
„Schäbig“ – mit diesem Wort beschrieb Elliott Roosevelt Ende November 1943 Teheran.9 Die iranische Hauptstadt war beinahe buchstäblich eine Kloake. Außer in der amerikanischen, der sowjetischen und der britischen Gesandtschaft gab es praktisch nirgends fließend Wasser. Einwohner und Besucher schöpften ihr Trinkwasser gleichermaßen aus einem Bach im Rinnstein, der auch als Abwasserkanal diente. Im Stadtzentrum war ein Großteil des öffentlichen Trinkwassers daher durch Müll und Abfälle verunreinigt. Mit jedem Schluck riskierte man Fleckfieber oder Ruhr, und Ausbrüche von Typhus waren an der Tagesordnung. Die Stadt war aber auch in anderer Hinsicht unattraktiv, war sie doch von alliierten Truppen besetzt, und es fehlte selbst an den grundlegendsten Dingen des täglichen Bedarfs. Ein Sack Mehl konnte einen gut und gerne ein Jahresgehalt kosten.
Die Stadt war also weit entfernt davon, auch nur Erinnerungen an eine sagenumwobene und glamouröse Vergangenheit zu wecken. Ohnehin war Teheran unter den Hauptstädten der Welt beinahe ein ebensolcher Neuling wie das junge Washington, D.C., das zu Beginn kaum mehr als eine pittoreske, halb bäuerliche Ansiedlung gewesen war und als „Stadt der großartigen Entfernungen“ verspottet wurde.10 Im Gegensatz dazu hatten Teherans insgesamt etwa 20.000 Einwohner im Jahr 1800 innerhalb sechs Meter hoher Lehmmauern gelebt, von einem zwölf Meter breiten und bis zu neun Meter tiefen Graben umgeben.
Die Stadt war früher ausschließlich durch insgesamt vier Tore zugänglich gewesen, doch im Jahr 1943 waren diese längst abgerissen, und jenseits der ursprünglichen Mauern war eine neuere Stadt entstanden. Verschwunden waren viele der malerischen alten Häuser, die zu einer verschachtelten Reihe kunstvoller Höfe und sagenhafter persischer Gärten hin gelegen waren. Verschwunden waren die mit Datteln und Feigen, Honig und Henna beladenen Eselskarren, die unterwegs waren zu den belebten Märkten. Stattdessen boten nun neue Häuser einen Blick auf breite Straßen mit ausreichend Platz für Automobile, Lastwagen und nur noch gelegentlich einem Pferd oder einem Karren. Jenseits dieser modernen Boulevards ging die Stadt in einen weiten, kargen Raum über, der aus kaum mehr bestand als Weideland und Ölfeldern.
Die Fahrt der Regierungschefs und begleitenden Berater vom Flugplatz in die Teheraner Innenstadt war alles andere als beschaulich, führte sie der Weg doch über weite Strecken zwischen neugierigen Zuschauern hindurch und kilometerlang über ungeschützte Straßen. Auch Winston Churchill hatte, als er eine Dreiviertelstunde nach den Amerikanern eintraf, eine Fahrt hinter sich, die ähnlich gefährlich gewesen war wie jene von Erzherzog Franz Ferdinand 1914 durch die Straßen von Sarajevo. Churchills Tochter Sarah, die bei ihm war, bezeichnete die Autofahrt als „schaurig“. Die Straßen waren uneben, überall gab es Menschenaufläufe, und die Sicherheitsvorkehrungen waren äußerst dürftig. Churchill selbst bemerkte trocken: „Wenn man sich vorgenommen hätte, das grösste Risiko zu laufen […], hätte man das Problem nicht besser lösen können.“11 Der Premierminister und seine Tochter reisten in einem ungesicherten Wagen, während ihr britischer Sicherheitstrupp in einem geschlossenen Jeep folgte, viel zu weit entfernt, um bei eventuellen Schwierigkeiten von großem Nutzen zu sein.
Die Strecke in die Stadt war gesäumt von herrlichen Schimmeln der persischen Kavallerie, und in Teheran selbst drängten sich Menschen zwischen die blendend weißen Tiere. Die alliierten Sicherheitstrupps fürchteten unterdessen ständig eine zielgenau geworfene Granate oder einen Pistolenschuss, und das aus gutem Grund: Gegen Ende der Fahrt kam der britische Wagen im Verkehr zum Stehen, und neugierige Iraner umschwärmten das Fahrzeug. Churchill lächelte die Menge die ganze Zeit unerschrocken an, bis der Verkehr sich teilte und er wieder unterwegs war. Sobald er seine von einem Regiment indischer Sikhs streng bewachte Botschaft erreichte hatte, wimmelte er alle Treffen ab und begab sich direkt zu Bett – mit einer Flasche Scotch und jeder Menge Wärmflaschen.12
Während Churchill es sich in seinem Bett bequem machte, verbrachte Roosevelt seine erste und einzige Nacht in der Residenz des amerikanischen Gesandten am Stadtrand von Teheran. Die Residenz war gut sechs Kilometer von der sowjetischen und der britischen Botschaft entfernt, die im Zentrum der Stadt fast nebeneinander lagen. Die amerikanische Botschaft selbst war gut anderthalb Kilometer entfernt. Dennoch sollten weder Roosevelt noch Stalin und Churchill später durch die unberechenbaren Straßen Teherans fahren, um sich zu treffen.
Sei es aus Paranoia, aus Angst vor einem Attentat oder aus Hinterlist, Stalin schien vor allem etwas gegen eine Fahrt zur amerikanischen Residenz zu haben. Am Tag von Roosevelts Ankunft lehnte er sogar eine Einladung des Präsidenten zum Abendessen ab, indem er Erschöpfung vorschützte. Stattdessen berichteten die Sowjets, während Roosevelt sich einlebte, den Amerikanern besorgt, dass ihre Geheimdienste einen Attentatsplan gegen einige oder alle Staatsführer auf der Konferenz aufgedeckt hätten. Das sowjetische Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, kurz NKWD, der Vorläufer des KGB (Komitee für Staatssicherheit), behauptete, 38 Fallschirmjäger der Wehrmacht seien in der Nähe von Teheran über russischem Territorium abgesprungen. Der Verbleib von 32 sei inzwischen bekannt, doch von den sechs übrigen fehle jede Spur, und diese hätten einen Funksender. Ob das echte oder vorgespielte Besorgnis war, blieb ungewiss. Auf jeden Fall bot Stalin, um einem Problem vorzubeugen, Roosevelt für die verbleibende Zeit in Teheran eine Zimmerflucht in dem schwer bewachten sowjetischen Komplex an. Hatte Roosevelt eine erste solche Einladung von Stalin noch durch einen Boten höflich ausgeschlagen, so nahm der Präsident sie diesmal an. Am folgenden Tag zog er mit seinem persönlichen Stab in den weiträumigen sowjetischen Komplex.13 Nach außen hin zeigte Roosevelt wenig Anzeichen von Besorgnis, im Gegensatz zu seinem Geheimdienst. Äußerst beunruhigt wegen der offensichtlichen deutschen Gefahr, postierte er die Agenten entlang der gesamten Hauptroute und schickte sodann einen schwer bewaffneten Konvoi aus Personenwagen und Jeeps als Köder los. Sobald diese Kavalkade losgefahren war und sich langsam einen Weg durch die Hauptstraßen Teherans bahnte, wurde Roosevelt eilig in ein anderes Auto mit einem einzigen Jeep als Eskorte gesetzt und „im Affenzahn“ durch die alten Seitenstraßen Teherans zur sowjetischen Gesandtschaft expediert. Roosevelt amüsierte sich köstlich über das „Räuber-und-Gendarm“-Spiel, wie er die Aktion nannte, aber die zu seinem Schutz abgestellten Agenten, die es besser wussten, hatten fürchterliche Angst.14
Sobald sie sich innerhalb des sowjetischen Geländes befanden, stellten die Secret-Service-Agenten fest, dass sie zahlenmäßig ziemlich in der Minderheit waren. In ganz Teheran waren bereits etwa 3000 NKWD-Agenten zu Stalins persönlichem Schutz aufgeboten. Und nirgendwo war diese Präsenz offenkundiger als innerhalb der sowjetischen Residenz. „Auf Schritt und Tritt“, stellte Mike Reilly fest, „sah man irgendeinen ungehobelten Kerl in weißer Lakaienlivree, der geschäftig makelloses Glas polierte oder staubfreie Möbel wischte. Wenn sie beim Staubwischen oder Polieren mit den Armen wedelten, war an jeder Hüfte der klare, kalte Umriss einer Luger Automatik zu sehen.“15 Tatsächlich hatte sogar Scotland Yard weit mehr Leute zum Schutz von Churchill abgestellt als die Amerikaner für Roosevelt.
Endlich konnte die Teheraner Konferenz der alliierten Mächte beginnen. In den kommenden Tagen würden die drei Staats- und Regierungschefs und ihre Militärs nichts Geringeres tun, als den alliierten Kurs für den Rest des Krieges festzulegen und einen Frieden zu skizzieren. Doch wie die Sicherheitsvorbereitungen der Amerikaner war auch der Gipfel selbst mehr oder weniger improvisiert. Die Amerikaner hatten sich bis zu ihrem Eintreffen nicht einmal Gedanken darüber gemacht, wer bei den Besprechungen auf höchster Ebene Protokoll führen sollte. Um dieses eklatante Versehen auszubügeln, schnappte man sich in aller Eile aus dem nahe gelegenen amerikanischen Militärlager vier Soldaten mit Stenografie-Kenntnissen und beauftragt sie, nach jeder Sitzung ein Diktat aufzunehmen. Aber es gab immer noch keine Tagesordnung und niemanden, der angewiesen worden wäre, die Treffen zu organisieren oder sich um die Logistik zu kümmern. Eine Folge davon war, dass der amerikanische Generalstabschef George C. Marshall tatsächlich das erste Treffen verpasste. Er hatte die Anfangszeit falsch verstanden und sich stattdessen die Sehenswürdigkeiten der Stadt angesehen.
Außerdem war der Präsident ohne irgendwelche Positionspapiere, das bürokratische Lebenselixier Washingtons, in Teheran eingetroffen. Kurz, die Konferenz war ein klassischer Roosevelt.16 Wie immer hielt er nichts von Regeln oder Vorschriften, wenn sie ihm nicht passten. Seine Pläne waren einfach: improvisieren, seinen eigenen Instinkten folgen und seine eigene Agenda betreiben. Er war hauptsächlich nach Teheran gekommen, um seinen legendären Prospero-Zauber auf Stalin wirken zu lassen.17 Im Prinzip wollte sich Roosevelt den sowjetischen Führer zum Freund und Verbündeten machen, ihn ins Boot holen, wie es ihm sein Leben lang mit so vielen geglückt war.
Nur wenige Männer in der amerikanischen Geschichte haben eine derartige Kombination aus erstaunlichen politischen Talenten und überragenden Führungsqualitäten in die Präsidentschaft eingebracht wie Franklin D. Roosevelt. Er war von Natur aus ein Heuchler, Intrigant und Betrüger, aber er besaß auch einen unbezähmbaren Willen und ein tiefsitzendes Gefühl der Unsterblichkeit. Dass, als Roosevelt zum ersten Mal ins Weiße Haus gewählt wurde, ernsthaft von einer Revolution die Rede war, und das politische System Amerikas kurz davor zu stehen schien, sich aufgrund der erheblichen Belastungen durch die Große Depression von innen zu zersetzen, wird allzu leicht vergessen. Aber durch Improvisation und Anpassung, seine legendäre Rednergabe und sein ständiges Experimentieren gelang es Roosevelt, eine entmutigte Nation moralisch aufzurichten. Jetzt, wo sich das Geschick der Alliierten auf den weit entfernten Kriegsschauplätzen allmählich wendete, erwartete die Welt von ihm, dass er dasselbe im Krieg vollbrachte.
Wie wäre er genau zu beschreiben? Niemand auf der globalen Bühne war ihm gegenüber neutral, und er war in jedem Sinne sui generis, einzigartig. Politisches Genie und begeisterter Ehrgeiz vereinten sich in ihm auf staunenswerte Weise. Er war ein Aristokrat wie Thomas Jefferson, ein Populist wie Andrew Jackson, schlau wie Abraham Lincoln und beliebt wie George Washington. Er war so zügellos wie originell, so Respekt einflößend wie kosmopolitisch, so quicklebendig wie extravagant und so provozierend, wie er rätselhaft sein konnte. Und er war großgewachsen, eine Tatsache, die verborgen blieb, nachdem Polio seinem zuvor etwas o-beinigen Gang ein Ende setzte: Er maß 1,85 Meter, der viertgrößte Präsident der Nation, größer als Ronald Reagan oder Barack Obama.
Doch hatte sich auch sein Aufstieg zu historischer Größe angedeutet? Er wurde am späten Abend des 30. Januar 1882 als Sohn enorm reicher und privilegierter Eltern geboren – „ein hübscher kleiner Bursche“ – und blieb ein Einzelkind. Ein Verwandter beschrieb ihn mit beeindruckender Weitsicht als „anständig, lieb und gewitzt“. Seine Mutter, Sara Ann Delano, die ihn abgöttisch liebte, nahm beherrschenden Einfluss auf sein Leben, doch seinen Vater James, einen Anwalt, der schon Mitte fünfzig war, als Franklin zur Welt kam, verehrte er. Aufgezogen auf dem Familienanwesen in Hyde Park, New York, war er faktisch der Mittelpunkt eines Universums. Roosevelt wurde von Privatlehrern und Erzieherinnen zu Hause unterrichtet und von allen möglichen Haushaltshilfen bemuttert, alles unter den wachsamen Augen von Sara. Von klein auf wurden ihm die Feinheiten der Schreibkunst, die öden Einzelheiten der Arithmetik und die Lektionen der Geschichte eingepaukt. Und dank eines Schweizer Lehrers lernte er, Deutsch, Französisch und Latein fließend zu sprechen. Außerdem entwickelte er ein soziales Verantwortungsgefühl dafür, dass die vom Glück Begünstigten den weniger Glücklichen helfen sollten.
Seine Mutter las ihm jeden Tag vor – auch aus seinen Lieblingsbüchern Robinson Crusoe und Der schweizerische Robinson –, während sein Vater ihn zum Reiten, Segeln und auf die Jagd mitnahm. Franklin führte ein verhätscheltes, behütetes Leben. Als er noch ganz klein war, steckte seine Mutter ihn in Kleider und ließ seine Locken lang wachsen, später zog sie ihm Schottentracht an. Mit sieben Jahren trug er dann endlich Hosen – kurze Hosen, die zu Mini-Matrosenanzügen gehörten. Er hatte bis zum Alter von neun Jahren nachweislich noch nie allein gebadet und als Junge nur wenige Freunde. Den größten Teil seiner Zeit verbrachte er unter oftmals berühmten Erwachsenen, so lernte er etwa schon mit fünf Präsident Grover Cleveland kennen. Dieser bettete Franklins Kopf in seine Hand und sagte: „Mein kleiner Mann, ich wünsche dir etwas Seltsames. Mögest du niemals Präsident der Vereinigten Staaten werden.“18
Die Familie Roosevelt reiste ausgiebig, hielt sich jedes Jahr zeitweilig in Europa auf, überwinterte in Washington, D.C., wo die Familie das prunkvolle Stadthaus des belgischen Gesandten in der eleganten K Street mietete, und verbrachte den Sommer auf Campobello Island, einem herrlichen Eiland vor der zerklüfteten Küste von Maine, wo Franklin sich in das Wasser verliebte und in ihm eine lebenslange Leidenschaft für das Segeln wuchs. Er besaß dort ein Boot, die sechseinhalb Meter lange New Moon, ein Geschenk seines Vaters, und begann von einer Karriere bei der Marine zu träumen.
Auch Reiten lernte er schon in jungen Jahren. Bereits im Alter von vier Jahren tollte er mit einem Esel herum und später, als er sechs war, mit einem Welsh-Pony. Doch so sehr er verhätschelt wurde, waren seine Eltern auch bestrebt, dem jungen Franklin Verantwortungsgefühl anzuerziehen. Wie? Indem sie ihm Hunde zum Aufpassen gaben: zuerst einen Spitz-Welpen, dann einen Bernhardiner, später einen Neufundländer und schließlich einen prachtvollen roten Irish Setter. Zugleich entwickelte er sich zum passionierten Sammler: von ausgestopften Vögeln, die an seinen Wänden hingen; weiter von Marine-Americana, die er als leidenschaftlicher Segler schätzte; und, seit seinem fünften Lebensjahr, von Briefmarken, für die er sich sein Leben lang interessierte. Am Ende füllte seine Sammlung mehr als 150 Alben mit über einer Million Marken.
Als Franklin neun Jahre alt war, erlitt sein Vater einen leichten Herzinfarkt, und obwohl James noch weitere zehn Jahre lebte, war er fortan körperlich ausgesprochen schwach. Für Franklin, der seinen Vater verehrte und vergötterte, war dies geradezu niederschmetternd. Fünf Mal im Laufe der nächsten sieben Jahre suchte die Familie die warmen Mineralbäder im deutschen Bad Nauheim auf, die im Ruf standen, heilende Kräfte für kränkliche Herzpatienten zu besitzen. James und Sara schworen jedenfalls auf die Wirkung der Bäder und, wie vorauszusehen, auch der kleine Franklin, der später Mineralquellen in Warm Springs, Georgia, aufsuchen würde. Wie ging Roosevelt mit der Krankheit seines Vaters um? Wie mit allem anderen: erstaunlich gelassen. Sein Rettungsanker war hier, obwohl er nicht darüber redete, teilweise sein episkopaler Glaube. Er glaubte damals – und insgeheim für den Rest seines Lebens –, mit dem nötigen Gottvertrauen würde alles ein gutes Ende nehmen.
Im Alter von 14 Jahren trat er in die Groton School ein, damals die angesehenste Privatschule im ganzen Land. Das Schulgeld war unverschämt hoch, nur die Superreichen konnten es sich leisten. Der Zweck der Schule ging weit über die Pflege der intellektuellen Entwicklung hinaus. Gefördert werden sollte auch der „mannhafte christliche Charakter“ der privilegiertesten Jungen Amerikas, in moralischer ebenso wie in körperlicher Hinsicht. „Charakter, Pflicht, Land“ lautete das tägliche Credo, und der Alltag war beinahe klösterlich. Roosevelt war intelligent und besaß eine rasche Auffassungsgabe, was ihm eine Auszeichnung in Latein einbrachte, und er war ein fähiger Debattierer. Mehr allerdings auch nicht, denn er war weder ein origineller Denker noch besonders reflektiert. Aber der Gründer der Schule, Reverend Endicott Peabody, ein charismatischer episkopaler Geistlicher, sollte großen Einfluss auf Roosevelt ausüben, mehr als jeder andere, ausgenommen, wie Franklin eines Tages bekannte, sein Vater und seine Mutter.19
Für Peabody, der das Ethos eines wehrhaften Christentums verkörperte, war sportlicher Widerstreit ebenso wesentlich bei der Erziehung der Groton-Schüler wie der Unterricht selbst. Da er in der Behaglichkeit und Abgeschiedenheit von Hyde Park aufgewachsen war, blieb Roosevelt folglich ein Außenseiter: Er hatte noch nie einen Mannschaftssport betrieben und war ohnehin nicht besonders sportlich. Wie zu erwarten, steckte man ihn in ein Footballteam, das größtenteils Außenseitern und Eigenbrötlern vorbehalten war; es war die zweitschlechteste Mannschaft. Beim Baseball lief es kaum besser: Hier spielte er im schlechtesten Team. Doch seine Leidenschaft für diesen Sport ließ, so unbegabt er auch war, nie nach. Kraft der Begeisterung erhielt er im Baseballteam sogar eine Schulauszeichnung, allerdings nicht für seine spielerische Leistung, sondern wegen seiner Bemühungen als Zeugwart.
Als er sich im Herbst 1900 in Harvard einschrieb, waren ihm die Ideale von Groton zur zweiten Natur geworden: Arbeite hart und ernte den Lohn, stürze dich in den Wettstreit und akzeptiere Anstrengung als den Schlüssel zum Erfolg. Hatte das verwöhnte Einzelkind Roosevelt dort in Groton den zwanglosen Umgang mit seinesgleichen erlernt, so entwickelte es in Harvard, Amerikas elitärster Universität, damals vom legendären Präsidenten Charles W. Eliot geleitet, die Fähigkeit, diese anzuführen. Dennoch legte Roosevelt die Lebensweise des reichen Müßiggängers kaum ab. Seine Welt war die der eleganten Lebemänner mit guten Beziehungen; der Cocktails und Polo-Spiele; der Jagd mit Hunden und der Cross-Country-Pferderennen; des Tennis in Bar Harbor und des Segelsports in Newport. Er wohnte auch nicht auf dem Campus, sondern mietete in der Mount Auburn Street für die verschwenderische Summe von 400 Dollar im Jahr eine luxuriöse Drei-Raum-Ecksuite, besaß ein Pferd und war in der regen gesellschaftlichen Saison ein beinahe wöchentlicher Gast auf den Jagdbällen, den üppigen Dinners mit Smokingzwang und den fortwährenden Debütantinnenpartys. Als der Porcellian, der erlauchteste Harvard-Club, ihn ablehnte, war er geknickt.20 Dafür war er unter den Auserwählten der studentischen Verbindung Alpha Delta Phi und Mitglied der Hasty Pudding Theatricals, der 1795 gegründeten ersten amerikanischen Studententheatergesellschaft, der er als Bibliothekar diente. Außerdem wurde er in die Redaktion der Uni-Zeitung Harvard Crimson gewählt, deren Chefredakteur er schließlich wurde – eine große Ehre. Seine Aufgaben beim Crimson waren umfangreich und oftmals ermüdend – „die Zeitung beansprucht jeden Moment meiner Zeit“, schrieb er seiner Mutter –, aber er hielt sich bewundernswert und entwickelte in dieser Zeit ein Verständnis für die innere Funktionsweise der Medien, was ihm später, als er die politische Arena betrat, gute Dienste leisten sollte. Sein eigentliches Studium absolvierte er mehr oder weniger mit links, ohne sich allzu sehr zu verausgaben. Dank seiner Ausbildung auf der Groton School konnte er die obligatorischen Erstsemester-Veranstaltungen überspringen. Was die Wahlfächer betraf, so mied er theoretische Kurse wie Philosophie, stattdessen faszinierten ihn Geschichte, Staatsführung und Volkswirtschaftslehre, ein Thema, über das er später äußern sollte: „Alles, was man mir beibrachte, war falsch.“21 Und wie auf der Groton brachte er es nicht zu akademischen Ehren, obwohl seine Noten ordentlich waren.
Im Spätherbst seines ersten Studienjahrs erhielt er die Nachricht, dass sein Vater erneut zwei kurz aufeinanderfolgende Herzinfarkte erlitten hatte. Die Familie eilte nach New York, damit James in größerer Nähe der Spezialisten sein konnte, dennoch verschlechterte sich sein Zustand weiter. Im Kreise seiner Lieben, die sich um sein Bett versammelt hatten, starb er schließlich am 8. Dezember 1900 um 2.20 Uhr morgens. Obwohl es emotional ein großer Verlust war, sollte es der Familie materiell auch weiter an nichts fehlen. Sara hatte zwei Jahre zuvor von ihrem Vater eine Summe geerbt, die heute etwa 37 Millionen Dollar entspräche, und James hinterließ ihr und Franklin bei seinem Hinscheiden ein Anwesen, das heute über 17 Millionen Dollar wert wäre.
Schmerzerfüllt meisterte die Familie die Lage durch Reisen. Statt sich im darauf folgenden Sommer wieder nach Campobello Island zu begeben, verbrachten Franklin und Sara zehn Wochen außer Landes in Europa: zuerst auf einem eleganten Kreuzfahrtschiff, das sie durch die majestätischen Fjorde Norwegens und rund um den Polarkreis führte, wo sie Kaiser Wilhelm II. begegneten. Dann reisten sie weiter nach Dresden, wo Sara als Mädchen zur Schule gegangen war, und genossen anschließend die Sommerfrische am Genfer See. Schließlich reisten sie weiter nach Paris, wo sie erfuhren, dass Präsident William McKinley einem Attentat zum Opfer gefallen war, womit sich ihr Leben radikal änderte: Plötzlich waren sie nicht einfach nur reich, sondern Teil der politischen Nomenklatura, trat doch der unnachahmliche Theodore Roosevelt, Franklins Cousin, die Nachfolge McKinleys an.
Jener erste Winter ohne James war ein schwieriger Übergang. Sara fand das Leben ohne ihn öde. Sie bemühte sich nach besten Kräften, sich zu beschäftigen, indem sie die vielen Arbeiter auf dem Anwesen beaufsichtigte und sich um die häufig komplizierten, teilweise chaotischen geschäftlichen Angelegenheiten des Besitzes kümmerte. Aber bald schon richtete sie ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf ihren Sohn.
Am Jahresanfang verbrachte Franklin zu Ehren der Präsidententochter Alice, die ihre Debütantinnenparty feierte, drei stürmische Tage im Weißen Haus. Zweimal lud der Präsident ihn während seines Aufenthalts auf ein privates Gespräch zum Tee. „Mit die interessantesten und amüsantesten drei Tage, die ich jemals hatte“, schrieb Franklin seiner Mutter.22
Kurz nachdem Roosevelt nach Harvard zurückgekehrt war, zog seine Mutter nach Boston, um sich ihm zuzugesellen, hielt sie doch das Leben allein in Hyde Park nicht aus. Sie bezog eine Wohnung, schloss neue Freundschaften und wurde Teil der abgeschlossenen, elitären Welt des Bostoner Geldadels. Und sie wurde erneut eine Konstante in Roosevelts Leben, der sich keineswegs darüber ärgerte, sondern es genoss, sie in seiner Nähe zu haben. Nicht selten bat er seine Mutter sogar, seine Verabredungen zu billigen.
Roosevelt liebte die Gesellschaft von Frauen. Während seiner ersten 15 Lebensjahre hatte er kaum Kontakt zum anderen Geschlecht gehabt, was sich aufgrund der Prüderie des Viktorianischen Zeitalters auch auf der Groton School kaum änderte. In Harvard jedoch lagen die Dinge anders. Hier verliebte er sich in die reizende Frances Dana, allerdings redete ihm seine Mutter eine Ehe aus, weil Frances Katholikin und die Roosevelts und Delanos Protestanten waren. Es folgte Alice Sohier, die Tochter einer angesehenen North-Shore-Familie, die in einem eleganten Stadthaus in Boston lebte. Roosevelt und Alice sprachen über Heirat, und er gestand ihr, dass er sich sechs Kinder wünsche. Vor dieser Aussicht schreckte Alice jedoch zurück. Einer engen Freundin vertraute sie an: „Ich will keine Kuh sein.“23 Im Herbst 1902 beendete sie die Beziehung und ging stattdessen nach Europa.
Nun lernte Roosevelt eine großgewachsene, „hoheitsvolle“, „fohlenhafte“ blauäugige junge Frau namens Eleanor kennen, seine Nichte sechsten Grades und die verwaiste Tochter seines Patenonkels Elliott Roosevelt. In gewisser Weise war die Annäherung von Eleanor und Franklin sorgfältig choreografiert.
Als Geschöpfe der eleganten New Yorker Gesellschaft besuchten sie in jenem Herbst das wichtigste Reitturnier im Madison Square Garden, wo sie sich in der Familienloge niederließen. Später faulenzten sie gemeinsam auf dem gepflegten Rasen in Springwood, unter den wachsamen Augen einer Anstandsdame. Abends speisten sie an Bord von Roosevelts motorisierter Segeljacht, der Half-Moon. Und schon am Neujahrstag gehörten sie in Washington zum inneren Kreis, als Theodore – der sowohl Eleanors Onkel als auch Franklins Cousin war – im East Room des Weißen Hauses stand und lange Schlangen von Anhängern herzlich begrüßte. Bald darauf dinierten sie inmitten von poliertem Silber und glitzernden Kronleuchtern im Bankettsaal des Weißen Hauses mit Theodore persönlich. Aber Franklins Gedanken waren weit weg von der Politik. „E ist ein Engel“, schrieb ein verliebter Roosevelt in sein Tagebuch.
Eleanors Welt war noch behüteter und weit tragödienreicher als die von Franklin. Als Eleanor acht war, starb ihre Mutter, Anna Rebecca Hall, die oft durch Migräne und Anfälle tiefer Depression geschwächt war, an Diphterie. Zwei Jahre später starb ihr Vater, Elliott. Der charmante Playboy hatte unter zahlreichen inneren Dämonen gelitten, und seine Exzesse waren hemmungslos gewesen: Er war ein verwegener Schürzenjäger, und wenn er kein Morphium oder Laudanum nahm, dann trank er schwer, bis zu einem halben Dutzend Flaschen Schnaps pro Tag. Mal war er zu betrunken, um einem Taxifahrer zu sagen, wo er wohnte, ein andermal wäre er beinahe aus seinem Wohnzimmerfenster gesprungen. Am 13. August 1894 verlor er das Bewusstsein, und am nächsten Morgen war er tot.
Fortan lebte Eleanor bei ihrer Großmutter mütterlicherseits in ihrem eleganten Stadthaus in der West 37th Street, auf dem Anwesen der Familie am Hudson, oder sie ging in Wimbledon Park in England aufs Internat, wo sie ein ebenso freudloses Leben führte. Häufig umgeben von Köchen, Butlern, Hausmädchen, Waschfrauen, Kutschern und Privatlehrern, hatte sie nur wenige Freundinnen und praktisch keinerlei Umgang mit anderen Kindern, ausgenommen Theodore Roosevelts Tochter Alice. Im Gegensatz zu Franklins Mutter war Eleanors Großmutter eine strenge Zuchtmeisterin. Eleanors Leben bestand aus Üben und noch mal Üben: Klavier, Tanzunterricht, Rasentennis, Schießen und Reiten. Wie Franklin wurde sie außerdem privat in Deutsch und Französisch unterrichtet, und Letzteres sprach sie später fließend. So wie dieser mühelos auf Deutsch zu plaudern vermochte, führte sie ausgedehnte Unterhaltungen auf Französisch und tat sich mit der Zeit auch in Italienisch hervor.
Dennoch fehlte es ihr an Selbstvertrauen, und sie hielt sich für ein hässliches Entlein. Aber im Laufe der Monate lernte sie schlauerweise, ihre Selbstzweifel zu kompensieren. Als sie mit 15 Jahren in die Allenswood Academy eintrat, ein Internat in England, das in vielerlei Hinsicht ebenso renommiert war wie die Groton School und wo der Unterricht komplett auf Französisch stattfand, wurde sie zum beliebtesten Mädchen der Schule. Sie war ernst, eifrig und fleißig. Und sie war ziemlich schnell von Begriff. Die Rektorin der Schule, eine glühende Feministin, lehrte Eleanor, die orthodoxen Konventionen ihrer Zeit zu hinterfragen und ihre Gedanken offen zu äußern, eine skandalöse Freiheit im patriarchalischen Viktorianischen Zeitalter.24 Schon in jungen Jahren war sie eine leidenschaftliche Progressive, interessierte sie sich für das politische Geschehen. Später erklärte sie, dass sie unter Anleitung der Rektorin, die großen Einfluss auf sie hatte, einen „freien Geist und eine starke Persönlichkeit“ entwickelt habe. Und im Gegensatz zu Franklin, dessen sportliche Erfolge bestenfalls bescheiden waren, schaffte sie es im Feldhockey in die erste Mannschaft und wurde sogar deren Spielführerin.
An den kühlen Herbsttagen des Jahres 1903 gingen Roosevelt und Eleanor aus, natürlich immer mit einer Anstandsdame. Er bat sie, nach Cambridge zu kommen zum großen Spiel – Harvard gegen Yale. Am nächsten Tag schlenderten die beiden unter einem klaren Himmel am Nashua River entlang. Roosevelt machte ihr einen Antrag, und sie nahm an. Als er seiner Mutter an Thanksgiving davon erzählte, war Sara entgeistert, war er doch ihrer Ansicht nach einfach noch zu jung. Sie bat das junge Paar dringend, die Verlobung noch ein Jahr geheim zu halten. Aber weder hatte sie grundsätzlich etwas gegen Eleanor einzuwenden, noch versuchte sie, die Heirat zu verbieten. In der Zwischenzeit schrieb Eleanor Briefe an Franklin, die vor Zuneigung überliefen – sie nannte ihn „kleiner Liebling“ oder „Franklin Liebster“. Umgekehrt gab er ihr den Spitznamen „Little Nell“.25
Ein Jahr später, im September 1904 zogen Franklin und seine Mutter in ein Stadtpalais in der Madison Avenue 200, einen wuchtigen Backsteinbau in der Nähe der imposanten Villa des Unternehmers J. P. Morgan, und Franklin nahm ein Jurastudium an der Columbia University auf. Am 11. Oktober schenkte ein beschwingter Roosevelt Eleanor endlich einen Verlobungsring von Tiffany’s. Sie war erst zwanzig, und ihre Übereinkunft war nun offiziell. Als ihre Verlobung bekannt gegeben wurde und sie eine Flut von Glückwünschen erhielten, bestand Theodore darauf, dass die Hochzeit im Weißen Haus, „unter seinem Dach“, gefeiert würde, wogegen sich die Brautleute sträubten.26 Stattdessen fand die aufwändige Hochzeit in den zwei Stadthäusern von Eleanors Großtante statt. Zylinder und elegante Kutschen gaben sich ein Stelldichein, und Theodore selbst war zugegen, um die Braut dem Bräutigam zuzuführen.
Das Paar fuhr zweimal in die Flitterwochen: Nachdem es sich zunächst nur bescheiden für eine Woche zurückgezogen hatte, folgte eine dreimonatige Besichtigungstour, die es nach London, Schottland, Paris, Mailand, Verona, Venedig, Sankt Moritz und in den Schwarzwald führte. Roosevelt kaufte Eleanor ein Dutzend Kleider sowie einen langen Zobelmantel, sich selbst einen Silberfuchsmantel und eine alte Bibliothek aus 3000 ledergebundenen Bänden.
An der Columbia Law School war er, wie schon in Harvard, ein mittelmäßiger Student, der Zweier, Dreier und eine Vier bekam. Leicht gelangweilt, wohlhabend und ein bisschen blasiert, ließ er sich durch das Studium selten vom Vergnügen abhalten.27 Ein Columbia-Professor meinte, Roosevelt habe wenig Talent für die Rechtswissenschaft – tatsächlich fiel er anfangs in Vertrags- und Zivilprozessrecht durch – und er gebe sich keine Mühe, das mit harter Arbeit zu kompensieren. Dennoch bestand Roosevelt in seinem dritten Studienjahr mühelos die New Yorker Anwaltsprüfung, woraufhin er die Universität prompt vorzeitig verließ, ohne jemals seinen Abschluss zu machen. Derweil teilte Sara den jungen Eheleuten an Weihnachten 1905 mit, dass sie eine Firma beauftragt habe, ein Stadthaus für sie zu bauen („ein Weihnachtsgeschenk von Mama“), das an ein zweites Haus angrenzen würde, in dem sie zu wohnen gedachte. Die Ess- und Wohnzimmer der beiden Häuser wären jeweils durch eine Schiebetür miteinander verbunden.28 Als eine Frau mit eigenen Vorstellungen war Eleanor höchst unzufrieden damit, dass Sara derart über die Familie bestimmte. Aber Roosevelt reagierte mit Unverständnis und tat so, als gäbe es kein Problem. Wie Eleanor selbst erklärte: „Ich glaube, er dachte immer, dass sich eine Sache von selbst erledigen würde, wenn man sie nur lange genug ignorierte.“29 Drei Jahre später schenkte Sara Roosevelt und Eleanor ein zweites Haus, ein elegantes Stranddomizil an den wunderschönen Gestaden von Campobello Island. Das weitläufige Haus besaß 34 Zimmer, gepflegte Rasenflächen, schimmerndes Kristall und Silber und sieben Kamine sowie vier komplette Bäder – allerdings keinen Strom.
Alles in allem war ihr Lebensstil verschwenderisch. Nicht genug damit, dass sie drei Häuser besaßen, verfügten sie auch stets über mindestens fünf Dienstboten, mehrere Automobile und Kutschen, eine große Jacht und viele kleinere Boote. Roosevelt liebte das Wasser weiterhin. Wie es ihrem gesellschaftlichen Rang entsprach, gehörten sie exklusiven Clubs an, kleideten sich modisch und spendeten ihr Geld für verschiedene wohltätige Zwecke. Und ihre fünf Kinder? Sie wurden von Gouvernanten, Kindermädchen und anderen Bezugspersonen aufgezogen. Eleanor, ernst wie immer, war der strengere der beiden Elternteile. Schon ihre Großmutter war immer eher mit einem „Nein“ denn mit einem „Ja“ bei der Hand gewesen, und sie hielt es genauso. Franklin hingegen war herzlich, fröhlich und einnehmend. Wie seine Tochter Anna einmal sagte: „Vater war lustig.“30
Doch er war mehr als das. Schon früh habe er – wie er mit ungewöhnlicher Offenheit gestand – wenig Geschmack an der Juristerei gefunden. Ebenso wenig reichte es ihm, die Sommer auf Campobello Island zu verbringen, in Newport zu segeln oder seine Zeit auf den Debütantinnenpartys der Saison zu verbringen. Vielmehr habe er vor, sich um ein Amt zu bewerben, und verfolge den kühnen Plan, eines Tages Präsident zu werden. Zuerst gedenke er, Abgeordneter in der State Assembly zu werden – ein schlecht bezahlter Teilzeitjob in Albany –, dann stellvertretender Marineminister und schließlich Gouverneur des Staates New York. Theodore hatte es exakt nach diesem Plan ins Weiße Haus geschafft. Wieso also nicht auch Franklin?
Und vom Anfang einmal abgesehen, sollte es beinahe so kommen, wie er vorhergesagt hatte. Der Abgeordnete, von dem Roosevelt annahm, er würde ihm seinen Sitz überlassen, lehnte sein Ansinnen ab. Roosevelt war trotzdem entschlossen. Zunächst drohte er, als Unabhängiger anzutreten, ließ sich dann aber überreden, als Demokrat für den Senat des Staates New York zu kandidieren, und zwar im 26. Senatsdistrikt, der in 54 Jahren nur einen einzigen Demokraten ins Amt gewählt hatte.31 Ein Dreierausschuss nominierte Roosevelt, und eine Lokalzeitung, der republikanische Poughkeepsie Eagle, schoss aus dem Hinterhalt, er sei von den Demokraten mehr wegen seiner dicken Brieftasche als wegen anderer heilbringender Qualitäten „entdeckt“ worden.
Roosevelt fuhr in einem hellrot lackierten offenen Tourenwagen, der einem Klavierstimmer gehörte, auf Stimmenfang durch den Distrikt. Diese Art von Wahlkampf würde er in Zukunft immer wieder führen. Zusammen mit zwei anderen lokalen Kandidaten kurvte er in diesem neumodischen Automobil mit schlappen 22 Meilen pro Stunde kreuz und quer durch den Bezirk. Und während er so die staubigen, ausgefahrenen Straßen hinunter holperte, ließ er das Wahlkampfmobil stets rechts ranfahren und den Motor ausstellen, sobald eine Pferdekutsche oder ein Heuwagen auftauchte, um weder Tiere zu erschrecken noch einen Wähler zu verärgern.
Anfangs war er kein großer Redner. Seine Aussagen waren zu abstrakt, und er baute zu sehr darauf, sich selbst und anderen zu schmeicheln. Aber er redete überall – auf einer Veranda, am Straßenrand, oben auf einem Heuballen. Eleanor pflegte seinen Stil als „langsam“ zu bezeichnen. „Hin und wieder“, bemerkte sie, „entstand eine lange Pause, und ich war jedes Mal in Sorge, weil ich Angst hatte, er würde nie mehr fortfahren.“ Mit ihrem kritischen Auge fand sie, er wirke „großsprecherisch, äußerst nervös“ und sogar „ängstlich“. Aber er schaffte es glänzend, persönlichen Kontakt zu den Menschen herzustellen – seine lebhaften Hände schienen permanent ausgestreckt zu sein, bereit, die nächste geöffnete Handfläche zu ergreifen. Trotzdem war die Kampagne oft schlecht geführt. Einmal, bei einer Reise durch den östlichen Rand des Distrikts, traf er am Spätnachmittag in einer Kleinstadt ein, sprang aus dem Wagen, steuerte direkt auf das Hotel zu und lud jeden in der Bar zu einem Drink ein – auf seine Kosten. Erst als der Barkeeper anfing einzugießen, fiel Roosevelt ein zu fragen, wo genau er war: Sharon, Connecticut – nicht nur im falschen Distrikt, sondern auch im falschen Staat. Roosevelt ließ sich nichts anmerken, grinste, bezahlte und gab die witzige Geschichte dann jahrelang zum Besten. Auch hatte er keine Skrupel, Profit aus seiner Verwandtschaft zu schlagen, verwendete bewusst dieselben Redewendungen wie Theodore Roosevelt und stellte sich einer Zuhörerschar manchmal mit den Worten vor: „Ich bin nicht Teddy“, um darauf hinzuweisen, dass er zwar ein anderer, aber eben auch ein Roosevelt war. Am Wahltag eroberte Franklin D. Roosevelt den Distrikt mit mehr als 1100 Stimmen Vorsprung, trotz einer republikanischen Aufholjagd in letzter Minute.
Die Roosevelts mieteten ein Haus in Albany, für die fürstliche Summe von 4800 Dollar im Jahr. Eleanor, anfällig für wiederkehrende Depressionen, war zunächst zögerlich, was das Haus, was die Aufgabe ihres Mannes, was die Politik im Allgemeinen betraf, aber sie biss die Zähne zusammen und hielt es für die Pflicht einer Ehefrau, an den Interessen ihres Mannes teilzuhaben – was ihr Mann, nachdem er ihren Schwung beim Golf beobachtet hatte, umgehend relativierte.
Roosevelt stürzte sich ins politische Leben, konnte seine Politikerkollegen jedoch nicht immer für sich gewinnen. Besonders schwer tat er sich damit, die irisch-katholischen Demokraten zu erreichen. Roosevelts Vater hatte Iren verachtet, selbst die irischen Angestellten in seinem Haushalt, und ein führender New Yorker Politiker, James Farley, behauptete, Eleanor habe einmal zu ihm gesagt: „Franklin fällt es schwer, mit Leuten locker umzugehen, die ihm gesellschaftlich nicht ebenbürtig sind.“32 Eleanor stritt das energisch ab, obwohl sie sich in eigenen frühen Briefen selbst alles andere als aufgeschlossen und unvoreingenommen äußerte. Über eine Feier zu Ehren des jüdischen Bankiers Bernard Baruch (der später ein enger Vertrauter werden sollte) schrieb sie einmal: „Ich würde mich lieber aufhängen lassen als dort gesehen zu werden.“33 Und tatsächlich fühlte sich Roosevelt bisweilen sichtlich unbehaglich, wenn er außerhalb seines engen Kreises mit Leuten aus unterschiedlichen sozialen Schichten zusammenarbeiten musste. Später räumte er gegenüber seinem Arbeitsminister ein: „Als ich in die Politik ging, war ich anfangs ein schrecklich fieser Kerl.“34 Überdies war er, wenn überhaupt, nur ein sehr gemäßigter Progressiver: Erst 1912 unterstützte er öffentlich das Frauenwahlrecht, und selbst nach dem verheerenden Brand in der Triangle Shirtwaist Company am 25. März 1911, bei dem 146 meist minderjährige Näherinnen starben, wollte er partout kein Arbeitsreformgesetz unterstützen.
Zwei Jahre nachdem Roosevelt seinen Sitz im Staatssenat gewonnen hatte, trat er zur Wiederwahl an, und Woodrow Wilson bewarb sich um die Präsidentschaft, gegen Theodore, der als Kandidat einer dritten Partei, der von ihm neu gegründeten Progressive Party, antrat. Roosevelt unterstützte Wilson, wobei ihm allerdings die Politik über die Verwandtschaft ging und er wie immer vor allem seine eigenen Interessen im Blick hatte.35 So begeisterte er auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten die Delegierten vordergründig von Wilson, aber ebenso sehr von sich selbst. Einer der Männer, die er so nebenbei für sich einnahm, war Josephus Daniels, ein Mitglied des Democratic National Committee und außerdem Herausgeber des News & Observer in Raleigh, North Carolina, was später noch von Bedeutung sein sollte. Doch zunächst musste Roosevelt seine Wiederwahl für den Staatssenat sicherstellen, und dieses Ziel war plötzlich in Gefahr: Im September erkrankte Roosevelt in New York City so schwer an Typhus, dass er das Bett nicht verlassen, geschweige denn Wahlkampf führen konnte.36 Als er endlich wieder völlig hergestellt war, schien seine politische Karriere plötzlich gefährdet zu sein.
Es war Eleanor, die ihn rettete, indem sie sich mit Louis Howe aus Albany in Verbindung setzte, einem hartgesottenen Zeitungsjournalisten und politischen Impresario, der fasziniert von Roosevelt war. Sie bat Howe, sich zu überlegen, ob er nicht die Kampagnen-Organisation übernehmen wolle, und dieser willigte gern ein. Dabei schien er als Frontmann zunächst wenig geeignet und für den Patrizier Roosevelt eine merkwürdige Wahl zu sein. Howe war untersetzt, asthmatisch und ging gebückt, dazu kamen ein narbiges Gesicht und Lippen, zwischen denen ständig eine Zigarette klemmte, und ein eher zurückhaltendes Verhältnis zur Körperhygiene. Aber er war ein politisches Genie, das schnell zu Roosevelts Stellvertreter wurde.37 Howe schaltete ganzseitige Zeitungsanzeigen und inszenierte eine Kampagne mit Postwurfsendungen vervielfältigter Briefe, die Roosevelts Unterschrift trugen. In den letzten sechs Wochen übernahm er faktisch den Wahlkampf. Und in einer dramatischen Abkehr von früheren Standpunkten modelte er Roosevelt zum ausgewachsenen Progressiven um, dem Arbeitnehmerrechte am Herzen lagen, der das Frauenwahlrecht befürwortete und über die politischen Macher der Republikaner schimpfte. Mit Howe am Ruder gewann Roosevelt die Wiederwahl mit noch größerem Vorsprung als im Jahr 1910.
Der Staatssenat war jedoch nur ein Sprungbrett, und Roosevelt hatte schon früh, vor allem gegenüber Wilson, verlauten lassen, dass er eine Aufgabe in Washington wolle. Zwei Angebote lehnte er ab – als Staatssekretär im Finanzministerium und als Steuereinnehmer für den Hafen von New York – und bestand auf seinem Wunschposten: Staatssekretär im Marineministerium. Seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus: Wilson gab ihm den Marinejob,38 wo er unter Josephus Daniels dienen sollte, mit dem er sich bereits während seiner Kampagne für den Staatssenat angefreundet hatte. Nun bekleidete Roosevelt also denselben Posten, der seinem Cousin Theodore den Weg ins Weiße Haus geebnet hatte.
Im Marineministerium lernte Roosevelt die Bürokratie und die Bräuche Washingtons kennen. Er brachte Louis Howe mit, und das ermöglichte ihm, auch die New Yorker Politikszene im Auge zu behalten. Roosevelt genoss das Drumherum und das Zeremoniell, wollte sich aber mit der zweiten Liga nicht zufriedengeben, sondern ins Zentrum der Macht. Für einen reibungslosen Schiffsverkehr zu sorgen war nicht die Rolle, die Roosevelt erstrebte. Deshalb bemühte er sich um einen Sitz im US-Senat, scheiterte aber. Seine Kandidatur wurde von seiner eigenen Partei und vom Präsidenten persönlich zurückgewiesen – besonders demütigend für Roosevelt war, dass Wilson offen einen Konkurrenten unterstützte. Bei der parteiinternen Vorwahl erlitt Roosevelt eine Schlappe und verzieh dem Mann nie, der gegen ihn angetreten war: James W. Gerard, US-Botschafter in Deutschland und ehemaliger Richter am Obersten Gericht des Staates New York. Der Erste Weltkrieg bot Roosevelt zwar Gelegenheit, Pläne für den Ausbau der US Navy zu entwickeln, doch auch diese wurden zunächst ignoriert. Breiter auf sich aufmerksam machte er erstmals durch seine immer überzeugenderen Reden vor dem Kongress, und schließlich verschaffte ihm seine Haltung als „Demokrat in Bereitschaft“ einen Posten in Wilsons Wiederwahlkampagne 1916. Roosevelt wurde auf Wahlkampfreise nach Neuengland und in die Mittelatlantikstaaten geschickt, und hier benutzte er zum ersten Mal seine Gartenschlauch-Analogie, um zu veranschaulichen, wie er sich Beistand in der Not vorstellte.39 „Wenn das Haus meines Nachbarn brennt, was mache ich dann? Ich gebe ihm meinen Gartenschlauch. Wenn das Feuer gelöscht ist, berechne ich ihm dafür keine 15 Dollar, sondern erhalte den Schlauch zurück.“ Im Laufe der Zeit veränderte, modifizierte und verfeinerte er diese Analogie immer wieder, und sie wurde eines der berühmtesten Motive in seiner politischen Karriere. Er sollte sie später auch während des Zweiten Weltkriegs benutzen, um einer skeptischen amerikanischen Nation seine Lend-Lease-Politik für Großbritannien zu verkaufen.
Als die Vereinigten Staaten nach der Torpedierung von drei Dampfern schließlich im April 1917 in den Ersten Weltkrieg eintraten, war die Marine für Roosevelt endlich genau der richtige Platz. Sie verfügte zum damaligen Zeitpunkt über 60.000 Mann und 197 Schiffe im aktiven Dienst. Am Ende des Krieges sollten es fast 500.000 Mann und mehr als 2000 Schiffe sein, eine gewaltige Zahl. Roosevelt stürzte sich begeistert in den Ausbau und war so erfolgreich, dass er gezwungen war, einen Teil seines frisch beschafften Nachschubs mit der Armee zu teilen. „Sprechen Sie deswegen mit dem jungen Roosevelt“, wurde schnell zur stehenden Redensart in Washington. Aber Roosevelt, ebenso ehrgeizig wie ruhelos, war weiterhin unzufrieden. Er träumte von einem militärischen Einsatz – auch hier trat er in die Fußstapfen seines Cousins –, wurde aber auf Schritt und Tritt von seinen Vorgesetzten ausgebremst, die ihm keinesfalls erlauben wollten, nach Übersee zu gehen, ganz zu schweigen davon, sich für irgendeine Gattung der Streitkräfte zu melden. Stattdessen versuchte er mittels seiner Überredungskünste die Schaffung einer 240 Meilen langen Sprengstoffkette unter Wasser durchzusetzen, um deutschen U-Booten einen Strich durch die Rechnung zu machen. Roosevelts Position in der Marine und seine Arbeit zum Schutz der Schiffswerften machten ihn etwa bei den Führern der Tammany Hall beliebt, eine Organisation der Demokratischen Partei in New York City, welche die Politik der Stadt beherrschte.
Auch in der Hauptstadt waren die Roosevelts sehr gefragt. Täglich trafen Einladungen ein, und Eleanor stellte schnell fest, dass sie wegen des gesellschaftlichen Trubels eine Privatsekretärin brauchte. Im Jahr 1914 stellte sie Lucy Mercer ein, die an drei Vormittagen in der Woche kommen sollte. Wenig später informierte Eleanor ihren Mann darüber, dass sie nach sechs glücklichen Geburten keine weiteren Kinder mehr wolle und er daher im Bett seiner Frau nicht mehr willkommen sei.
Roosevelt war ein großgewachsener, attraktiver Mann von 34 Jahren. Als er zum ersten Mal für den Staatssenat kandidiert hatte, waren Frauen in Scharen gekommen, um seine Reden zu hören, obwohl sie nicht wählen durften. Jetzt hatte er zudem eine gesellschaftliche Stellung, einen Anflug von Reife und weitläufige Interessen. Lucy, Eleanors Teilzeit-Privatsekretärin, war alles, was ihre Arbeitgeberin nicht war, feminin und selbstsicher, dazu hatte sie eine sanfte Stimme und eine „Spur von Feuer in ihren Augen“. Sie war ebenfalls groß und schlank, dazu kamen blaue Augen und langes hellbraunes Haar. Und obwohl ihre Familie ihre finanziellen Mittel längst erschöpft hatte, gehörte sie dennoch demselben erlauchten gesellschaftlichen Kreis an wie die Roosevelts. Noch während sie in ihrem Haus arbeitete, besuchte Lucy dieselben großen Abendessen und Gesellschaften wie Franklin und Eleanor. Mitten unter den Gästen begannen Roosevelt und Lucy zunächst, miteinander zu flirten, woraus still und heimlich mehr wurde. Roosevelt und Lucy unternahmen Bootstouren auf dem Potomac River und lange private Autofahrten in Virginia – allein. Einmal erblickte Alice Roosevelt Longworth, Theodores älteste Tochter, die auf Eleanors Hochzeit ihre Brautjungfer gewesen war, die beiden, wie sie nebeneinander in Roosevelts Roadster fuhren. Alice schrieb Franklin und erwähnte, dass er sie überhaupt nicht bemerkt habe: „Deine Hände ruhten auf dem Lenkrad, aber Dein Blick ruhte auf dieser total entzückenden Dame.“40
Eleanor roch Ärger: Nicht lange nach einer von Franklin und Eleanor veranstalteten Bootstour auf dem Potomac beendete die misstrauische Ehefrau Lucys Beschäftigungsverhältnis. Wahrscheinlich tat sie es unter dem Vorwand, den Sommer über fort zu sein, schließlich hatte sie keinen Beweis für irgendein Verhältnis. Lucy meldete sich beinahe augenblicklich zur Marine, und wie zu erwarten, war ihr erster Posten eine Tätigkeit als Sekretärin im Marineministerium. So verließ sie Roosevelts Haus zunächst nur, um in sein Büro einzuziehen. Doch Marineminister Daniels entfernte sie schon ein paar Monate später von ihrem Posten und dann gänzlich aus der Marine, möglicherweise, weil er um die Verbindung zwischen Roosevelt und Lucy wusste. Ihrer Leidenschaft setzte er damit allerdings kein Ende. Fast 30 Jahre lang trafen sich Franklin und Lucy weiter und schrieben einander. Und in Roosevelts letzten bewussten Momenten im April 1945 war es nicht Eleanor, sondern Lucy, die bei ihm war, deren Stimme er hörte und deren Gesicht er sah.
Im Jahr 1918 war Franklin D. Roosevelt endlich entschlossen, in den Krieg zu ziehen. Seine vier republikanischen Roosevelt-Cousins hatten sich alle zum Militärdienst gemeldet. So wie der junge österreichische Kunstmaler Adolf Hitler begierig auf den Fronteinsatz war, wollte Roosevelt zumindest einen Fuß auf europäischen Boden setzen, wenn auch nicht in voller Uniform. Dann kündigte eine Kongress-Delegation an, dass sie beabsichtige, während des Sommers Marine-Einrichtungen zu inspizieren. Minister Daniels entsandte Roosevelt mit dem Auftrag, etwaigen Problemen auf die Spur zu kommen.
Während er auf einem Zerstörer den Atlantik überquerte, hörte er, wie wegen eines vermeintlichen U-Boot-Angriffs der Schiffsalarm ertönte, und stürzte an Deck. Doch der Angriff fand nie statt, im Wasser rührte sich nichts, und der Zerstörer blieb unbehelligt. Roosevelt aber fand diesen Verlauf unbefriedigend. Sein Biograf, Jean Edward Smith, hat dazu angemerkt: „Wenn Roosevelt die Geschichte im Laufe der Jahre nochmals erzählte, kamen die U-Boote immer näher, bis er sie beinahe mit eigenen Augen gesehen hatte.“41
Eine Woche nachdem sein Cousin Quentin Roosevelt in einem Luftkampf über Frankreich getötet worden war, traf Franklin in England ein. Kaum hatte sein Schiff angelegt, rauschte ein Rolls-Royce mit ihm nach London, wo er den König und den Premierminister traf und von wo er mit einer starken Abneigung gegen den britischen Munitionsminister Winston Churchill – „eine[n] der wenigen Männer im öffentlichen Leben, die unhöflich zu mir waren“, wie er Joseph Kennedy später erzählte – wieder abreiste. Danach begab sich Roosevelt nach Paris, wo die Weine des Präsidenten tiefen Eindruck auf ihn machten: „perfekt in ihrer Art und perfekt serviert“.42 Und überall erwarteten ihn Briefe, sowohl von Eleanor als auch von Lucy Mercer.
Dann endlich fuhr er an die Front und sah die vernarbten Schlachtfelder des Krieges: Château-Thierry, den Wald von Belleau, Verdun. Allein in Verdun hatte es etwa 900.000 Opfer gegeben. Teilweise und vollständig explodierte Granaten hatten die Gefechtsstellungen und Gräben vernichtet, und auf dem Schlachtfeld war nichts mehr auszumachen außer brauner, aufgewühlter Erde, die Roosevelt schweigend anstarrte.
Doch noch immer dürstete es ihn nach echtem Kampf. Einmal pfiff eine Granate vorbei und landete mit einem „dumpfen Wumm“ in der Nähe, woraufhin sich Roosevelt in Richtung des Geräuschs davonmachte und einen Koffer mit wichtigen Papieren auf dem Trittbrett seines Automobils vergaß. Doch trotz all seiner leichtfertigen Begeisterung machte die durch die Kämpfe angerichtete Verwüstung bleibenden Eindruck auf Roosevelt. Später erwähnte er die Bilder, die er bei einem Gang durch den Wald von Belleau gesehen hatte: „vom Regen fleckige Liebesbriefe“ oder mit nichts weiter als einem verwitterten Gewehrkolben gekennzeichnete Grabstätten.43
Von Frankreich aus reiste Roosevelt weiter nach Italien, wo er erfolglos versuchte, eine Kommandostruktur für den Mittelmeerraum auszuhandeln, dann kehrte er zunächst nach England zurück und machte sich schließlich wieder auf den Weg in die USA. Entschlossen wie immer, hatte er bei seiner Rückkehr nach Washington vor, seinen Posten aufzugeben, um sich erneut an die Front zu begeben. Doch wieder kam ein anderer Feind dazwischen: die Spanische Grippe. Roosevelt ereilte sie an Bord der USS Leviathan, wo er in seiner Kabine zusammenbrach. Seine Grippe wurde verschlimmert durch eine beidseitige Lungenentzündung. In Schweiß gebadet lag Roosevelt halb bewusstlos und dem Tode nahe in seiner Koje. Doch er hatte mehr Glück als viele andere und überlebte. Der Tod kam oft während der Überfahrt, und sowohl Offiziere als auch Mannschaftsdienstgrade, die an Bord verstarben, wurden auf See bestattet. Als das Schiff dann im Hafen anlegte, wurde Roosevelt im Krankenwagen zum New Yorker Stadtpalais seiner Mutter gebracht. Vier Sanitäter trugen seinen entkräfteten Körper die Treppe hinauf. Eleanor war eilig eingetroffen, um sich um ihn zu kümmern, und packte treu und brav seine Taschen aus. Dabei entdeckte sie Bündel mit Liebesbriefen, ordentlich verschnürt, alle von Lucy Mercer. Die Briefe bestätigten ihre schlimmsten Befürchtungen, und, wie Eleanor später sagte, „[ihre] eigene besondere Welt brach für [sie] zusammen“.44
Wie verschiedene Familienmitglieder berichteten, bot Eleanor Franklin die Scheidung an, damit er Lucy heiraten könne, aber sowohl Louis Howe als auch Sara Roosevelt waren entsetzt über diese Idee und überzeugten ihn davon, dass eine Scheidung das Ende seiner politischen Karriere bedeuten würde. Gut möglich, dass Sara drohte, ihn zu enterben, sollte er Eleanor wegen Lucy verlassen. Am Ende jedenfalls blieb er, und Eleanor blieb auch.
Roosevelt erholte sich weder von der Lungenentzündung noch von der Entdeckung seiner Liaison mit Lucy rechtzeitig, um seinen Posten aufzugeben und sich zum Kriegsdienst zu melden. Stattdessen beharrte er, als der Frieden kam, nachdrücklich darauf, nach Europa zurückzukehren, um dort die Demobilisierung der Marine zu leiten, und Daniels gab schließlich nach. Franklin und Eleanor wurden zusammen entsandt, und diese Reise war ein Wendepunkt: Vier Tage nach dem Auslaufen aus dem Hafen von New York traf die Nachricht ein, dass Teddy Roosevelt tot war. Und noch vor Ende des Jahres sollte Präsident Woodrow Wilson nach einem schweren Schlaganfall halbseitig gelähmt sein. Sein lang gehegter Traum von einem Völkerbund sollte zusammenbrechen, und der Präsidentschaftswahlkampf 1920 beginnen. Auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten hielt Roosevelt die sekundierende Rede für den Gouverneur des Staates New York, Al (Alfred E.) Smith; außerdem nominierte ihn die Partei als Vizepräsidentschaftskandidaten für Gouverneur James M. Cox aus Ohio. Wieder schämte Roosevelt sich nicht, Profit aus seinem Namen zu schlagen: Wie schon bei seiner Kandidatur für den New Yorker Staatssenat übernahm er abermals viele von Theodores typischen Redewendungen – etwa die Gratulation „Bully for you!“ („Bravo!, „Gut gemacht!“). Doch die Kampagne scheiterte früh, und Warren Harding besiegte Cox und Roosevelt mit landesweit mehr als 60 Prozent der direkten Stimmen und beeindruckenden 404 Stimmen im Electoral College, dem Wahlmännerkollegium.45 Immerhin erwies sich die Niederlage für Roosevelt in finanzieller Hinsicht als Erfolg. Für die stolze Summe von 25.000 Dollar im Jahr, größtenteils dafür, dass er seinen Namen als Aushängeschild hergab, wurde er Vizepräsident einer Finanzgesellschaft, der Fidelity and Deposit Company of Maryland. Die Demokraten, glaubte Roosevelt, müssten in naher Zukunft eine längere Durststrecke überwinden. Und da seine Zukunft noch vor ihm lag, zog er es vor, sich in sein Sommerhaus auf Campobello Island, Maine, zurückzuziehen.
Es begann im Sommer 1921 als vages Unwohlsein und dumpfer Schmerz in den Beinen. Dann kamen Erschöpfung und Schüttelfrost hinzu. Er stocherte lustlos in seinem Essen herum und fror selbst unter einer schweren Wolldecke. Als er am Morgen ins Bad ging, gab sein linkes Bein unter ihm nach. Er rasierte sich und schaffte es zurück ins Bett. Damals konnte er es noch nicht wissen, aber dies war der letzte Gang, den er jemals ohne fremde Hilfe unternehmen würde.
Inzwischen hatte er Fieber, und die Schmerzen in seinem Bein und im Rücken waren stärker geworden. Die Familie versuchte es mit Massagen, aber ohne Erfolg. Nur eine Woche später wären seine verzweifelten Ärzte schon über die Andeutung einer Bewegung in einer von Roosevelts Zehen froh gewesen. Nichts derartiges war zu erkennen, sondern er vermochte nicht einmal mehr, allein auf die Toilette zu gehen. Man legte ihm einen Katheter, und Eleanor stand nachts auf, um ihn zu entleeren. Bis Ende August trat keine Besserung ein, und bis Ende September hatte ein beträchtlicher Muskelschwund eingesetzt.
Schließlich stellte man bei ihm Poliomyelitis fest, zu deutsch Kinderlähmung, wobei neuere medizinische Forschungen anhand seiner Krankenakten darauf hindeuten, dass es sich um eine Form des Guillain-Barré-Syndroms gehandelt haben könnte. Was auch immer die Ursache war, das Ergebnis stand zweifelsfrei fest: Er blieb gelähmt.
Trotzdem machte Franklin D. Roosevelt am 15. Oktober 1921 einen Riesenfortschritt, indem es ihm gelang, sich aufzusetzen. Er war nach New York City zurückgebracht worden, und Ende Oktober verließ er dort das Krankenhaus. Ein intensiver Trainingsplan wurde ausgearbeitet, um ihm zu ermöglichen, an Krücken zu gehen. Seine nun nutzlosen Beine wurden mühsam an 14 Pfund schweren, von den Knöcheln bis zu den Hüfen modellierten Stahlschienen geschnallt. Er konnte nicht mehr allein das Gleichgewicht halten oder jeweils ein Bein ausstrecken, stattdessen übernahmen nun Krücken die Arbeit seiner Beine. Er stabilisierte sich mithilfe seines Oberkörpers, während er Beine und Hüften vorwärts zog und schwang. In Hyde Park diente ihm ein Treibscheiben-Lastenaufzug als Beförderungsmittel zu den oberen Stockwerken. Pflichtbewusst ließ seine Mutter Rampen einbauen und sämtliche erhöhten Türschwellen entfernen, sodass ein Rollstuhl problemlos passieren konnte. Sara Roosevelt hoffte, ihr Sohn würde sich in Hyde Park zur Ruhe setzen, aber sein politischer Berater Louis Howe hatte anderes mit ihm vor. „Ich glaube“, behauptete Howe kühn, „Franklin wird eines Tages Präsident.“46
Der Mann, der zu Boden glitt, als er versuchte, auf Krücken über den rutschigen Marmorboden in seinen Büroräumen an der Wall Street zu laufen, der Mann, der nicht einmal einen Arm heben und winken konnte, aus Angst zu stürzen, der Mann, der einst andere überragt hatte, aber nun beinahe zu jedem emporblicken musste, kehrte 1924 wie durch ein Wunder als Hauptredner auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten für die Präsidentschaftswahl in die Politik zurück. Was Roosevelt mit den Armen nicht mehr vermochte, machte er mit dem Kopf wett. Er warf ihn zurück und straffte die Schultern. Jeden Teil seines Körpers, den er noch bewegen konnte, erfüllte er mit Leben. Und seine Stimme setzte er nun brillant ein. Nicht länger stockend, war sie zu einem volltönenden Tenor gereift und von einer Leidenschaft erfüllt, die ihm zuvor gefehlt hatte. Sie säuselte, sie zitterte, sie sang und ergriff die Zuhörer überall.
Im November 1928 erreichte Franklin D. Roosevelt so, was viele früher für unmöglich gehalten hatten. Er wurde zum demokratischen Gouverneur von New York gewählt. Er schaffte es, indem er sich Hintertreppen hinauftragen ließ, um Reden zu halten, und indem er im Fond eines Automobils fuhr, von wo aus er sprechen konnte, ohne aufzustehen. Der einfache Akt des Aufstehens und Hinsetzens kostete ihn fürwahr mehr Anstrengung als die meisten Menschen während eines ganzen Tages aufwenden. Auf der Wahlkampftour verbarg er Tag für Tag seine Behinderung und schien eine neue Gelassenheit erlangt zu haben. Frances Perkins, die während Roosevelts Kandidatur um das Gouverneursamt zu ihm stieß und später seine Arbeitsministerin – und damit erste Ministerin in der Geschichte der Vereinigten Staaten – wurde, erinnerte sich, dass er einmal sagte, wer seine Beine nicht benutzen könne, lerne zu sagen: „Ist schon in Ordnung“, wenn ihm jemand Milch statt Orangensaft bringe, und trinke sie.47
Roosevelt lebte nun wahrhaftig, was sein Cousin Teddy gepredigt hatte: „das tätige Leben“. Und er bewies Tatkraft – nicht wie Letzterer beim spektakulären Angriff auf den San Juan Hill oder bei Großwildjagden in den Prärien des Westens, sondern in jeder wachen Stunde. Er bewies sie von dem Moment an, wo er seine ganze Willenskraft zusammennahm, um seine nutzlosen Beine aus dem Bett und in den von ihm selbst entworfenen Rollstuhl zu hieven; wenn ihm der Schweiß über das Gesicht rann und er sich sagte: „Ich muss diese Zufahrt hinunterkommen“, „Ich muss es aufs Podium schaffen“ oder „Ich muss es durch den Raum schaffen“. Er bewies Tatkraft Minute für Minute, Tag für Tag, und weigerte sich, aufzugeben. Nie zuvor war er ein Mann von solcher Überzeugung und Entschlossenheit gewesen. Und als das Land wegen der Großen Depression am Boden lag, schien ausgerechnet Gouverneur Roosevelt der beste Mann zu sein, um ihm wieder auf die Beine zu helfen.
Nur wenige Tage nachdem er als Gouverneur des Staates New York wiedergewählt worden war, bereiteten Roosevelts politische Helfer ihren Kandidaten bereits auf die Präsidentschaftswahl vor. Am 23. Januar 1932 gab er seine Kandidatur offiziell bekannt und gewann in der folgenden Woche sämtliche Delegierten in den US-Bundesstaaten Alaska und Washington. Aber es gelang ihm nicht, seine innerparteilichen Widersacher auszuschalten. In seiner abschließenden Rede auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten versprach er „kühnes, unaufhörliches Experimentieren“. „Wählen Sie eine Methode“, sagte er mit dröhnender Stimme, „und probieren Sie sie aus. Wenn sie nicht funktioniert, geben Sie es offen zu und probieren Sie eine andere aus. Vor allem aber probieren Sie etwas.“ Als er auf dem Konvent eintraf, verfügte er über einen soliden Vorsprung, aber noch fehlten ihm etwa 100 Stimmen zur Nominierung. Nach einer Nacht und einem Tag heftiger Lobbyarbeit und mehreren Abstimmungen setzte Roosevelt sich schließlich im vierten Wahlgang durch, wo er sich mehr als zwei Drittel der Delegiertenstimmen sicherte, nachdem sich auch Kalifornien und Texas auf seine Seite geschlagen hatten. Anschließend unternahm er jenen dramatischen Flug nach Chicago, um die Nominierung anzunehmen, und seine Worte an die versammelte Menge donnerten über den Rundfunk: „I pledge you, I pledge myself, to a NEW DEAL for the American people.“
Wie auch immer dieser „New Deal für das amerikanische Volk“ aussehen mochte, den Roosevelt seinen Zuhörern und sich selbst versprach, die verzweifelte Situation des Land, war für jedermann offensichtlich. Die Große Depression war entsetzlich:48 Mindestens 25 Prozent der amerikanischen Erwerbsbevölkerung waren arbeitslos; in einigen Industriestädten betrug die Arbeitslosigkeit sogar 80 oder 90 Prozent. Der internationale Handel lag darnieder. In weniger als vier Jahren war die amerikanische Wirtschaft um 45 Milliarden Dollar oder etwa 45 Prozent geschrumpft. Noch niederschmetternder als diese Zahlen waren die quälenden Bilder: die Schlangen von Armen und Hungrigen, die sich in jeder Stadt bildeten; obdachlose Familien, arbeitslos, mittellos und schmutzig, die von einer Suppenküche zur nächsten schlurften; behelfsmäßige Zelte im tiefsten Winter, die von Regen und Graupel durchhingen; ganz zu schweigen von den schmutzstarrenden Kindern, die an Lagerfeuern entlang der Eisenbahngleise kauerten. Und die verheerenden Stürme in der Dust Bowl, der „Staubschüssel“ im Mittleren Westen, sollten erst noch kommen. Die gewaltige Größe der zu meisternden Aufgabe und die Verzweiflung müssen die Zeitgenossen manchmal überwältigt haben.
Aber nicht so Roosevelt. In seinem Rennen gegen Hoover hielt er 27 große Reden, die jeweils einem einzigen Thema gewidmet waren, und führte damit einen Wahlkampf um wesentliche Inhalte und um Organisation.49 Nicht nur er war überzeugt davon, dass er gewinnen würde, sondern früher oder später auch jeder in seinem Umfeld. Der bedrängte amtierende Präsident Herbert Hoover reagierte darauf, indem er den Demokraten vorwarf, eine „Partei des Pöbels“ zu sein. Auch behauptete Hoover beharrlich, dass trotz der Wirtschaftskrise niemand hungere: „Die Wanderarbeiter“, wetterte er, „sind besser genährt, als sie es je waren.“ Doch die Wähler entschieden sich in ihrer überwältigenden Mehrheit gegen ihn und für Roosevelt. Die Wahlergebnisse kamen einem Erdrutsch gleich – der amtierende Präsident verlor alle bis auf sechs nordöstliche Staaten. Roosevelts Demokraten errangen darüber hinaus eine satte Mehrheit von 313 Sitzen im Repräsentantenhaus gegenüber 117 Sitzen für die Republikaner und fünf für die Farmer-Labor-Party sowie die Herrschaft im Senat. In der Wahlnacht schien Washington ihm zu gehören.
Und dabei darf man nicht vergessen, dass man sich Präsidenten, Staatsoberhäupter und Regierungschefs gemeinhin als robuste und kraftstrotzende Persönlichkeiten vorstellt, fähig, jeden Teil ihres Landes oder gar den gesamten Erdball zu durchschreiten. Franklin D. Roosevelt aber vermochte beileibe nicht zu schreiten. Er konnte nicht einmal ohne Stützen oder ohne fremde Hilfe stehen. Niemals davor oder danach hat sich ein behinderter Mensch um die Präsidentschaft der USA beworben oder gar die Wahl gewonnen. Dass Roosevelt trotz seiner Einschränkung in einer Zeit nationalen Aufruhrs kandidierte und gewann, zeugt nicht nur von der außerordentlichen Qualität seines Wahlkampfs, sondern auch von etwas Furchtlosem und Unbeugsamem tief in ihm selbst.
„Beinahe wäre er vom Volk gekrönt worden“, schrieb der Journalist William Allen White,50 was natürlich eine pathetische Übertreibung war. Zwar liebten ihn zur Zeit des New Deal tatsächlich Millionen, aber zugleich wurde er von Millionen abgrundtief gehasst. In seinen ersten hundert Tagen im Amt setzte er der Abstinenzbewegung ein Ende, indem er die Prohibition aufhob, und brüskierte mit seinen weitreichenden Gesetzesinitiativen und Verordnungen gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer und Veteranen gleichermaßen. Er nahm sich das Bankensystem vor und machte sich an die Erneuerung von Regierung und Wirtschaft. Nichts schien für Roosevelt unmöglich, und während er Stück für Stück das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellte und die schlimmsten Folgen der Großen Depression in den Griff bekam, grenzte seine Politik für viele geradezu an ein Wunder.
Doch die vollmundige Verheißung jener ersten Tage und Monate war nicht ewig aufrechtzuerhalten. Spätestens Mitte der 1930er-Jahre war einiges von Roosevelts präsidialem Zauber verblasst. Der schwungvolle, schlagfertige Präsident, der es sichtlich zu genießen schien, mit seinen Gegnern zu streiten, wirkte jetzt bisweilen ratlos und abgespannt, wenngleich er im Wahljahr 1936 noch einmal mit einer Reihe gesetzgeberischer Leistungen an die ersten hundert Tage seiner Präsidentschaft erinnerte. Doch gegen Ende seiner zweiten Amtszeit, als er sich mit ständig wachsenden Schwierigkeiten im Kongress, mit fortgesetzten Blockaden durch einen argwöhnischen Obersten Gerichtshof, mit einer hartnäckig stagnierenden Wirtschaft und dem unheilvollen Schatten Adolf Hitlers über Europa konfrontiert sah, wirkte er mit einem Mal wie jeder andere Präsident nach einer Weile an der Macht. Sobald er sich aber in das Ringen des Zweiten Weltkriegs stürzte, erwies er sich nicht nur als großer Staatsmann, sondern auch als eine der herausragenden Persönlichkeiten der Geschichte.
Kaltschnäuzig und gewieft wie er war, achtete er darauf, der öffentlichen Meinung nie zu weit voraus zu sein, auch wenn er seine beiden sehr unterschiedlichen Verbündeten in Kriegszeiten, Churchill und Stalin, drängte, antrieb und beeinflusste. Mit seiner gepflegten Erscheinung und seiner Unbekümmertheit war er der Inbegriff unaufdringlicher Oberschicht-Eleganz und schien merkwürdig immun gegen impulsive Regungen – Francis Biddle bemerkte einmal, dass Roosevelt „über mehr Gelassenheit verfügte als irgendein Mann, der [ihm] je begegnet [sei]“.51 Und trotz seiner nutzlosen Beine war er mit seinem kräftigen Oberkörper und seinen breiten Schultern noch immer eine eindrucksvolle Gestalt, deren Charme seinesgleichen suchte. Wenn er, wie man es von ihm kannte, den Kopf zurückwarf oder ein breites Grinsen aufblitzen ließ, sprühten seine Augen Funken. Wenn er vor Freude in sich hineinlachte, mussten alle in seiner Nähe ebenfalls schmunzeln. Sein Lächeln war ansteckend und seine Gesellschaft unwiderstehlich, was Churchill ebenso spürte wie Stalin, General Dwight D. Eisenhower, Roosevelts Chefberater Harry Hopkins und US-Außenminister Cordell Hull. Roosevelt war ein Magnet, von dem Tausende angezogen wurden. Wie sonst wäre die beinahe sklavische Ergebenheit derjenigen, die seine politischen Bemühungen unterstützten, zu erklären oder die stille Übereinkunft im Pressekorps, niemals über seine Behinderung zu berichten, niemals seinen Rollstuhl oder seine verkümmerten Beine zu fotografieren?
Roosevelt blieb trotz seiner Beeinträchtigung ständig in Aktion. Er fuhr für sein Leben gern Auto, liebte seine Briefmarkensammlung und begeisterte sich für das Wechselspiel der Politik. Selbst größtenteils unbeweglich, sorgte er dafür, dass um ihn herum Bewegung herrschte, er perfektionierte seine schräge Kopfhaltung und benutzte seine Zigarettenspitze wie einen Dirigentenstab. Wenn er aufgeregt war, neigte er dazu, mit den Fingern zu trommeln. Er konnte mit der gleichen Begeisterung über abstrakte internationale Probleme diskutieren, etwa über den „Fortbestand der Demokratie“, wie über konkrete Fälle, beispielsweise das Schicksal irgendeines politischen Handlangers in einem Bezirk von Pennsylvania. Und wenn er wütend war, drohte er mit dem Finger oder setzte einen finsteren Blick auf.
Wie alle großen Staatsführer war er sich nicht zu schade für schlichte Demagogie oder rücksichtslose Schmähungen, wenn sie seinen Zwecken dienten: Die Isolationisten bezeichnete Roosevelt ungeniert als „willige Idioten“; als er mal einen Republikaner ernannte, scherzte er gegenüber dem Pressekorps, unter den Demokraten habe er keine Männer für einen Dollar im Jahr finden können; und als Botschafter William Bullitt bei ihm in Ungnade fiel, bestärkte Roosevelt ihn darin, Washington zu verlassen und als Bürgermeister von Philadelphia zu kandidieren, nur um die demokratischen Drahtzieher in Pennsylvania anzuweisen, „ihm die Kehle durchzuschneiden“.52 Den Kongress verhöhnte er einmal als „Irrenhaus“, und den Senat prangerte er öffentlich als „einen Haufen inkompetenter Quertreiber“ an.53 Der Oberbefehlshaber glaubte sogar, dass sein eigener Vizepräsident, Henry Wallace, der während seiner gesamten dritten Amtszeit unter ihm diente, ein Spinner sei. Und er machte sich gern über Hull lustig, indem er vergnügt das Lispeln seines Außenministers nachäffte.
Aber die Blutrünstigkeit von Adolf Hitler, der ironischerweise wie er 1933 an die Macht gekommen war, verstand Roosevelt intuitiv so gut wie jeder andere, und er wusste, dass „wir […] kämpfen, um eine großartige und wertvolle Regierungsform für uns selbst und für die Welt zu bewahren“.54
Im Jahr 1933, nach seinen ersten hundert Tagen im Amt, war es Roosevelt glänzend gelungen, 15 historische Gesetze durch den Kongress zu bringen. Wenn es erforderlich war, standhaft zu bleiben, dann blieb er es; wenn es erforderlich war, einen Kompromiss einzugehen, dann tat er das; wenn es erforderlich war, sich zu einigen, dann war er auch dazu bereit. „Es ist mehr als ein New Deal“, tönte sein Innenminister Harold Ickes, „es ist eine neue Welt!“55 Selbst als die trostlose Rezession und die Arbeitslosigkeit sich hinzogen und als er mit seinem Versuch scheiterte, einen widerspenstigen Obersten Gerichtshof mit den eigenen Leuten zu besetzen, büßte er niemals die Bewunderung weiter Teile der Öffentlichkeit oder das Interesse der Presse ein.
Doch vor der sich verdüsternden Situation in Europa schreckte Roosevelt zurück. Statt sein übliches Selbstvertrauen an den Tag zu legen, hielt er sich bedeckt. Wie aggressiv Hitlers Politik auch sein mochte, waren die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg doch so frisch wie eh und je – der Anblick und die Geräusche erschöpfter Armeen, die aus ihren Gräben heraus Scheingefechte vollführten; ermüdende Belagerungen, dichte, wabernde Rauchschwaden und das Stakkato der Feuerstöße, das scheinbar niemals verebbte. Während Europa und Russland im Ersten Weltkrieg zehn Millionen Soldaten verloren, hatten die Vereinigten Staaten mehr als 117.000 begraben, und viele Amerikaner hatten nur zwei Jahrzehnte später wenig Lust auf einen neuen Krieg, den sie für eine europäische Angelegenheit hielten. Im Sommer 1939 hätte sich Roosevelt angesichts der Situation in Europa, mit einer Maginot-Linie im Westen und den Folgen des Münchner Abkommens im Osten, beinahe entschieden, nicht für eine dritte Amtszeit zu kandidieren.
Aber dann kam am 31. August 1939 um 2.50 Uhr morgens ein schlichter Telefonanruf, der ihn darüber informierte, dass zehn deutsche Panzerdivisionen die polnische Grenze überschritten hatten und der Krieg erklärt worden sei. Roosevelt räusperte sich und sagte mit krächzender Stimme zu seinem Botschafter in Paris, William Bullitt, der die Neuigkeit aus Warschau übermittelte: „Na schön, Bill, es ist endlich eingetreten. Gott steh uns allen bei.“56 Daraufhin begann Roosevelt seine Haltung nach und nach grundsätzlich zu überdenken. Am Ende würde er sich entschließen, eine unerhörte dritte Amtszeit anzustreben und so mit einer von George Washington persönlich begründeten Tradition zu brechen. Während der nächsten acht Monate, der Phase des sogenannten „Sitzkrieges“, versprach Roosevelt öffentlich, Amerika aus dem europäischen Konflikt herauszuhalten. „Ich habe es schon früher gesagt, aber ich werde es wieder und wieder sagen: Ihre Jungs werden nicht in einen ausländischen Krieg geschickt werden“, versicherte er der Nation. Jeder, der etwas anderes behaupte, mache sich einer „schamlosen und unredlichen Täuschung“ schuldig, sagte der Präsident und fügte hinzu: „Die schlichte Wahrheit lautet, dass kein Mensch an verantwortlicher Stelle jemals auch nur im Entferntesten die Möglichkeit angedeutet hat, die Jungs amerikanischer Mütter auf den Schlachtfeldern Europas kämpfen zu lassen.“57 Dennoch unternahm er alles in seinen Kräften Stehende, um Washington und in der Tat der gesamten Nation die Kämpfe in Europa näherzubringen und sie auf eine immer wahrscheinlichere Beteiligung an dem Konflikt vorzubereiten. Aber während Churchill im britischen Unterhaus den Premier Neville Chamberlain offen für dessen Appeasement-Politik zur Rechenschaft zog – „Sie hatten die Wahl zwischen Krieg und Schande“, geiferte er. „Sie haben die Schande gewählt und werden den Krieg bekommen“58 –, suchte Roosevelt stattdessen nach einem Mittelweg. Er informierte Mitglieder des Senatsausschusses für militärische Angelegenheiten (Senate Military Affairs Committee), dass, sollten England und Frankreich fallen, „all die kleinen Nationen von allein in den Korb fallen würden, weil es töricht ist, wenn sie Widerstand leisten. Ich kann die Ernsthaftigkeit der Situation gar nicht genug betonen. Dies ist kein Hirngespinst.“59
Als Großbritannien Deutschland den Krieg erklärte, fünf Stunden später gefolgt von Frankreich, ging Roosevelt in einem Kamingespräch über den Äther und sagte: „Diese Nation wird eine neutrale Nation bleiben, aber ich kann nicht verlangen, dass jeder Amerikaner auch in Gedanken neutral bleibt. Auch ein Neutraler hat das Recht, Fakten Rechnung zu tragen.“60 Und obwohl er den Kongress in einer persönlichen Ansprache wissen ließ: „Unsere Handlungen müssen von einem einzigen nüchternen Gedanken geleitet werden – Amerika aus dem Krieg herauszuhalten“,61 betonte er die Notwendigkeit, die Neutralitätsgesetze der 1930er-Jahre aufzuheben, damit Amerika die Westalliierten militärisch unterstützen könne. Der Kongress kam dem zwar zunächst nicht nach, reagierte aber mit der Verabschiedung der sogenannten Cash-and-carry-Klausel, die es amerikanischen Herstellern erlaubte, Großbritannien und Frankreich Waffen zu verkaufen, solange jedes Land bar bezahlte und das Kriegsgerät mit eigenen Schiffen abholte.
Dennoch hatte die Neutralität einen hohen Preis, und die Kriegsnachrichten verfolgten Roosevelt. Während er über Telegrammen aus dem Ausland brütete oder seine morgendliche New York Times und den Herald Tribune las, murmelte er immer wieder zu sich selbst: „Alles schlimm, alles schlimm.“ Als erster Präsident, der ausgiebig Gebrauch vom Telefon machte – Harry Truman erinnerte sich, wie Roosevelts Stimme so laut dröhnte, dass er den Hörer vom Ohr weg halten musste –, sprach er oft mit seinen Botschaftern in Europa oder mit Beratern im Außenministerium. Das Telefon klingelte tagaus, tagein und versorgte ihn mit den neuesten Nachrichten über Hitlers Schritte und Finten. Darüber hinaus waren seine Tage mit Treffen ausgefüllt: mit der Presse, mit dem Außen- und Finanzminister, mit dem Justizminister, mit seinem Privatsekretär zum Nachmittagsdiktat und noch häufiger mit führenden Mitgliedern des Senats. Ausnahmslos dem Kabinett vorbehalten waren die Freitage, an denen der Präsident sich mit den wichtigsten und einflussreichsten Regierungsmitgliedern traf.
Wie vorauszusehen, gierte Roosevelt nach Ablenkung und Zerstreuung, wo er sie nur finden konnte – allabendlich bei seinem Masseur George Fox, in seiner Briefmarkensammlung und den in Ehren gehaltenen Marinedrucken, in seinen geliebten Baumpflanzungen, seinen häufigen Nickerchen, in Filmen, nach denen er „süchtig“ war, und vor allem in der Cocktail-Stunde, die jeden Nachmittag im Weißen Haus stattfand. Hier verbat er sich Gespräche über den Krieg und gab sich Mixturen und Shakern hin. Aber nichts von alledem ließ ihn jemals den Krieg ganz vergessen.
„Ich laufe fast buchstäblich auf Eiern“, gestand Roosevelt Anfang 1940,62 und diese Anspannung hinterließ ihre Spuren. Der Blutdruck des Präsidenten schnellte empor auf 179/102, dann folgte der Schrecken: Eines Abends im Februar brach Roosevelt während eines vertraulichen Abendessens mit Botschafter Bullitt und der engen Präsidentenberaterin Margaret Alice „Missy“ LeHand am Tisch zusammen – es war ein kleiner Herzinfarkt, den sein langjähriger behandelnder Marinearzt, Admiral Ross McIntire,63 aber schnell abtat und vertuschte.
Als das Frühjahr nahte, unternahmen die Vereinigten Staaten einen letzten Versuch, einen globalen Krieg zu verhindern. Im März 1940 reiste Unterstaatssekretär Sumner Welles, ein enger Berater des Präsidenten, nach London, Paris, Berlin und Rom, um einen Plan für Frieden und Sicherheit durch Abrüstung vorzuschlagen. Im Nachhinein wirkte dieser Vorschlag, auf den die Deutschen zum damaligen Zeitpunkt voller Verachtung und die Briten entsetzt reagierten, recht verzweifelt. Vor den Augen aller Welt schienen die Vereinigten Staaten kaum mehr zu tun als Hitlers nächsten Schritt abzuwarten. Lange allerdings sollte der nicht auf sich warten lassen.
Am 10. Mai 1940 startete Hitler seinen mittlerweile berühmt-berüchtigten „Blitzkrieg“ gegen die Niederlande und Belgien, die er zu Lande und aus der Luft verwüstete. Am vierten Tag des deutschen Vormarschs befahl Hitler die Zerstörung der alten holländischen Stadt Rotterdam nicht aus militärischen Gründen, sondern wegen der „Schrecklichkeit“ – der Terror sollte ausdrücklich dazu dienen, den Widerstandswillen eines Volkes zu brechen. Nach eintägigem heftigen Bombardement lagen zwischen 800 und 900 Menschen tot unter den Trümmern. Nur Stunden später kapitulierten die Holländer bedingungslos, und binnen zwei Wochen folgten die Belgier.
Nun, da der Weg frei war, wandte sich Hitler mit voller Wucht gegen Frankreich. Unter dem Schutz von Sturzkampfbombern fegten Panzer und motorisierte Infanterie der Wehrmacht, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, durch die Ardennen, und Erwin Rommels berüchtigte Panzerverbände erreichten schnell die Kanalküste. Im Ersten Weltkrieg war die Bewegung der Kampflinien oft in Metern statt in Kilometern angegeben worden, denn Franzosen und Briten war es damals gelungen, die deutschen Vorstöße vier grausige Jahre lang aufzuhalten, trotz des Gemetzels und Millionen von Todesopfern. Diesmal jedoch waren die Franzosen, deren Armee als die beste der Welt galt, wie vor den Kopf gestoßen. Sie wurden überrannt und hatten kaum einen Schuss abgefeuert.
Churchill kabelte eindringlich an Roosevelt: „Das Bild hat sich rasch verdüstert. Die kleinen Länder werden einfach zertrümmert, eines nach dem anderen, wie Kleinholz. Wir erwarten, selbst angegriffen zu werden.“ Seinen Beratern vertraute Roosevelt an, dass die Vereinigten Staaten, sollte Großbritannien fallen, „unter vorgehaltener Waffe leben“ würden. Doch die Frage für Roosevelt und für die Welt war die folgende: War er bereit, die Nation aufzurütteln, um der deutschen Raserei zu trotzen? Seine Antwort war Schweigen.
Binnen Wochen hatten deutsche Panzerverbände das britische Expeditionskorps und die Erste französische Armee entlang des rauen Ärmelkanals bei der nordfranzösischen Hafenstadt Dünkirchen eingekesselt. Während die deutschen Offiziere auf Hitlers endgültige Befehle zur Vernichtung der Briten warteten, entkamen etwa 338.000 englische und französische Soldaten in einer Armada kleiner Fischkutter und anderer Wasserfahrzeuge und ließen fast 2500 Geschütze und 76.000 Tonnen Munition zurück. Die Hälfte des britischen Geschwaders, darunter auch seine Zerstörer, war versenkt oder beschädigt worden, und nun machte sich England unter schlimmsten Befürchtungen selbst auf einen Angriff gefasst. Weil er davon ausging, dass die Deutschen seinen Soldaten über den Kanal folgen würden, schlug Churchill vor, entlang der südlichen Strände Englands Giftgas einzusetzen, um zu versuchen, den deutschen Einheiten an der Küste einen Strich durch die Rechnung zu machen.64
Am 5. Juni trafen deutsche Truppen dann aber Anstalten, sich nach Süden zu wenden,65 und an der Somme brach die französische Linie unter dem Ansturm deutscher Panzer zusammen. Vier Tage später überquerten die Deutschen die Seine, wo sie nur auf symbolischen Widerstand trafen. Am 14. Juni geschah das Undenkbare: Die Hauptstadt Paris fiel. Jetzt war Frankreich erledigt,und seine angeschlagene Regierung zog sich hastig nach Bordeaux zurück. Am 22. Juni wurde ein Waffenstillstand unterzeichnet, der einen Großteil Frankreichs den Deutschen überließ. Nur der Süden des Landes blieb in den Händen einer Marionettenregierung mit Sitz in dem Kurort Vichy. Die ländlichen Gebiete waren mit Flüchtlingen überfüllt, Straßen gesäumt von verlassenen Karren, Gepäckstücken und Toten. Außerdem hielten die Deutschen zwei Millionen französische Kriegsgefangene fest.
In einem einzigen verwegenen Schlag hatte Hitler Kaiser Wilhelm II. und Napoleon übertroffen: Es war ihm gelungen, das Bündnis seiner Feinde aufzulösen, Großbritannien vom europäischen Kontinent zu vertreiben, die französische Armee beinahe zu vernichten und den Vertrag von Versailles zu revidieren. Deutschland hatte seine Feinde entweder eingeschüchtert oder sie im Blitzkrieg vernichtend geschlagen, und das Zusammenspiel seiner Streitkräfte war nun vom Kaspischen Meer bis zum Ärmelkanal gefürchtet.
Großbritannien versuchte vergeblich, die Vereinigten Staaten ins Boot zu holen. Am Morgen des 15. Mai 1940 telefonierte der französische Ministerpräsident Paul Reynaud um 7.30 Uhr mit dem frisch eingesetzten britischen Premier Winston Churchill, um ihm, auf Englisch, eine schlimme Nachricht zu übermitteln: „Wir sind besiegt; wir haben die Schlacht verloren.“ Churchill hatte Roosevelt die ganze Zeit über dringend um Hilfe gebeten. Die unmittelbare Antwort des britischen Premierministers auf Reynaud lautete deshalb: Seien Sie standhaft, und halten Sie durch, bis die Vereinigten Staaten sich in den Konflikt einschalten. Am 18. Mai telegrafierte Churchill an Roosevelt: „Wenn aber die amerikanische Hilfe eine Rolle spielen soll, muss sie bald greifbar werden.“66 Roosevelt forderte den Kongress unverzüglich auf, einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 1,2 Milliarden Dollar zuzustimmen, um mehr Flugzeuge zu bauen und Produktionsanlagen zu vergrößern. Ein paar Wochen später sollte er um weitere 1,9 Milliarden Dollar bitten, doch das war fürs Erste alles. Es würde keine Truppentransporter mit amerikanischen Soldaten geben, keine Drohgebärden und, am entscheidendsten, keine Kriegserklärung. Obwohl ein hektischer Reynaud und Churchill in den Tagen unmittelbar vor und nach dem Fall von Paris den amerikanischen Präsidenten dringend ersuchten, die USA mögen in letzter Sekunde intervenieren, versprach Roosevelt doch nur unter vier Augen Unterstützung, während die offizielle amerikanische Reaktion weiterhin ein neutrales, eisernes Schweigen blieb. Vorerst handelte jedes Land für sich.
Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte Englands Außenminister Sir Edward Grey geklagt: „In ganz Europa gehen die Lichter aus; wir alle werden sie in unserem Leben nie wieder leuchten sehen.“ Dies war natürlich vor Amerikas Eintritt in den ersten Großen Krieg. Nun war es, als würde sich die Geschichte auf tragische Weise wiederholen, da eine europäische Nation nach der anderen von einem räuberischen Deutschland erobert wurde und die USA fernblieben. In Wahrheit war Roosevelt militärisch handlungsunfähig:67 Die USA, damals alles andere als eine ernstzunehmende Streitmacht, rangierten weltweit auf Platz 18, und Roosevelt befehligte nicht wie Hitler Millionen kampferprobter Soldaten, sondern gerade einmal mickrige 185.000 Mann, von denen viele an Holzgewehren ausgebildet worden waren. Trotz seiner Pläne für einen gewaltigen Ausbau der amerikanischen Luftmacht waren die US-Luftstreitkräfte veraltet und beinahe nicht existent, und um die Marine stand es kaum besser.
Einmal inspizierte Roosevelt einen Trupp Nationalgardisten bei der Ausbildung. Während ihre farbenfrohen Regimentsfahnen im Wind flatterten, exerzierten die Männer mit Besenstielen statt Maschinengewehren, fuhren statt in Panzern auf Lastwagen durch die Gegend und waren so außer Form, dass viele im Laufe des Manövers vor Hitze und Erschöpfung zusammenbrachen.
Politisch war die Situation nicht weniger verzweifelt. Unmittelbar im Anschluss an die Weltwirtschaftskrise hatte Roosevelt die Verteidigungsausgaben möglichst gering gehalten, auch wenn ein aggressives „Drittes Reich“ ein Abkommen nach dem anderen verletzte und sich bis an die Zähne bewaffnete. Zudem stand die amerikanische Nation im Jahr 1940 noch ganz im Zeichen des Isolationismus, und weil es sich um ein Wahljahr handelte, war Roosevelt nicht bereit, seine beträchtlichen Überredungskünste aufzubieten, um einen baldigen amerikanischen Kriegseintritt herbeizuführen. Als der Sommer 1940 nahte, stand Großbritannien also allein da, Roosevelt bewarb sich mit Antikriegsrhetorik um eine unerhörte dritte Amtszeit, und die Nationalsozialisten trafen nirgends auf Widerstand.
Der Unterschied zwischen Roosevelt, der mit Zusicherungen, die Nation aus dem Krieg herauszuhalten, das amerikanische Volk um eine dritte Amtszeit ersuchte, und einem triumphierenden Adolf Hitler in Berlin hätte eklatanter nicht sein können. Ebenso wenig hätten die Grundhaltungen der beiden Männer nicht in schrillerem Widerspruch stehen können. Für Hitler, der sich auf dem Höhepunkt seiner Macht befand, schien nun alles und jedes möglich zu sein. Bei seiner Rundfahrt durch die verlassenen Straßen des besiegten Paris – die Deutschen hatten alle Bewohner über Lautsprecher ermahnt, in ihren Häusern zu bleiben –, war der „Führer“ am meisten von einem Besuch am Grab Napoleons gefesselt. Zuerst schlug er sich wild auf die Schenkel, worauf eine längere Pause und völlige Stille eintraten. Der „Führer“ stand vor den sterblichen Überresten des Kaisers und war fasziniert.68
Bei seiner Rückkehr nach Berlin am 6. Juli wurde der „Führer“ selbst empfangen wie ein siegreicher Kaiser. Als sein Zug um 15 Uhr in den Anhalter-Bahnhof einfuhr, jubelten ihm entlang der Strecke zur Reichskanzlei Hunderttausende zu, die vielfach „bereits sechs Stunden lang wartend ausgeharrt“ hatten.69 Die Straßen waren von Blumen übersät, und Horden von SA-Männern brüllten „Sieg Heil! Sieg Heil! SIEG HEIL!“ Die Sonne strahlte, und die Menschen, die sich in fiebrigem Kriegswahn heiser jubelten, verlangten immer wieder, dass Hitler auf seinen Balkon heraustrete, was dieser von Zeit zu Zeit tat. Einer seiner Generäle pries Hitler als „den größten Feldherrn aller Zeiten“.70 Kein Wunder, dass Hitler glaubte, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis Großbritannien fallen oder um Frieden ersuchen würde. Und auch kein Wunder, dass er kühn über einen finalen Entscheidungskampf mit der Sowjetunion im Herbst nachzusinnen begann, ein gigantisches Ringen, um den Bolschewismus zu zerschlagen. Es wäre, merkte Hitler an, ein „Sandkastenspiel“, ein weiterer „Blitzkrieg“. Und, so die Überlegung des „Führers“, sollte Russland besiegt sein, wäre auch „die Lage Englands hoffnungslos“.71 Bis dahin begnügte sich Hitler vorerst damit, Großbritannien aus der Luft zu zerstören.72
Den ganzen August und September hindurch stiegen unablässig Wellen deutscher Kampfflugzeuge in die Luft, um England durch Bomben zur Kapitulation zu zwingen. Die Luftwaffe versuchte zunächst, die Royal Air Force in der Luft zu vernichten, aber die Briten wehrten sich mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln: In einer Serie dramatischer Gefechte über der Kanalküste und den Städten Südenglands kämpften RAF-Piloten Tragfläche an Tragfläche gegen die deutschen Flieger. Da die USA sich heraushielten, war Englands Überleben nun von diesen Luftnahkämpfen abhängig. Als es den Deutschen nicht gelang, die britischen Luftstreitkräfte auszuschalten, starteten sie eine Bomberoffensive mit Terrorangriffen gegen englische Städte.
Hatten die Deutschen anfangs Häfen, Radarstationen, Flugplätze und Kommunikationseinrichtungen ins Visier genommen, verlegte sich die Luftwaffe nun auf nächtliche Bombenangriffe, bei denen pro Nacht bis zu 1000 Flugzeuge aufstiegen. In 57 aufeinanderfolgenden Nächten erhellten deutsche Bomben erst das Londoner East End und dann London selbst. Bei einem deutschen Angriff auf die Stadt Coventry wurden neben 70.000 Häusern auch die meisten ihrer alten Kirchen in Schutt und Asche gelegt. Die RAF schlug in gleicher Weise zurück und bombardierte am 24. August Berlin. Wütend kündigte Hitler an: „Wenn sie erklären, sie werden unsere Städte in großem Ausmaß angreifen – wir werden ihre Städte ausradieren.“ Daraufhin sagte Churchill von Hitler: „Dieser niederträchtige Mensch, dieses monströse Produkt früherer Fehler und Schande, hat nun beschlossen, unsere berühmte Inselrasse durch wahllose Gemetzel zu zermürben.“ Während er seinen Kiefer vorstreckte, versprach der Premierminister kühn: „Wir können es aushalten.“ Und England hielt aus, aber leicht war es nicht.
Die Schäden waren beispiellos. Zehntausend Menschen fanden den Tod, mehr als 50.000 wurden verletzt. Beim deutschen Angriff auf die Manufakturstadt Birmingham wurden an einem einzigen Abend mehr als 1300 Menschen getötet. Gebäude wurden in verkohlte Skelette verwandelt; in den Straßen blieben große Krater zurück. Kinder wurden mit Gasmasken ausgestattet. Und Nacht für Nacht, wenn in der Londoner City die Lichter gelöscht wurden, suchten etwa 177.000 Bewohner der britischen Hauptstadt Zuflucht in behelfsmäßigen Luftschutzräumen in den Stationen von Londons berühmter U-Bahn. Kurz darauf bebte die Erde, und der Himmel stand in Flammen, während Feuerwehrleute sich beeilten, die Flammenwände zu löschen. Sobald der Tag anbrach, stolperten erschöpfte Bürger aus ihrer unterirdischen Welt nach oben und blickten auf die erneute Verwüstung.
Churchill selbst, unerschütterlich, ungeduldig und gereizt, verließ häufig, wenn er schwere Bombeneinschläge hörte, den höhlenartigen „Yellow Room“, wo er sich mit seinen Beratern traf, und stieg die Treppe empor auf ein Dach. In seinem dicken Luftschutzanzug und mit einem Stahlhelm auf dem Kopf, die Gasmaske griffbereit, kaute er dort oben unruhig auf einer schlaffen Zigarre herum und sah zu, wie sein geliebtes London brannte.
Aber beim nächsten Tagesanbruch flatterten noch immer Zehntausende kleiner Union Jacks trotzig aus den Fenstern jener Londoner Häuser, die nicht in Trümmern lagen. „Wie viel sie aushalten können, weiß ich nicht“, berichtete CBS-Reporter Edward R. Murrow mit seiner sonoren Stimme.73 „Die Belastung ist sehr groß.“ Doch die Briten teilten so viel aus, wie sie einsteckten, und es gelang ihnen, ihrerseits der Wehrmacht starke Verluste zuzufügen. Bis zum Spätherbst gelangte deshalb ein in die Klemme geratener Hitler zu der Überzeugung, dass der Schlüssel zum Sieg nicht im Westen, sondern im Osten liege. Er verschob das „Unternehmen Seelöwe“, die geplante Überquerung des Ärmelkanals für einen Angriff vom Meer aus auf Großbritannien, auf unbestimmte Zeit und peilte stattdessen eine Invasion der Sowjetunion an, mit der das „Dritte Reich“ einen Nichtangriffspakt abgeschlossen hatte. Die Folgen sollten schwerwiegend sein – für den Krieg, für die Bevölkerung der Sowjetunion und Europas und letztendlich für die Vereinigten Staaten. Und auch – obwohl das zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste – für die immer stärker in Bedrängnis geratenden Juden Europas.
Während Roosevelt noch nach einer grandiosen Strategie suchte, entschied sich Hitler für die seine. Nachdem er im Westen die beinahe vollständige Vorherrschaft errungen hatte, wollte er nun im Osten angreifen. Als Beginn setzte er den Juni 1941 fest, und er ging davon aus, dass der Kampf spätestens bis zum ersten Frost beendet wäre.
Als Churchill die Nachricht vom Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion erhielt, schlug er sich sofort auf Stalins Seite. Und Roosevelt bezog mit eindrucksvollem Weitblick die Sowjetunion in die Lieferung ständig wachsender Mengen amerikanischer Waffen und Versorgungsgüter an die alliierten Mächte im Kampf gegen die Nationalsozialisten ein. Aber fast sechs Monate lang befanden sich weiterhin ausschließlich zwei Staaten im Krieg mit Deutschland. Das sollte sich nach dem 7. Dezember 1941 ändern, als die USA als Reaktion auf den japanischen Angriff auf Pearl Harbor endlich neben Großbritannien und der Sowjetunion in den Krieg eintraten.
Als Oberbefehlshaber war Roosevelt sowohl eine außergewöhnliche Persönlichkeit als auch ein großes menschliches Rätsel. Natürlich liebten nicht alle den amerikanischen Präsidenten.74 Den ganzen Krieg über wurde der leutselige Präsident als Tyrann und „besoffener Krüppel“, als Urheber falscher Versprechungen und als nach Weltherrschaft dürstender Diktator, als ein „Don Quichote des gegenwärtigen Jahrhunderts, der in seinen Träumen lebt“, und als schwacher Politiker mit einem „verschrobenen“ Verstand diffamiert. Von den Kriegspräsidenten ist nur Abraham Lincoln in ähnlicher Weise verunglimpft worden.
Während Roosevelt noch lange nach den schrecklichsten Tagen der Großen Depression Frieden im Ausland predigte, musste er zugleich seine eigenen wachsenden Probleme im Innern meistern.75 So eskalierte etwa im Sommer 1943 kurzfristig eine einfache Schlägerei in einer entlegenen Ecke eines Detroiter Parks, woraufhin es im ganzen Land zu Ausbrüchen rassistischer Gewalt und zu Rassenunruhen kam. Die nationale Moral war angeschlagen, und die New York Times berichtete düster: „Die ganze Welt sieht bei unseren internen Problemen zu.“
Derweil duldeten die Angelegenheiten des Krieges keinen Aufschub. Eine nicht endende Flut von Problemen, Appellen, Klagen und Anfragen überschwemmte das Oval Office. Cartoonisten verspotteten die Unentschlossenheit des Präsidenten und machten ihn lächerlich, weil er zulasse, dass die Nation derart gebeutelt werde. Doch bei alledem, bei all diesen quälenden politischen Debatten und militärischen Rückschlägen wahrte Roosevelt stets Anstand und Würde. Wo ein erschöpfter Lincoln verdrießlich über die Flure des Weißen Hauses gewandert war und vor sich hin gemurmelt hatte: „Ich muss Entlastung von dieser Sorge haben, sonst bringt sie mich um“, und ein empörter George Washington sich auf Schmähungen seiner politischen Gegner verlegte, zeigte Roosevelt weiterhin gute Laune und Gelassenheit. Auch einer von Roosevelts politischen Widersachern erkannte dies an: „Wir, die wir deinen pompösen Schneid verabscheuen, grüßen dich.“76
Als Regierungschef blieb Roosevelt Freunden und Feinden gleichermaßen ein Rätsel, was ihm sehr zupass kam. Auch hatte er ein untrügliches Gespür für Symbolik und sprach folglich an der Howard University zu Schwarzen, vor der Freiheitsstatue zu Ausländern, von seinem Kamin aus zur Nation. Oft handelte er nicht, indem er irgendeinem grandiosen Plan folgte, sondern nach schierem Instinkt, wenn er etwa eilig aus dem Stehgreif provisorische Anordnungen traf. Eine seiner größten Leistungen, den Lend-Lease-Plan, um das militärische Überleben Großbritanniens nach 1940 zu sichern, ersann er an Bord einer Jacht während eines Segeltörns in der Karibik. Der Plan war absolut genial, ein Meisterstück. Im unscheinbaren Gewand eines Leih- und Pachtgesetzes schuf Roosevelt einen Mechanismus, um den gesamten Regierungsapparat zu umgehen und das militärische Arsenal der Vereinigten Staaten in Form eines kurzfristigen Darlehens den Verbündeten und internationalen Freunden zur Verfügung zu stellen. Diese Idee machte er dem amerikanischen Volk und dem Kongress schmackhaft, freundlich und liebenswürdig, ohne je auch nur einen Deut nachzugeben.
Aber nicht jede seiner Strategien war so meisterhaft. Immer wieder verhielt Roosevelt sich auch zögerlich und war nicht willens, eine Entscheidung zu treffen, bis eine Krise vor der Tür stand. Möglicherweise hätten ihm die ruhigeren alten Zeiten von Präsidenten wie Woodrow Wilson oder Theodore Roosevelt eher gelegen, als das Regieren einfacher und besser mit Ad-hoc-Entscheidungen zu meistern war. Er aber war spätestens Ende 1943 dafür verantwortlich, erstens die Voraussetzungen für einen globalen Krieg zu schaffen, sprich: die großen, heute für die USA typischen Verteidigungs- und Kriegsbehörden, und zweitens den Grundstein für eine moderne Präsidialregierung zu legen.
Doch selbst dabei blieb er unberechenbar. So richtete er beispielsweise ein National Resources Planning Board ein, kritisierte die Planungsbehörde dann aber dafür, dass sie ihrer Aufgabe nachkam, nämlich umfassende, vor allem volkswirtschaftliche Theorien aufzustellen. Bis zur Mitte des Krieges hatte er ein erstklassiges, ja herausragendes Kabinett zusammengestellt und sich mit Männern wie Hopkins, Hassett, Stimson, Marshall, Forrestal, Bowles, Byrnes, Nimitz, Eisenhower und MacArthur umgeben. Doch diese Männer auch mit Macht auszustatten und sich bei Entscheidungen mit ihnen abzustimmen widerstrebte ihm häufig. Das Ergebnis war eine oftmals zerstrittene Regierung. Stimson, der Kriegsminister, nörgelte einmal, Roosevelt sei „der schlechteste Verwaltungsleiter, unter dem ich je gearbeitet habe“. Und Stimson kam zu dem Schluss: „Er will alles selbst machen.“77 In Wahrheit sah Roosevelt seine Aufgabe als Staatsoberhaupt weniger darin, Dinge zu managen, als das amerikanische Volk zu führen. Folglich verstand er sich als höchste moralische Instanz, wenn er mit seiner großartigen, volltönenden Ostküsten-Stimme Prinzipien artikulierte, gemeinsame Moralvorstellungen beschwor, die Nation aufrüttelte und Loyalität weckte, kurz, eine Nation bewegte. Und dabei blieb er immer das Aushängeschild der Menschlichkeit.
Lehrbüchern folgte er nie. Er war prinzipientreu und pragmatisch, ein gewiefter Verhandlungspartner und ein Prediger, der die Weltgemeinschaft aller Menschen beschwor, und verschlagen war er auch. Nichts liebte er so sehr, wie mit schadenfroher Miene seine eigene Regierung zu überrumpeln. Er stiftete bewusst Verwirrung unter seinen eigenen Leuten im Glauben, dies führe zu einer kreativeren Politik: Manchmal versorgte er seine Berater mit Informationen, ein andermal hielt er diese absichtlich zurück und ließ seine Leute im Ungewissen. Er machte reichlich Gebrauch von ausgewähltem Klatsch und Tratsch und all den endlosen Informationen aus Telegrammen, Briefen und Memoranden, die täglich in seinem Büro eintrudelten.
Und wie Hitler eines Tages lernen würde, besaß Roosevelt darüber hinaus ein untrügliches Gespür für das richtige Timing: An manchen Tagen wirkte er seltsam träge, verschleppte Entscheidungen und wartete endlos, bevor er handelte. Aber es konnte, vor allem wenn er politisch angreifbar war, genauso gut passieren, dass er blitzschnell reagierte, noch bevor sein Stab und sein Kabinett informiert waren.
Angesichts eines solchen Regierungsstils war es kaum überraschend, dass sich die Regierung Roosevelt während des Krieges in ständigem Aufruhr befand. Kein Wunder, dass Walter Lippmann Roosevelts Führung einmal als „zögerlich und wirr“78 bezeichnete, und ein Kongresskritiker im Rundfunkgespräch „Roosevelt versus Roosevelt“ meinte, die Nation brauche „weniger und bessere Roosevelts“. War diese Einschätzung fair?
Manchmal wirkte sein präsidialer Zauber, manchmal eben nicht. Durcheinander, Verzögerungen und Konfusion – das waren häufig die Schlagworte zu seinem Regierungsstil, bei dem Probleme vorwiegend mit Improvisation, nicht mit einer langfristigen Strategie gelöst wurden. Doch trotzdem regelte sich alles irgendwie. Beispielsweise konnte Roosevelt ein absoluter Realist sein, wenn er darüber sprach, den Krieg so schnell wie möglich zu gewinnen, aber praktisch im gleichen Atemzug leidenschaftlich über den Frieden reden, wenn doch bloß eine Nachfolgeregelung für den unglückseligen Völkerbund greifen würde.
Von daher war es vielleicht passend, dass Roosevelt am 13. April 1943, dem 200. Geburtstag von Thomas Jefferson, dessen Memorial einweihte. Während ein steifer Wind über das Tidal Basin, den Stausee zwischen Potomac River und Washington Channel, peitschte, legte der barhäuptige Präsident sein schwarzes Cape an und erhob sich auf seine geschienten Beine, um zur Menge zu sprechen: „Heute, inmitten eines großen Krieges um die Freiheit“, sagte er, „widmen wir der Freiheit einen Schrein.“ Dann zollte er dem dritten US-Präsidenten und einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten den folgenden schlichten Tribut: „Jefferson war kein Träumer.“ In der Tat hatten diese beiden Präsidenten – der eine ein Sohn Virginias, der andere ein New Yorker – viel gemeinsam. Jefferson war ein Aristokrat, der im Namen des gemeinen Volkes sprach, und das war auch Roosevelt. Jefferson war ein Ränkeschmied und Strippenzieher, und das war auch Roosevelt. Jefferson war ein geschickter Politiker und ein glühender Parteigänger, und auch das war Roosevelt. Beide waren die Schöpfer poetischer und grundlegender Worte, die das amerikanische Volk in ihrer eigenen Zeit und noch Generationen später auf wunderbare Weise inspirierten. Und jeder von ihnen konnte Menschen ebenso leidenschaftlich entzweien, wie er sie zu einen vermochte. Beide waren mehr als nur eine Spur scheinheilig, auch wenn sie überragende Persönlichkeiten waren. Und schließlich waren beide Männer bestrebt, ihren politischen Horizont zu erweitern.
Wie bei der Großen Depression verlor Roosevelt auch im Verlauf der nervtötenden Widrigkeiten des Krieges nie seinen Optimismus, ohne dabei wie Hitler verblendet zu sein. „Das Komische am Präsidenten ist, dass er diese Sachverhalte gelassen und ruhig vortragen kann, ob wir den Krieg nun gewinnen oder verlieren, und für mich ist am ermutigendsten, dass er diesen Problemen wirklich ins Auge zu blicken scheint und dass er sich nicht eine Minute etwas vormacht über den Krieg“, bemerkte Finanzminister Morgenthau.79 Der Philosoph und politische Beobachter Isaiah Berlin sagte wiederum über Roosevelt: „Er war absolut furchtlos. In einer mutlosen Welt, die geteilt zu sein schien zwischen niederträchtigen und tödlich effizienten Fanatikern auf ihrem zerstörerischen Marsch und verwirrten Bevölkerungen auf der Flucht, […] glaubte er an seine eigene Fähigkeit, […] diese schreckliche Flut aufzuhalten.“ Berlin kam zu dem Schluss, dass Roosevelt den Charakter und die Energie eines Hitler und eines Mussolini hatte, aber „auf unserer Seite“ stand.80
Doch sogar Roosevelts Gleichmut hatte Grenzen. An vielen Wochenenden suchte er in Camp David, von ihm „Shangri-La“ genannt, dem präsidialen Rückzugsort in den Catoctin Mountains, knapp 100 Kilometer nördlich von Washington, Erholung vom Krieg, oft in Gesellschaft einer kleinen Gruppe Vertrauter.81 Zwar reiste sein Arbeitspensum jedes Mal mit, doch war er erst einmal dort, konnte er auch in seinen geliebten Detektivromanen schmökern, sich nach Herzenslust an Käse- und Cocktailhäppchen gütlich tun und mit Freunden plaudern, manchmal über Staatsangelegenheiten, häufiger jedoch über Belanglosigkeiten. Im Gegensatz zum Anwesen in Hyde Park war „Shangri-La“ rustikal, beinahe schon baufällig. Roosevelt fand das großartig. Seine Augen erstrahlten in jungenhaftem Entzücken, und er erzählte seinen Gästen gern augenzwinkernd, eine der Badezimmertüren schließe nicht richtig.
Doch sowohl Gegner wie Freunde waren gut beraten, sich von seiner Leutseligkeit nicht täuschen zu lassen. Roosevelt war hart wie Stahl oder, ebenso treffend ausgedrückt, störrisch wie Abraham Lincoln. Sein Berater Rex Tugwell verglich Roosevelts Prüfung angesichts der Großen Depression tatsächlich mit Lincolns Kampf gegen die Spaltung der Union im Amerikanischen Bürgerkrieg.
Ein guter Kampf belebte ihn, und er strotzte vor Verachtung für seine Widersacher. Als er einmal im Oktober 1936 vor einer jubelnden Menge im Madison Square Garden sprach, sagte er, seine Gegner seien „einmütig in ihrem Hass auf mich!“82 Nach einer dramatischen Pause fügte er hinzu: „Und ich begrüße ihren Hass!“ Ein anderes Mal wurde er an der Wall Street ununterbrochen ausgebuht; so ging es ihm auch in Cambridge, als Harvard-Studenten sich versammelten, um den berühmtesten Ehemaligen der Universität zu sehen, wie er in seiner Wagenkolonne vorbeiglitt. In beiden Fällen ließ Roosevelt sich nichts anmerken, winkte und lächelte freundlich. Es überrascht kaum, dass er im Laufe der Jahre zum Bewunderer von Andrew Jackson wurde, dem siebten Präsidenten der USA und Mitbegründer der Demokratischen Partei. Jackson war ein Populist, dem die Reichen ebenfalls zunehmend hasserfüllt gegenüberstanden.
Politisch verortete er sich selbst „ein wenig links von der Mitte“, obwohl daran zu erinnern ist, dass er einen Ordner besaß, der mit „Liberalism Versus Communism and Conservatism“ beschriftet war. Dennoch war er alles andere als dogmatisch in seinem Weltbild und bereit, mit zig politischen Strategien zu experimentieren, einen Strauß mit dem Außenminister auszufechten oder sich über Ökonomen lustig zu machen, die „Fachchinesisch, ab-so-lutes Fachchinesisch“ sprachen. Aber in seinem tiefsten Innern war er ein Liberaler: Als seine Kritiker darauf bestanden, die Regierung müsse einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen, dröhnte Roosevelt: „Verdammt, ein ausgeglichener Haushalt bringt die Leute nicht in Lohn und Brot. Ich werde den Haushalt ausgleichen, sobald ich mich um die Arbeitslosen gekümmert habe!“83 Und eine Tatsache blieb unstrittig: Als es in den 1930er-Jahren vorübergehend so ausgesehen hatte, als sei die amerikanische Demokratie in Auflösung begriffen, als sei den beiden politischen Parteien die Kraft ausgegangen, und als alle sich echte Sorgen um den Zusammenbruch der freien Institutionen machten, als Millionen von Menschen den neuen politischen Rattenfängern und Unruhestiftern, Demagogen wie Huey Long und Father Coughlin, zuströmten und Gesellschaft und Menschlichkeit in Gefahr waren, rettete Roosevelt die Demokratie im Innern. Jetzt, wo der Zweite Weltkrieg wütete und der Teheraner Gipfel wirklich begann, wurde die Frage laut: Würde ihm dasselbe auch im Ausland gelingen?
Dies war die entscheidende Frage während des Krieges und darüber hinaus. In Teheran würde Roosevelt bald genau erfahren, wie weit sein persönlicher Zauber ihn bringen konnte.84
Um drei Uhr an einem warmen Sonntagnachmittag ging Stalin zu Fuß unter einem wolkenlosen Himmel ohne Begleitung von seinem Gebäude zur Residenz des US-Präsidenten und wurde draußen von einem Offizier der US Army empfangen, der ihn zu Roosevelt führte. Stalin – ein kleiner Mann mit struppigem grauen Haar, vernarbten Wangen, einem wettergegerbten Gesicht und schlechten, durch jahrelanges Rauchen verfärbten Zähnen – trug eine khakifarbene Uniformjacke, deren einziger Schmuck ein Stern des Leninordens auf der Brust war. Roosevelt, der in seinem Rollstuhl saß, trug einen gut geschnittenen blauen Straßenanzug, doch als Stalin ihm die Hand reichte, war der Präsident sprachlos von Stalins eindrucksvoller Erscheinung. „Er war ein sehr kleiner Mann, aber er hatte“, wie ein amerikanischer Beobachter feststellte, „etwas an sich, das ihn furchtbar groß wirken ließ.“ Dass Stalin „neugierig“ auf seine verkümmerten Beine und Knöchel blickte, entging Roosevelt ebenfalls nicht.
Während seiner gesamten Karriere hatte Roosevelt an seine Fähigkeit geglaubt, sich gleichermaßen mit politischen Verbündeten wie mit Gegnern zu einigen, und er war entschlossen, eine persönliche Beziehung zum sowjetischen Diktator aufzubauen. Was blieb ihm auch anderes übrig, schließlich stand viel auf dem Spiel bei dieser Konferenz.
Doch Stalin – ungehobelt, gerissen und skrupellos – war weder moralisch noch emotional beeinflussbar: Er war der Architekt des Gulag und der großen Säuberungen; sein Regime hatte kaltblütig Hunderttausende angeblicher „Volksfeinde“ aufgrund dürftigster Beweise exekutieren lassen; und nachdem er den Krieg als Partner Hitlers begonnen hatte, bis die Nationalsozialisten ihn hintergingen und die Sowjetunion überfielen, war er auch ein unberechenbarer Bundesgenosse. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Stalin immer wieder wütend darauf hingewiesen, dass die Sowjets einen unverhältnismäßig hohen Verlust an Menschenleben erlitten, und deshalb fürchteten die Amerikaner selbst jetzt noch, dass die Sowjetunion einen Separatfrieden mit Deutschland schließen könnte. Allein in Stalingrad hatten die Sowjets die unfassbare Menge von einer Million Menschenleben verloren, mehr als die Vereinigten Staaten im gesamten Krieg. Aber Tapferkeit und Opferbereitschaft äußerten sich auch in anderen Formen. Dank Roosevelt steuerten die Vereinigten Staaten wesentliche Versorgungsgüter und Munition zur sowjetischen Kriegsanstrengung bei. Allein in der zweiten Jahreshälfte 1942 hatten die USA Stalin 11.000 Jeeps, 50.000 Tonnen Sprengstoffe, 60.000 Lastwagen, 250.000 Tonnen Flugbenzin und 450.000 Tonnen Stahl geschickt, wozu bald darauf noch 5000 Kampfflugzeuge und zwei Millionen Paar Stiefel für die russischen Soldaten kamen, die in den steinigen, verschneiten Einöden um Stalingrad kämpften und bluteten. Amerikanische Reifen sorgten dafür, dass sowjetische Laster fuhren, und amerikanisches Öl dafür, dass sowjetische Flugzeuge flogen; amerikanische Decken wärmten sowjetische Soldaten, und amerikanische Lebensmittel – Millionen Tonnen, darunter Weizen, Mehl, Fleisch und Milch – ernährten sie. Nichtsdestotrotz war Stalin überzeugt, die Westalliierten hätten eine größere Last der Kämpfte zu übernehmen, weshalb er energisch darauf drängte, dass sie das nationalsozialistisch besetzte Westeuropa so bald wie möglich direkt angriffen.
Roosevelt hatte für dieses Ansinnen durchaus Verständnis, stellte es aber notgedrungen zurück, bis die Vereinigten Staaten über genug Schiffsraum – Frachter, Tanker, Zerstörer und Geleitschiffe – für einen Großangriff über den Ärmelkanal verfügten. Und auch Churchill war nur mäßig begeistert von einem Angriff auf das nationalsozialistisch besetzte Westeuropa; er zog stattdessen eine Landung auf Sizilien und eine Konzentration auf den Mittelmeerraum vor. Aber jetzt, wo das Jahr 1943 sich dem Ende zuneigte, machten die Alliierten beträchtliche Fortschritte. Das Ende des Krieges war in Sicht.
Bald sollte der nächste Sturm über Europa hereinbrechen. Und während seines Treffens mit Stalin dachte Roosevelt unentwegt über die Zukunft nach.
Eigentlich hatte Roosevelt Stalin schon treffen wollen, seit die Deutschen die polnische Grenze überschritten hatten. Er sagte oft, dass er bei einer persönlichen Begegnung mehr durch das Studium eines Gesichts erfahre als durch die Äußerungen seines Gegenübers. Jahrelang, sogar noch als Präsident, hatte es ihm missfallen, sich auf ellenlange schriftliche Ausarbeitungen zu verlassen. Und auch seine Privatsekretärin Grace Tully erwähnte, dass Roosevelt, obwohl er das für ihn essenzielle Telefon ständig benutzte, gern Gesichtsausdruck und Mienenspiel beobachtete. Auch Churchill hatte dies schon früh erkannt und ergriff viele Gelegenheiten, sich mit Roosevelt persönlich zusammenzusetzen, um das anglo-amerikanische Verhältnis zu festigen. Aber Josef Stalin hatte bislang nur seinen stets ausweichenden Stellvertreter Wjatscheslaw M. Molotow ins Weiße Haus entsandt, was Roosevelt nicht reichte. Deshalb hatte er für das erste Treffen bei dieser Konferenz auf ein informelles tête-à-tête in seinen Räumlichkeiten gedrängt.
Roosevelt begrüßte Stalin und wiederholte dabei seinen seit Langem bekundeten Wunsch, einander persönlich kennenzulernen. Stalin, der überraschend leise, ja bescheiden auftrat, erwiderte die Begrüßung und machte einmal mehr geltend, dass die militärischen Angelegenheiten ihn stark beansprucht und ein persönliches Zusammentreffen bislang verhindert hätten. Dann fingen die beiden Männer zu reden an, und die Themen umspannten den ganzen Erdball. Natürlich wollte Roosevelt über militärische Fragen sprechen, darüber hinaus aber vor allem längerfristige diplomatische Angelegenheiten erörtern. Trotzdem erkundigte sich der Präsident mit Rücksicht auf Stalin zunächst nach der Ostfront, wo die Sowjets die volle Wucht des gnadenlosen deutschen Angriffs zu spüren bekamen – es stehe dort, so Stalins Worte, „nicht allzu gut“. Er fügte hinzu, dass die Deutschen frische Divisionen heranführten und die Rote Armee im Begriff stehe, einen entscheidenden Eisenbahnknotenpunkt zu verlieren. Doch geschickt hakte Roosevelt nach, ob die Initiative nicht trotzdem bei der Roten Armee liege, worauf Stalin zustimmend nickte.
Auf Roosevelts Drängen sprachen sie nun über allgemeinere Themen: Frankreich, Indochina, China und Indien. Immer wieder kam der Präsident auf die Diplomatie zurück. Immer wieder wollte er über die Zukunft nach dem Krieg sprechen und vor allem über seine Vorstellung von einer Nachkriegswelt, die von einer internationalen Körperschaft unter Leitung der vier Großmächte verwaltet würde: der Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, Großbritanniens und Chinas. Dann war das private Treffen beinahe so schnell beendet, wie es begonnen hatte. Die beiden hatten etwa eine Stunde miteinander verbracht, genug Zeit, um sich gegenseitig auf den Zahn zu fühlen, aber, soweit es Roosevelt betraf, nicht genug, um „irgendeine Art persönlicher Beziehung“ zu Stalin zu festigen.85
Das erste Treffen aller drei Staats- und Regierungschefs war für vier Uhr nachmittags im großen Konferenzsaal der sowjetischen Botschaft angesetzt.
Die Chefs und ihre Stäbe86 nahmen an einem eigens beschafften runden Eichentisch Platz. Er war rund, womit die Frage entfiel, wer an welcher Tischseite sitzen solle, was indes das raffinierte Gerangel um globalen Einfluss und Streit zwischen den überaus unterschiedlichen Teilnehmern nicht verhindern konnte. Zudem gab es keine feste Tagesordnung: Die Teilnehmer konnten reden, worüber sie wollten, und Themen meiden, die ihnen nicht behagten. Das Innere des Konferenzsaals hätte ebenso gut zu den frostigen Winden Moskaus gepasst wie zur sonnigen Wärme Teherans. Vorhänge bauschten sich um die Fenster, an den Wänden hingen Teppiche, und die Lehnstühle waren überdimensioniert. Jeder Regierungschef erschien mit seinen Beratern, nur auf George Marshall musste Roosevelt verzichten, der die angegebene Uhrzeit missverstanden hatte und sich auf einer Besichtigungstour befand.
Churchill und Stalin hatten sich bereits drauf verständigt, sich Roosevelts Wunsch zu fügen, die Sitzung zu eröffnen.
Roosevelt, der 62 Jahre alt war, machte eine witzige Bemerkung darüber, dass er „als der Jüngste!“ Leute begrüßte, die älter waren als er, und stellte dann nachdrücklich fest: „Wir sitzen zum ersten Mal als Familie um diesen runden Tisch zusammen, mit dem einzigen Ziel, den Krieg zu gewinnen.“ Als Nächster sprach der wegen einer Erkältung heisere Churchill, der in beredten Worten betonte, dass die drei hier versammelten Staats- und Regierungschefs „vermutlich die größte Zusammenballung weltlicher Macht, die die Menschheitsgeschichte je gesehen habe“, repräsentierten, und fügte hinzu: „In unseren Händen liegt mit grösster Wahrscheinlichkeit der Sieg, möglicherweise auch die Kraft, eine Abkürzung des Krieges herbeizuführen, und zweifelsohne das Geschick und das Glück der Menschheit.“87 Stalin verlor ein paar oberflächliche Worte über „viel Macht und große Möglichkeiten“ und schloss mit der lauten Aufforderung: „Gehen wir an die Arbeit“88, womit er die amerikanische und britische Invasion Europas meinte, die Eröffnung einer zweiten Front gegen Deutschland.
Die Amerikaner wiederum wollten, dass Stalin Bereitschaft signalisierte, seine Streitkräfte in der Schlacht im Pazifik einzusetzen. Hier reagierte Stalin schlau, indem er sagte, dass er zu stark in Europa engagiert sei, um in den Krieg gegen Japan einzutreten. Doch „wenn Deutschland zusammenbreche, sei der Moment zum Anschluss an die Freunde auf diesem Kriegsschauplatz gekommen; man werde dann zusammen marschieren“.89 Zufrieden lenkte Roosevelt die Diskussion anschließend wieder auf Europa und die geplante Invasion, wobei er betonte, dass die Alliierten durchaus an der im August 1943 auf dem Quebec-Gipfel getroffenen Entscheidung festhalten sollten, im Mai 1944 zu landen, während er zugleich feststellte, dass die ungünstige Witterung eine zweite Front in Frankreich vor dem Spätfrühjahr verhindern würde. „Der Ärmelkanal ist ein so unangenehmes Gewässer“, sagte Roosevelt und fügte dann, sich der Sorgen Stalins bewusst, hinzu: „Aber wie unangenehm dieses Gewässer auch sein mag, wir wollen trotzdem rüberkommen.“90
Churchill, der sich gut an eine düstere Zeit vor weniger als drei Jahren erinnerte, als Großbritannien die einzige Nation gewesen war, die mit deutschen Bomben angegriffen wurde, warf unwirsch ein, über dieses unangenehme Gewässer seien sie alle einmal sehr froh gewesen.
Roosevelt warf sich wieder in die Debatte und redete weiter über die Kanalüberquerung und die Invasion des europäischen Kontinents, die den Codenamen „Overlord“ erhalten sollten. Was könnten Amerika und Großbritannien angesichts des vorgesehenen Zeitplans in der Zwischenzeit tun, um deutsche Ressourcen umzulenken und die Rote Armee zu entlasten? Ein ungerührter Stalin, der pausenlos rauchte, hatte seine eigenen Vorstellungen und betonte, dass einer Invasion aus dem Norden ein Angriff durch den Süden Frankreichs vorausgehen könne. Er erinnerte unverblümt daran, dass der Osten auch künftig die zentrale Front des Krieges bleibe, und erklärte, im Kampf gegen die Deutschen sei ihm klar geworden, dass eine große Offensive aus nur einer Richtung weit weniger Erfolgsaussichten habe als ein Zweifrontenkrieg. Aus zwei Richtungen angegriffen, wären die Deutschen gezwungen, ihre Kräfte zu zersplittern, während die Alliierten die Chance bekämen, sich zusammenzuschließen und ihre Schlagkraft durch Bündelung zu vervielfachen. Diese Taktik könne möglicherweise auch auf die gegenwärtigen Pläne angewendet werden.
Während Roosevelt sich auf diese Idee stürzte, sperrte sich Churchill. Er wollte keine momentan in Italien befindlichen Kräfte abziehen. Von daher hatte er bereits vorgeschlagen, alternative Pläne für das östliche Mittelmeer auszuarbeiten, vielleicht sogar die Türkei zu veranlassen, in den Krieg einzutreten.
Aber Stalin wollte keine östlichen Mittelmeerrouten. Er glaubte, dass Italien nicht mehr sein könne als ein Ablenkungsmanöver. Wegen der nahezu völligen Unpassierbarkeit der Alpen sei es als Ausgangsposition für eine Invasion Deutschlands hingegen gänzlich ungeeignet. Churchill ignorierend, schlug sich Roosevelt auf Stalins Seite. Der britische Premier zog sich anstandslos mit den Worten aus der Affäre, „dass es bei aller Freundschaft, die uns verbinde[t], vergebliche Liebensmühe wäre, uns vorzutäuschen, dass wir die Dinge mit gleichen Augen [sehen]“.91 Roosevelt bat unterdessen die militärischen Stäbe eindringlich, sofort mit den Planungen für einen Angriff auf Südfrankreich zu beginnen, der die Invasion über den Ärmelkanal flankieren sollte.
„Overlord“ und die Taktik des Landeunternehmens beherrschten den Rest des Nachmittags, bis die drei Chefs sich zurückzogen, nur um kurz darauf beim Abendessen wieder zusammenzukommen.
An diesem ersten Abend war Roosevelt Gastgeber der Delegation. Die philippinischen Köche des Präsidenten hatten in den letzten paar Stunden Kochherde aufgebaut und angefangen, ein uramerikanisches Dinner aus gegrillten Steaks und Ofenkartoffeln vorzubereiten.92 Dass amerikanische Nahrungsmittel in einer amerikanischen Küche zubereitet wurden, beruhigte die Secret-Service-Agenten sehr. Beim Roosevelt-Churchill-Gipfel in Casablanca waren das gesamte Essen und sämtliche Getränke zuerst von Sanitätsoffizieren probiert und dann zusammengepackt und schwer bewacht worden, um zu verhindern dass jemand die Sachen vergiftete oder sich anderweitig daran zu schaffen machte.
Als die drei Staats- und Regierungschefs sich einfanden, mixte der Präsident als erstes die Cocktails für die von ihm liebevoll so genannte „Kinderstunde“.93 Seine Drinks – phantasievolle, immer wieder neue Kombinationen aus Alkohol und verschiedenen Beigaben – waren wirklich etwas für Kenner. An diesem Abend gab Roosevelt eine große Menge Wermut – „sowohl süßen als auch trockenen“ – in einen Krug mit Eis, gab dann eine „kleinere Menge“ Gin dazu und rührte die Mischung „schnell“. Stalin, der sich eher für Wein begeisterte, trank sie brav, sagte aber nichts, bis Roosevelt sich ungeduldig erkundigte, wie er den Cocktail fände. „Schmeckt ganz gut, kommt aber sehr kalt im Magen an“, erwiderte der Marschall.94
Beim Abendessen wurden die Cocktails durch Wein und Bourbon ersetzt, die reichlich flossen, während eine lange Reihe von Trinksprüchen ausgebracht wurde. Aber so fröhlich und gesellig sich die Staatsführer nach außen hin gaben, so hartnäckig hielt sich in ihren Gesprächen ein eisiger Unterton. Im Verlauf der Mahlzeit rückte abermals Nachkriegseuropa in den Fokus. Russlands uralte Feinde eiskalt abschreibend, nahm Stalin das Heft in die Hand: Er kam auf ein Thema aus seiner privaten Unterredung mit Roosevelt zurück, und diesmal brandmarkte er die Franzosen öffentlich vor der zu Tisch versammelten Delegation. Er erklärte die gesamte herrschende Klasse Frankreichs für „bis ins Mark verdorben“, und fügte hinzu, dass die ihr Angehörenden „keine Rücksichtnahme vonseiten der Alliierten“ verdienten und sie nicht „im Besitz ihres Imperiums“ bleiben dürften. Churchill, der hingegen fest davon überzeugt war, dass Frankreich als starke Nation wiederaufgebaut werden müsse, ergriff im Namen der Franzosen das Wort. Roosevelt versuchte den Friedensstifter zu spielen, aber vergeblich. Anschließend brachte Stalin das wichtigere Problem Deutschland zur Sprache und plädierte für seine „Zerstückelung und strengstmögliche Behandlung“ als einzige Mittel, um ein eventuelles Wiedererstarken des deutschen Militarismus zu verhindern.95
Um diesen Punkt zu unterstreichen, sprach Stalin, der selbst die skrupellose treibende Kraft hinter unzähligen „Säuberungen“ war,96 über Verhöre deutscher Kriegsgefangener. Als diese Gefangenen gefragt worden seien, warum sie unschuldige Frauen und Kinder abgeschlachtet hätten, habe ihre Antwort gelautet, dass sie nur getan hätten, was ihnen befohlen worden sei. Dann erzählte Stalin, was er selbst einmal in Deutschland erlebt hatte.
Im Jahr 1907 sei er in Leipzig gewesen, um an einem Arbeiterkongress teilzunehmen. Aber 200 deutsche Delegierte seien nicht erschienen, weil der Bahnbeamte, der ihre Fahrkarten entwerten musste, nicht zur Arbeit gekommen sei und die deutschen Delegierten nicht ohne ordnungsgemäß entwertete Fahrkarten in den Zug steigen wollten. Zur deutschen Mentalität, erklärte Stalin, gehöre eine übertriebene blinde Obrigkeitshörigkeit. Um das harmonische Miteinander nicht zu gefährden, wagten es weder Roosevelt noch Churchill, auf die Paradoxie einer solchen Behauptung aus dem Munde eines absoluten Despoten hinzuweisen, der seine Macht mit Gewehrläufen ausübte. Offensichtlich fühlte Stalin seinen Verbündeten auf den Zahn, um herauszufinden, inwieweit sie dazu angestachelt werden konnten, ein Nachkriegsdeutschland zu bestrafen und komplett umzugestalten. Er sagte sogar, er stimme nicht mit Roosevelts Ansicht überein, dass der „Führer“ verrückt sei, und nannte Hitler stattdessen einen intelligenten, durch eine primitive Auffassung von Politik behinderten Mann.
Diesmal versuchte Roosevelt das Gespräch zurück auf weniger kontroverse Themen zu lenken, etwa die Frage des Zugangs zur Ostsee.97 Aber plötzlich, gegen halb elf Uhr, als er gerade zu sprechen anheben wollte, kamen keine Worte aus seinem Mund. Es entstand eine lange Pause.
Zum Entsetzen der Anwesenden wurde der Präsident grün im Gesicht, und „große Schweißtropfen“ begannen „ihm übers Gesicht zu laufen“. Dann legte er „eine zitternde Hand auf seine Stirn“.98
Ein fassungsloses Schweigen senkte sich über die Versammlung, während alle den amerikanischen Präsidenten anstarrten, der offenbar in ernsten Schwierigkeiten war.
Ohne viele Worte zu verlieren, sprang Harry Hopkins von seinem Platz auf und ließ Roosevelt in sein Zimmer bringen. Roosevelts Arzt, Admiral Ross McIntire, aß gerade draußen zu Abend. Auch er eilte zum Zimmer des Präsidenten.
Wie es der Zufall wollte, wusste nur McIntire, dass sich ein ähnlicher Vorfall schon einmal ereignet hatte, an einem Abend im Februar 1940, ebenfalls während des Dinners. War dies eine Wiederholung jenes grässlichen Abendessens – außer dass der Zusammenbruch des Präsidenten diesmal in Gegenwart der mächtigsten Männer der Welt erfolgt war? Einen ernstlich kranken Roosevelt konnte sich die Nation zu diesem wichtigen Zeitpunkt nicht leisten.
In Roosevelts Zimmer begann McIntire in aller Eile mit seiner Untersuchung. Roosevelt erklärte, dass er sich nach dem Ende des Essens einer Ohnmacht nahe gefühlt habe. McIntires Diagnose war erstaunlich flüchtig: Magenverstimmung und übermäßige Blähungen. Er verabreichte Roosevelt etwas, um die Symptome zu lindern. Falls hinter den Beschwerden des Präsidenten irgendetwas Ernsteres steckte als eine Magenverstimmung – und das war mit ziemlicher Sicherheit der Fall –, dann ging McIntire dem anscheinend niemals nach. Und schon am nächsten Nachmittag traf Roosevelt erneut mit Stalin zusammen, um seine Vision einer Nachkriegswelt zu skizzieren,99 bevor die beiden anschließend für eine weitere Konferenzrunde zu Churchill stießen.
Aber auch wenn die Amerikaner unbeschwert weitermachen konnten, war der Abend für Churchill und Stalin in jedem Fall ein beunruhigendes Vorzeichen und eine ernste Erinnerung daran, dass es mit Roosevelts Gesundheit nicht zum Besten bestellt war.
Während Roosevelt von der plötzlichen Magenverstimmung „vollständig genesen“ zu sein schien und den Amerikanern zufolge „so munter wie immer“ war, belastete den Gipfel einmal mehr die zunehmend heikle Frage einer Invasion über den Kanal.100 Weil er fürchtete, ein direkter Angriff könnte „die Zivilisation auslöschen“ und einen verwüsteten Kontinent zurücklassen, zögerte Churchill eine Entscheidung hinaus. Roosevelt seinerseits, noch außerstande, starke Kräfte für den geplanten Angriff auf Europa einzusetzen, wollte sich weiterhin auf die Nachkriegswelt und seine Idee einer internationalen Organisation zur Lösung von Streitigkeiten konzentrieren. Doch Stalin kam eingedenk seiner Soldaten, die an der unerbittlichen Ostfront bluteten und starben, immer wieder auf „Overlord“ zu sprechen. Ob er mit einem Rotstift auf einem Notizblock herumkritzelte – er zeichnete gern Wolfsköpfe – oder mit einer Zigarette in der Hand teilnahmslos dasaß, er blieb unerbittlich. Ein finsterer Stalin bestand auf einem konkreten Stichtag im Mai – den Roosevelt versprochen hatte – und auf der Ernennung eines Oberbefehlshabers. Unverblümt fragte er Roosevelt: „Wer wird ‚Overlord’ kommandieren?“101 Der Präsident räumte ein, er habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, obwohl jeder wusste, dass der führende Kandidat, General George Marshall, an der Konferenz teilnahm.
Stalin fühlte sich schlicht hingehalten und schäumte: „Dann wird auch nichts aus diesen Operationen.“102
Nachdem man über die Türkei und Bulgarien gesprochen hatte, wendete sich die Diskussion wieder „Overlord“ zu. Jetzt sagte Stalin anklagend zu Churchill: „Glauben die Briten wirklich an ‚Overlord’, oder tun sie nur so, um die Russen in Sicherheit zu wiegen?“ Churchill, der auf seiner Zigarre kaute, blickte mürrisch drein und erklärte dann: „Unter der Annahme, dass die bereits erwähnten Voraussetzungen zum gegebenen Zeitpunkt erfüllt sind, ist es unsere Pflicht und Schuldigkeit, unsere Kraft bis zur letzten Unze jenseits des Kanals gegen die Deutschen einzusetzen.“103 Damit beendete wie schon am Vortag Churchill die Sitzung, der die Ereignisse später in vertraulicher Runde mit einem Wort kommentierte: „Scheiße!“
Beim Abendessen war Stalin an der Reihe, den Gastgeber zu spielen.104
Im Verlauf der nicht endenden Trinksprüche an Tischen, die unter einem klassischen russischen Essen ächzten – zunächst kalte Vorspeisen, dann heißer Borschtsch, Fisch, verschiedene Sorten Fleisch, Salate, Kompott und Obst, alles begleitet von Wodka und erlesenen Weinen –, fing der sowjetische Führer an, Churchill zu ärgern. Er „neckte“ und „piesackte“ den britischen Premierminister abwechselnd105 und ging sogar so weit zu behaupten, dass Churchill nach wie vor freundliche Gefühle für Deutschland hege und insgeheim einen „weichen“ Frieden wünsche. Trotz der Tatsache, dass es Churchill gewesen war, der zuvor und überzeugender als alle anderen die Fakten gegen Hitler aufgelistet hatte, fuhr Stalin mit seinen Sticheleien fort, dabei fast immer unterstützt und sogar bestärkt von Roosevelt. Die „ätzenden“ Bemerkungen flogen immer hitziger hin und her, bis Stalin scharf einwarf, der deutsche Generalstab müsse „liquidiert“ werden. Die ganze Schlagkraft der Armeen Hitlers, fuhr er fort, hänge „von etwa 50.000 Offizieren und Militärspezialisten“ ab. Wenn sie „am Ende des Krieges gefasst und erschossen“ würden, wäre Deutschlands militärische Stärke dahin. Stalin begleitete seine Bemerkung mit einem „sardonischen Lächeln“ und einer „Handbewegung“. Aber entweder entging Churchills Dolmetscher der augenscheinliche Sarkasmus des Sowjetführers, oder der Premierminister selbst kam zu dem Schluss, dass er die Nase voll hatte. Wütend erwiderte er eisig: „Das britische Parlament und die britische Öffentlichkeit werden Massenexekutionen niemals gutheissen. Selbst wenn sie es unter dem Einfluss der Kriegsleidenschaft zuliessen, dass damit begonnen würde, würden sie sich nach der ersten Schlächterei mit grösster Heftigkeit gegen die dafür Verantwortlichen wenden.“
Churchill fügte hinzu: „Lieber lasse ich mich […] hier an Ort und Stelle in den Garten hinausführen und erschiessen, als meine und meines Volkes Ehre durch eine solche Niedertracht zu beschmutzen.“106 An diesem Punkt suchte Roosevelt zu vermitteln, indem er eine Kostprobe seines eigenen Humors gab. Er schlug einen Kompromiss vor: Bei der Zahl 50.000 könne er Marschall Stalin nicht unterstützen. Stattdessen sollten nur „49.000 erschossen werden“.
Keiner Seite schien in diesem Moment die Tatsache bewusst zu sein, dass in diesem entsetzlichen Krieg ein ganzes Volk – unschuldige Zivilisten – in den dunklen Wäldern Polens erbarmungslos abgeschlachtet wurde und das in weit größerer Zahl.
Am dritten Tag fanden alle Seiten endlich zusammen. Stalin ließ den alles andere als dezenten Hinweis fallen, das Versäumnis, im Jahr 1944 eine zweite Front in Europa zu eröffnen, sei beinahe eine Garantie dafür, dass eine kriegsmüde Sowjetunion einen Separatfrieden mit Hitler anstreben würde. Und seine Drohung hatte, wie unwahrscheinlich sie in diesem Stadium des Konflikts auch war, den gewünschten Effekt. Diesmal beugte sich Churchill der Realität: Er und Roosevelt gaben grünes Licht für „Overlord“ und zwar „in Verbindung mit einer Unterstützungsaktion in Südfrankreich“.107 Die Sowjets ihrerseits würden eine Offensive organisieren, die im Mai gegen die deutschen Streitkräfte im Osten stattfinden sollte.
An diesem Abend, dem 30. November, war Churchill, obwohl immer noch kränkelnd – inzwischen hatte er einen elenden Bronchialhusten und zwischenzeitlich Fieber –, Gastgeber des offiziellen Abendessens. Es war sein 69. Geburtstag, und die Insignien des britischen Empire waren ausgestellt. Kristall und Silber funkelten im Kerzenlicht, Roosevelt und Churchill trugen Abendgarderobe, und die Trinksprüche waren ergreifend. Gewöhnlich umrundete derjenige, der einen Toast ausbrachte, den Tisch, um mit demjenigen anzustoßen, auf den gerade getrunken wurde. Einmal jedoch trank Roosevelt auf die Gesundheit von Churchills Tochter, Sarah, worauf sich Stalin an seiner statt erhob, um den Tisch herumging, sich verbeugte und mit ihr anstieß. Sarah zögerte einen Moment, dann stand sie von ihrem Sitz auf, um zu Roosevelts Platz zu gehen, wo sie mit ihrem Glas seines berührte und er äußerst charmant sagte: „Ich wäre zu Ihnen gekommen, meine Liebe, aber ich kann nicht.“108
Als der Abend fortschritt, erhob sich Stalin zum ersten Mal, um den USA öffentlich für die umfangreichen Lieferungen zu danken, welche die Rote Armee am Leben hielten. Er hob mit den Worten an: „Ich möchte Ihnen erzählen, was der Präsident getan hat, um den Krieg zu gewinnen“, und machte sogar das denkwürdige Eingeständnis, ohne Lend-Lease „würden [sie] diesen Krieg verlieren“.
Dann war Churchill an der Reihe. Mit Stalin zu seiner Linken und Roosevelt zu seiner Rechten gedachte er der Leistungen, die hinter ihnen lagen. Im Nachhinein erinnerte er sich: „Zusammen kontrollierten wir die weitaus grössten Seestreitkräfte und drei Viertel aller Fliegerkräfte der Welt; wir dirigierten Armeen von annähernd zwanzig Millionen Mann, die den furchtbarsten Krieg der Menschheitsgeschichte austrugen.“ Und fügte dann hinzu: „Ich konnte es mir nicht versagen, Genugtuung über den weiten Weg zu empfinden, den wir seit dem Sommer 1940 dem Sieg entgegen zurückgelegt hatten. Damals waren wir auf uns allein angewiesen […].“109
Das letzte Wort sollte jedoch an diesem Abend Roosevelt haben. Um zwei Uhr morgens erhob er triumphierend sein Glas und sagte: „Wir haben unterschiedliche Gebräuche, Weltbilder und Lebensweisen. Aber hier in Teheran haben wir bewiesen, dass die abweichenden Ideale unserer Nationen in einem harmonischen Ganzen zusammenkommen und vereint zu unserem gemeinsamen Wohl und dem der Welt wirken können.“
Welche Harmonie auch immer in Teheran erreicht wurde, sie blieb gleichwohl in einem umfassenderen Sinne flüchtig. Denn es sollte noch sehr viel mehr Krieg – und eine viel größere, unfassbare moralische Tragödie – folgen.
Als Roosevelt sich an seinem letzten Abend im sowjetischen Botschaftskomplex auf sein Zimmer zurückzog, war er unruhig beim Gedanken daran, dass er sein Hauptziel noch nicht erreicht hatte: ein dauerhaftes, persönliches Einvernehmen mit Stalin. Obwohl er sich nach besten Kräften bemüht hatte, fand er den sowjetischen Diktator „korrekt“, „steif“, „ernst“, mit „nichts Menschlichem, um an ihn heranzukommen“. Er war entmutigt, doch dann fiel ihm ein, dass er Stalin zwei Abende lang mit offensichtlichem Vergnügen zugesehen hatte, wie er Churchill piesackte und veralberte. Klar, er hatte mitgemacht, aber recht zurückhaltend. Wenn Stalin sich unverblümt geäußert und Churchill lautstark argumentiert hatte, hatte er selbst meist geduldig zugehört und vermittelt, gescherzt und Anstöße gegeben. Weil ihm an einem politischen Ertrag gelegen war, entschied er sich am letzten Tag der Konferenz für die entgegengesetzte Strategie. Er würde sich unverhohlen lustig machen über den Premierminister. 110
An jenem letzten Vormittag holte der Präsident Churchill auf dem Weg zum Konferenzraum ein und sagte: „Winston, ich hoffe, Sie werden über das, was ich tun werde, nicht verärgert sein.“ Der Premierminister stutzte. Erst vor wenigen Tagen hatte er mit Roosevelt in Kairo an Thanksgiving in kleinem Kreis zu Abend gegessen; sie hatten zwei Truthähne tranchiert, Champagner getrunken, während im Hintergrund Feiertagsmusik dudelte, und Kürbispie gegessen. Inmitten der blutigen Gemetzel des Krieges war es ein Abend im Zeichen unvergesslicher Freundschaft gewesen. Deshalb rechnete Churchill, ein Veteran der pragmatischen englischen Politik, nicht mit dem, was nun folgen würde. Wie Roosevelt sich erinnerte, kaute der Premierminister bloß auf seiner Zigarre herum und „grummelte“.
Sobald er in den Konferenzsaal kam, fuhr Roosevelt herüber zu Stalin, der von der sowjetischen Delegation umgeben war. Er tat geheimnisvoll, ja vertraulich, aber Stalin zeigte keinerlei Regung. Dann sagte Roosevelt schmunzelnd, wobei er sich eine Hand vor den Mund hielt, als würde er ein Flüstern verbergen: „Winston ist unpässlich heute Morgen. Er ist mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden.“ Als der sowjetische Dolmetscher die Worte wiederholte, „huschte ein schwaches Lächeln über Stalins Gesicht“. Sofort folgerte Roosevelt, dass er auf dem richtigen Weg sei. Kaum saß die Gruppe am Tisch, fing er an, Churchill wegen seiner „britischen Wesensart“, mit der Karikatur „John Bull“, wegen „seiner Zigarren, wegen seiner Gewohnheiten“ aufzuziehen. Der Präsident sah, wie Churchill knallrot anlief und finster dreinblickte, und je mehr er sich verfärbte und je mürrischer sein Gesichtsausdruck wurde, desto breiter lächelte Stalin. Schließlich, erinnerte sich Roosevelt, „brach Stalin in ein tiefes, herzliches Gelächter aus, und zum ersten Mal seit drei Tagen sah ich Licht“. Endlich war das Eis gebrochen.
Nach diesem Fortschritt nahm sich ein euphorischer Roosevelt sogar die Freiheit, Stalin offen „Onkel Joe“ zu nennen, und der Sowjetführer war nicht beleidigt. Was Churchill dachte, ist nicht überliefert. Doch es war der amerikanische Botschafter Averell Harriman, ein Bewunderer sowohl Roosevelts als auch der Russen, der die vielleicht aufschlussreichste Bemerkung zu den Vorlieben des Präsidenten beisteuerte: „Er fand immer Vergnügen daran, wenn sich andere Leute unbehaglich fühlten“, schrieb er später.111
Der Gipfel war ein Erfolg. Roosevelt reiste von Teheran aus weiter nach Kairo, Churchill ebenfalls. „Overlord“ war beschlossen; sie hatten die Notwendigkeit einer internationalen Körperschaft zur Friedenssicherung diskutiert; sie hatten das Schicksal der baltischen Staaten und den Status eines Nachkriegsdeutschlands eingehend erörtert; sie hatten über Reparationen von Finnland gesprochen und darüber, die Türken zu überreden, in den Krieg einzutreten; und sie hatten sich über Mitteleuropakarten des US-Außenministeriums gebeugt und hitzig die strittige Angelegenheit der Grenzen Polens und seiner Exilregierung debattiert.
Aber es gab noch ein paar unerledigte Dinge, darunter eine von Roosevelts wichtigsten Kriegsentscheidungen, die am 5. Dezember endlich in vollem Umfang die „Operation Overlord“ und die alliierte Landung in der Normandie in die Wege leiten würde: Er bestimmte offiziell den Oberbefehlshaber für die gemeinsame alliierte Invasion. Sein Generalstabschef des Heeres, General George C. Marshall, den der Präsident für die fähigste Figur im Generalstab hielt und der ihn nach Teheran begleitet hatte, wartete nun gespannt. Wie Marshall wusste, deuteten fast alle Anzeichen darauf hin, dass er Oberbefehlshaber würde, und er wollte den Auftrag. Einmal während der Teheraner Konferenz hatte Stalin Marshall sogar persönlich zu seinem bevorstehenden Kommando gratuliert. Doch je mehr Roosevelt darüber nachgedacht hatte, desto mehr hatte es ihn beunruhigt, auf Marshalls diskreten, klugen Rat verzichten zu müssen. Er wollte ihn bei sich in Washington, nicht an der Front, und gelangte zu der Überzeugung, dass es das Risiko nicht wert war. Also rief Roosevelt an einem späten Sonntagvormittag Marshall in sein Zimmer. Nach ein bisschen Smalltalk fragte der Präsident den General schließlich, was er wegen „Overlord“ zu unternehmen gedenke. Der wortkarte Marshall, stets ganz braver Soldat, erwiderte, dass es Sache des Präsidenten sei, eine Entscheidung zu treffen. „Dann wird es Eisenhower sein“, sagte Roosevelt. Um sicherzustellen, dass seine Entscheidung endgültig war, wies der Präsident anschließend Marshall an mitzuschreiben, während er eine persönliche Nachricht an Stalin diktierte. Der General griff zur Feder und notierte jene Worte, welche die Ernennung eines seiner Untergebenen bekanntgab: „Über die sofortige Ernennung von General Eisenhower zum Oberbefehlshaber von Overlord ist entschieden worden.“ Sobald Marshall den Satz geschrieben hatte, fügte Roosevelt ein Ausrufezeichen hinzu und setzte gelassen seine Unterschrift darunter. Jetzt gäbe es kein Zurück mehr. Marshall schenkte die unterschriebene Originalnotiz später Eisenhower als Andenken, wobei er als Erklärung anfügte: „Sie wurde von mir sehr eilig geschrieben.“112
Dies war der Beginn eines Jahres voll schicksalhafter Entscheidungen. Aber zuerst musste der Präsident, müde, aber zuversichtlich, die Tausende von Kilometern nach Hause zurücklegen.
Roosevelt hatte auf der Rückreise einen Zwischenstopp in Neapel einlegen wollen, um die Truppen zu besuchen, aber weil dort noch Kämpfe tobten, brachte man den Präsidenten schließlich von dieser Idee ab, der sich stattdessen für die Inseln Malta und Sizilien entschied. Auf Malta überreichte er den Bewohnern eine Gedenktafel für ihren Widerstand gegen die Nationalsozialisten; auf Sizilien inspizierte er die Truppen, dekorierte Kriegshelden und sprach mit seinem extravaganten, aber in Schwierigkeiten steckenden General George S. Patton, der kürzlich einen Soldaten, der an einer Kriegsneurose litt, geohrfeigt hatte. Anschließend reiste Roosevelt weiter nach Marokko, von wo aus er die Seereise zurück über den Atlantik antrat.
Am 17. Dezember kehrte Roosevelt ins Weiße Haus zurück. Er war mehr als einen Monat im Ausland gewesen. An Heiligabend fuhr er in den Norden, wo er sich in Hyde Park in einem Kamingespräch über Teheran an die Nation wenden wollte. Umgeben von Mikrofonen und im gleißenden Licht von Jupiterlampen, bemühte sich Roosevelt, das amerikanische Volk auf den abschließenden Vorstoß gegen Deutschland einzustimmen; er sprach von einem wahren „Weltkrieg“ und dem „Start eines gewaltigen Angriffs auf Deutschland“. Dann fügte er hinzu: „Wir alle werden uns auf lange Listen von Opfern einstellen müssen – Tote, Verwundete, Vermisste. Genau das bringt Krieg mit sich. Es gibt keinen leichten Weg zum Sieg, und das Ende ist noch nicht in Sicht.“
Den ersten Weihnachtstag verbrachten die Roosevelts damit, Weihnachtssängern zu lauschen und zuzuhören, als der Präsident Charles Dickens’ Klassiker A Christmas Carol vorlas. Zwar hatte sich der Präsident im kalten nördlichen Teil des Bundesstaats New York eine leichte Grippe mit Husten und Gliederschmerzen zugezogen – er bekam schnell hohes Fieber und „wusste nichts mit sich anzufangen“ –, doch nachdem er das erste Mal seit elf Jahren Weihnachten mit seiner Familie in Hyde Park verbrachte, war er entschlossen, jede Minute zu genießen.113
Während also in Hyde Park das Feuer im Kamin prasselte und Eierpunsch, andere Getränke und Törtchen serviert wurden, während die eleganten Hotels und Wohnhäuser des offiziellen Washington mit Kränzen und roten Bändern geschmückt waren, machte ein junger Anwalt im Finanzministerium Überstunden. Er arbeitete an einem Memorandum für seinen Chef, Finanzminister Henry Morgenthau jr., das einen langen und verblüffenden Titel trug: „Report to the Secretary on the Acquiescence of This Government in the Murder of the Jews“ – „Bericht an den Minister über die stillschweigende Einwilligung dieser Regierung in die Ermordung der Juden“.
Denn bei all dem Gerede über Schlachtpläne, Imperien und den Nachkriegsfrieden war die systematische Ermordung der Juden ein Thema, über das keiner der „Großen Drei“ in Teheran gesprochen hatte. Der wütende Bericht des jungen Anwalts wurde zu Beginn des neuen Jahres dem Finanzminister übergeben, der ihn am 16. Januar 1944 in abgemilderter Form unter dem Titel „Persönlicher Bericht an den Präsidenten“ Roosevelt überbrachte.114