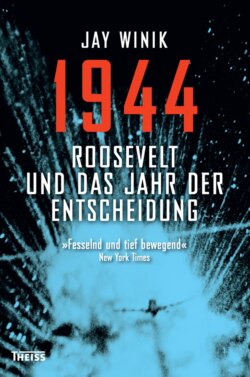Читать книгу 1944 - Jay Winik - Страница 12
Kapitel 3 Flucht, Teil 1
ОглавлениеDer Abstecher nach Hobcaw Barony in South Carolina war beileibe nicht Roosevelts erste Reise in den Süden seit Beginn seiner Amtszeit.1 Während seiner Jahre im Weißen Haus war er regelmäßig nach Warm Springs gefahren, um sich in den Thermalbädern zu kurieren, und nach der Wahl von 1940 hatte Roosevelt zum Vergnügen und zur Entspannung eine zehntägige Karibik-Kreuzfahrt unternommen. Ursprünglich hatte er auch im Frühjahr 1944 gehofft, wieder in die Karibik aufbrechen zu können, um in Guantánamo Bay auf Kuba zu fischen und sich zu sonnen, doch seine schwache Gesundheit und die Erfordernisse des Krieges machten eine solche Reise unmöglich.
Doch Erholung war unerlässlich, und Roosevelt war nicht der Einzige, der ausspannte.
Während der Krieg sich weiter hinzog, die Zahl der Toten stieg und die D-Day-Invasion bedrohlich näher rückte, suchten auch SS-Offiziere Ruhe und Abgeschiedenheit, um sich zu regenerieren.2 In ihrer Auszeit von der Grausamkeit und dem Morden waren sie begierig nach Vergnügen und Zerstreuung. Und warum hätten sie es auch nicht sein sollen? Endlich erhielten sie eine Erholungspause vom scheußlichen Geschäft des Krieges. Den Halbtoten und Todgeweihten in die angstvoll aufgerissenen Augen zu blicken, ganz gleich wie verhasst ihnen diese Menschen waren, hinterließ auch bei den hartgesottensten Männern Spuren. Und die SS machte das tagtäglich. Auch das schiere Ausmaß ihres Auftrags war belastend, jene entsetzliche Realität, die den Tod so vieler Menschen beinhaltete, Woche für Woche, Tag für Tag, sogar Minute für Minute. Eine Reihe ihrer Kameraden war in diesem Krieg bereits unter dem Druck zusammengebrochen. Doch diese Offiziere waren anders. Versteckt in den dicht bewaldeten Weiten Oberschlesiens, führten sie ihre Operation unter höchster Geheimhaltung durch. Auf den meisten Karten war deren Schauplatz bis vor Kurzem nicht einmal verzeichnet gewesen, und selbst viele ihrer Kameraden wussten nichts von ihrer Arbeit. Die Tage mancher Beteiligter erstreckten sich von vier Uhr morgens bis Mitternacht. Dabei waren sie der fortgesetzten Gefahr von Luftangriffen in der Nähe, der unerträglichen Kakophonie bellender Hunde und den grellen Scheinwerfern ausgesetzt, mussten ständig mit Aufruhr rechnen und entgingen weder dem grauenhaften Rauch und den grässlichen Gerüchen noch der andauernden Forderung danach, „mehr zu tun“. So sah es aus, das Geschäft ihres ganz speziellen Krieges.
Doch allem Anschein nach übernahmen diese Offiziere ihre Aufträge mit einem Eifer, der nur schwer zu begreifen ist. Allem Anschein nach gingen viele von ihnen mit Begeisterung zu Werke, und für nicht wenige war dies der Höhepunkt ihres Lebens, ein intensiver Augenblick, gleichsam gewürzt mit der Erregung großer Ereignisse. Und nun endlich wurden sie für einen Auftrag, den sie gut erledigt hatten, großzügig belohnt.
Begleitet wurden sie oft von einer Schar junger, attraktiver Frauen – größtenteils Verwaltungsfachkräfte – und sogar von Babys und Kindern mit fröhlichen Gesichtern. Etwa 30 Kilometer rumpelte ihr Bus vorbei am äußeren Zaun des Lagers, an den bewaldeten Böschungen der Sola, an kleinen Dörfern, deren Katen noch unberührt waren vom Krieg, durch die Berge, bis sie zu einer kleinen hölzernen Brücke kamen. Kurz darauf waren sie an ihrem Ziel angelangt, der „Solahütte“, einem friedlichen Erholungsheim im Alpenstil, das, versteckt in den Bergen, zu einem oberhalb des malerischen Flusses gelegenen Erholungskomplex der SS gehörte.
Hier sollten sie einen rund achttägigen Urlaub verbringen, den ein Fotograf in zahlreichen Schnappschüssen für die Nachwelt festhielt.3
Die strahlenden Offiziere und ihr weiblicher Anhang wirken auf diesen Fotos als posierten sie, eingerahmt von Bergen und Tannen, für harmlose Reiseplakate, die eine ganz besondere Sommerfrische illustrieren. Das Einzige, was fehlte, waren Badeanzüge und der Klang von Grammophonmusik. Die Frauen tollten mit makelloser weißer Haut herum, während die Offiziere rauchten und sich unterhielten. Die Atmosphäre war leicht wie auf einem impressionistischen Gemälde von William Glackens, unbeschwert wie Jahrzehnte früher, vor dem Krieg und den Jahren der lähmenden Weltwirtschaftskrise. Gelegentlich, an warmen Nachmittagen, lagen sie träge, mit Decken über den Beinen, in Liegestühlen auf der breiten hölzernen Veranda; ein paar machten ein Nickerchen, einige plauderten, sonnten sich oder nippten an einem Getränk. Andere drückten ihre Kinder an sich oder tobten mit ihren Hunden herum und brachten ihnen bei, „Sitz!“, „Platz!“ und „Steh!“ zu machen. Später zogen die Männer sich zurück, versammelten sich auf zwei langen Bänken um einen Metalltisch, wo sie Wein und Bier tranken. Einige krempelten die Ärmel hoch und rauchten.
Die einfachen Freuden des Lebens zurückerobernd, machten sie das Beste aus ihrer Zeit hier, genossen die gute Gesellschaft, das gute Essen, die frische Luft und fröhliche Zusammenkünfte. Und der Rest der Welt schien ziemlich weit weg zu sein. Der Krieg? Die drohende Invasion? All das war vergessen.
Die Luft war sauber, und wenigstens konnten sie tief durchatmen, gut essen und sich sogar zu Schäferstündchen in pittoresker Umgebung zusammenfinden. Und nicht nur jetzt suchten hier Männer Erholung, sondern das ganze Jahr über. Ab Juni würden weitere Urlauber eintreffen. Dann wäre das Wetter warm, und die Felder wären voller Blumen. Auf den entsprechenden Fotos sieht man junge Frauen in weißen Blusen und adretten schwarzen Röcken, die sich in einer Reihe aufgestellt haben oder auf dem Geländer der Veranda hocken, während ein Begleiter ihnen in kleinen Schalen Blaubeeren serviert und ein anderer sie mit seinem Akkordeon unterhält. Nach dem Verzehr der letzten Beere halten sie ihre Schälchen in gespielter Bestürzung scherzhaft verkehrt herum in die Kamera.
Die Männer in ihrer Begleitung waren gutaussehend und gepflegt, und die Frauen machten einen sittsamen und liebreizenden Eindruck. Auffallend ist, dass alle trotz des tobenden Krieges so gefasst, so kultiviert, so gebildet wirken und in allen möglichen Situationen für die Kamera posierten. Sie posierten beim gemeinsamen Singen – Offiziere und junge Frauen, insgesamt etwa hundert, drängen sich auf einem Hügel zusammen, kaum imstande, ihren Leichtsinn zu zügeln. Sie posierten, wenn das Akkordeon erklang und sie zu seinen Melodien tanzten. Sie posierten sommerlich gekleidet in der freien Natur und beim Schießtraining. Sie posierten in ausgelassenen Momenten, etwa wenn ein leichter Regen einsetzte und sie wie irre rannten, um sich irgendwo unterzustellen; oder abends, wenn sich der Tisch, gedeckt mit einem frisch gebügelten Tischtuch, feinem Porzellan und eleganten Weingläsern, unter dem reichlichen Essen bog. Während der Wintersaison posierten sie beim feierlichen Anzünden der Lichter am Weihnachtsbaum. Und später posierten sie sogar bei einer Beerdigung im Schnee, bei der die Särge – auf dem Schlachtfeld allzu oft eine Seltenheit – mit NS-Flaggen drapiert waren.4
Doch es gab eine Zeit, da das Posieren ein Ende hatte, dann nämlich, wenn sie zu ihrer blutigen Arbeit zurückkehrten. Dieses Nebeneinander ist ernüchternd, denn diese scherzenden Urlauber waren allesamt Angehörige der gefürchteten SS. Ihr Arbeitsplatz: Auschwitz. Tatsächlich war sogar ihr Urlaubsort, „Solahütte“, eine Außenstelle des Lagers, erbaut 1942 von einem jüdischen Häftlingskommando unter Leitung von Franz Hößler, SS-Obersturmführer und Schutzhaftlagerführer im KZ Auschwitz. Zu den Urlaubern, die es zur Hütte und ihrer Umgebung zog, gehörten auch Josef Mengele, der nichtsahnende Lagerinsassen grässlichen medizinischen Versuchen unterzog, Carl Clauberg, der Sterilisationsexperimente mit Säure durchführte, und Rudolf Höß, Lagerkommandant bis 1943. Die jungen Frauen waren Angehörige des SS-Helferinnenkorps. Letzten Endes bestand auch ihre einzige Funktion in Oswiecim darin, Hitlers „Endlösung“ in die Tat umzusetzen, oder krasser ausgedrückt: Juden zu töten.
Der Frühling schien immer spät zu kommen in Auschwitz. Die allgegenwärtige Kälte und die kahle Landschaft waren eine Konstante. Und jene Juden, die noch nicht gestorben waren? Als Zwangsarbeiter war ihr Leben ein unaufhörlicher Schrecken und eine nicht enden wollende seelische Qual. Diejenigen, die von der sofortigen Hinrichtung verschont blieben und stattdessen in den Arbeitslagern landeten, waren oft binnen Wochen erledigt. Danach wurden auch sie in die Gaskammern geschickt.
Jene, die blieben, konnten nur hilflos über den Horizont aus Stacheldraht starren. Jeden Morgen wurden sie um vier Uhr in pechschwarzer Dunkelheit geweckt, arbeiteten erschöpfende zwölf Stunden praktisch ohne Pause bei kärglichster Kost und waren dann abends gezwungen, endlose Appelle durchzustehen.5 Wenn endlich die Zeit zum Schlafen kam, manchmal nach Mitternacht, so hatten sie anfangs mit Stroh gefüllte Säcke und später primitive, harte dreistöckige Holzpritschen; gewöhnlich zwängten sich sechs und manchmal sogar acht Häftlinge in einziges Bett, das für drei vorgesehen war. Im Allgemeinen pferchte die SS 700 Häftlinge in Baracken, die für 180 gebaut waren. Es gab keine Heizung, keinen Strom, und als Boden diente nichts als die nackte, sumpfige Erde.
Und wenn die Gaskammern die Lagerinsassen nicht schon bald töteten, dann besorgten es Krankheiten: Fleckfieber, Ruhr und Typhus grassierten, aber genauso oft hatte schon eine schlichte Erkältung denselben Effekt. Und die Körper vieler Häftlinge schienen einfach von innen zu verwesen. Offene Wunden nässten an geschwollenen Beinen. Derweil wimmelte es in den Baracken von Ungeziefer, und die ebenso allgegenwärtigen wie mörderischen Läuse waren groß wie Fingernägel und übertrugen Enzephalitis. Der überhand nehmende Unrat und rudimentäre sanitäre Einrichtungen erhöhten gleichfalls die Todesrate.
Innerhalb des Lagers schien die Welt der Häftlinge in Dunkelheit gehüllt. Während des Winters peitschten Winde und Schnee ihre Baracken, während sie, zwischen Leben und Tod schwebend, fast nackt schliefen, ohne Decken, bei Temperaturen unter null Grad. Ihr einziges Kissen war eine Faust – das heißt, wenn sie überhaupt eine Faust machen konnten. Und Schlaf war schwer zu bekommen – ständig hatten Häftlinge trockene Hustenanfälle, dazu kam das stärkere Gekeuche von den Schwerkranken. Oft wachte ein Häftling auf und stellte fest, dass sein Bettnachbar gestorben war. Zu schwach, um die erschreckend leichten Körper ihrer Gefährten zu bewegen, manchmal sogar zu schwach, um sich selbst zu bewegen, schliefen sie einfach weiter.
In der grauenvollen Lebenswelt von Auschwitz konnten die täglichen Gräueltaten der Nationalsozialisten selbst die sanftesten Häftlinge in Monster verwandeln. Ausgemergelte Häftlinge waren bereit, sich bloß wegen einer Brotkruste gegenseitig umzubringen; Söhne wurden gezwungen, ihre Väter für das Krematorium zu selektieren; Mütter wurden gezwungen, ihre Babys zu ersticken. Viele der Häftlinge kamen aus der jüdischen Intelligenz, darunter waren hervorragende Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Buchhalter – angesehene Akademiker aus allen Berufsfeldern. Doch selbst diese ehedem geachteten Persönlichkeiten waren aufgrund ihrer Behandlung durch die Deutschen, der abscheulichen Lebensbedingungen, der willkürlichen Morde und des vorsätzlichen, andauernden Hungerns zu Tieren geworden.
Die Nationalsozialisten löschten die Identität jedes Häftlings aus, ein weiteres Mittel, um Juden jegliche noch verbliebene Würde zu rauben. Sobald sie im Lager waren, hatten die Häftlinge keine Namen mehr; stattdessen wurden sie anhand von Nummern identifiziert, die ihnen mit einer Nadel schmerzhaft in den Unterarm tätowiert wurden. Auch die 700 Kinder, die erstaunlicherweise im Lager geboren wurden, erhielten am Gesäß oder am Oberschenkel eine Tätowierung und wurden als „Neuzugänge“ registriert.
Zudem mussten die Häftlinge alles an verdreckten Klamotten tragen, was man ihnen gab. Die Sachen mochten viel zu groß oder viel zu klein sein, es spielte keine Rolle. Dasselbe galt für Schuhe. Tatsächlich waren die Kleidungsstücke selbst ein Gesundheitsrisiko; sie wurden nie gewaschen, sondern nur bedampft, und das auch nur alle sechs Wochen, bis sie auseinanderfielen. Die Unterwäsche, wenn die Häftlinge überhaupt welche besaßen, war ekelerregend.
Der tägliche Appell war eine Hölle für sich. Für die wenigen Kinder im Lager, die nicht sofort für die Gaskammern selektiert wurden, gab es eine eigene teuflische Variante. Sie wurden gezwungen, stundenlang in Wasser zu stehen, bis ihnen nichts anderes übrigblieb als ihre Blase oder ihren Darm darin zu entleeren; anschließend zwang man sie, dieses Wasser zu trinken. Für alle anderen konnte der Appell je nach Laune der SS eine Stunde dauern, drei Stunden, den ganzen Tag oder die ganze Nacht. Während sie warteten, dass ihre Nummer aufgerufen wurde, waren die Häftlinge immer wieder Schikanen, Isolation (in den Stehzellen von Block 11, dem sogenannten Bunker) und mörderischem Drill ausgesetzt. Stundenlang stramm zu stehen ist schon für einen gesunden Menschen schwer genug, für die Schwachen und Gedemütigten war es fast unmöglich. Einigen knickten die Knie ein, andere kippten um, manche konnten einfach nicht gerade stehen. Sie wurden von der SS brutal geschlagen oder, während sie halb nackt dastanden, eimerweise mit eiskaltem Wasser übergossen. Die Grausamkeiten hörten niemals auf.
Kein Vergehen war zu banal, um bestraft zu werden. Ein schlampig gesäuberter Essnapf konnte zu Einzelhaft bei nur ein paar Bissen Brot und verschmutztem Wasser führen. Ein fehlender Knopf reichte, um einen Häftling in den winzigen Stehbunker, eine Art Telefonzelle ohne Fenster, zu stecken, wo er gezwungen war, barfuß auf dem kalten Stein zu stehen. Dreckige Fingernägel wurden durch Schläge mit einem Bambusrohr bestraft. Wer die Mütze nicht abnahm, wenn die SS vorbeiging, handelte sich oft 50 Hiebe mit einer Peitsche, der gefürchteten „Katze“, ein.6 Und eine mürrische Miene oder Grimasse genügte, um eine aus dem Mittelalter stammende Folter nach sich zu ziehen: das Pfahlhängen mit auf den Rücken gebundenen, hochgezogenen Armen. Der Tod war oft die Folge. Bei einem einzigen, schier endlosen Appell im Jahr 1940 starben 84 Häftlinge vor Entkräftung und an Prügeln. Häufig ließ die Lagerleitung die Körper toter Häftlinge als Exempel auf dem Appellplatz liegen.
Dennoch gab es Häftlinge, welche die ersten paar Wochen im Lager überlebten. Sie klammerten sich oft an die Vorstellung, ihre Lebensbedingungen könnten sich irgendwie verbessern, die Prügel aufhören und ein Mindestmaß an Normalität würde wiederhergestellt. Es sollte nicht sein.
Mit grausamer Orwell’scher Logik stellte die SS ein Häftlingsorchester zusammen – ihm gehörten viele der besten Musiker aus den Hauptstädten Europas und sogar der spätere Leiter der Warschauer Philharmonie, der polnische Komponist und Dirigent Adam Kopycinski, an –, das musizierte, während andere Häftlinge sich in der kalten frühmorgendlichen Dunkelheit zu ihren Arbeitskommandos schleppten. Viele waren faktisch nichts anderes als Todeskommandos: Holzhof, Kiesgrube und Bauhof sorgten beinahe täglich für enorme Verluste.
Die Unterernährung war entsetzlich. Zum „Frühstück“, wenn man es so nennen konnte, bekamen die Häftlinge ungesüßten Kaffee-Ersatz oder etwas, das Kräutertee ähnelte. Zum Mittagessen gab es eine dünne, wässrige Suppe, die winzige Kartoffel- und Steckrübenstücke enthalten konnte, oder Hirsegrütze. Zum Abendbrot wurden ein paar Gramm altes schimmeliges Brot an die Häftlinge ausgegeben, und damit mussten sie bis zum Morgen durchhalten. Alles in allem waren sie gezwungen, von wenigen hundert Kalorien am Tag zu leben. So starben sie schnell, und dennoch stockte die Arbeit nie, weil täglich neue Transporte mit Häftlingen eintrafen, welche die SS ohne Unterlass mit den Worten antrieb: „An die Arbeit, ihr Judenhunde!“
Das Leben im Lager war in jeder Hinsicht brutal und elend. Selbst die Benutzung der Toilette war riskant. Viele Häftlinge konnten sich ungeachtet der Witterung nur in Außenklos erleichtern. Andere mussten sich in später errichteten Baracken eine einzige Latrine mit etwa 30 oder mehr Lagerinsassen teilen. Viele der Häftlinge litten unter Durchfall, sodass sich lange Schlangen bildeten und sie endlos warten mussten, oft stundenlang. Die SS schoss sofort, wenn sie sah, dass sich jemand woanders als auf der Latrine erleichterte. Wer die primitiven Löcher nicht rechtzeitig erreichen konnte, wurde erschossen, und seine Leiche blieb im Kot und Urin liegen. Der Gestank war zum Ersticken. Die widerlichen Körpergerüche, die an den lebenden Gefangenen hafteten, waren es ebenfalls.
So schrecklich war die Situation, dass viele Häftlinge versuchten, ihrem Leben ein Ende zu setzen, indem sie sich gegen den elektrischen Stacheldraht des Lagerzauns warfen.
Und diejenigen, die durchhielten, selbst jene, die zu den Zähesten und Kräftigsten gehört hatten, magerten rasch zu lebenden Skeletten ab, wahnsinnig vor Hunger und kaum mehr lebensfähig. Ihre Zähne faulten und fielen aus. Ihre Haare und Nägel wollten nicht mehr wachsen. Ihre Augen wurden zu großen, eingesunkenen Höhlen in fleischlosen Gesichtern. Wenn der Tag kam, an dem sie nicht mehr laufen konnten, versuchten sie zu kriechen; wenn sie nicht mehr kriechen konnten, versuchten sie, sich auf ihre Ellenbogen zu stützen; und wenn sie dazu nicht mehr imstande waren, richteten sie sich mit angstvollem Blick auf, stumm und gemieden von den anderen Häftlingen, kauten an weggeworfenen Kartoffelschalen, bis sie einfach immer schwächer wurden.
Niemand im Lager bildete sich ein, davonzukommen, es ging allenfalls darum, ein bisschen länger zu leben.
„So war die besondere Situation in Auschwitz“, wie einer der Lagerärzte, Hans Münch, es ausdrückte.7
Auschwitz war tatsächlich anders als andere nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager. Innerhalb eines Gewirrs aus Stacheldrahtzäunen erstreckten sich Hunderte einstöckiger Gebäude, ein Staat im Staate, ein fein abgestimmter Apparat, erschaffen für einen einzigen Mann, Adolf Hitler. Seit den scheinbar harmlosen Anfängen als Arbeitslager im Jahr 1939 war Auschwitz eine Institution mit den „Muskeln“ eines absoluten Despoten und dem „Herzen“ eines Monsters geworden. Eigentlich waren sein Kommandant und die SS gegenüber Berlin rechenschaftspflichtig, aber in Wahrheit wurden sie zu unabhängigen Aufsehern über den Tod. Theoretisch waren ihre nominellen Herren Hitler und sein berüchtigter innerer Kreis – fanatische Nationalsozialisten wie Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Adolf Eichmann und früher Reinhard Heydrich –, aber in der Praxis legten die Verwalter von Auschwitz größtenteils niemandem Rechenschaft ab. Es wurde zum schlimmsten Tötungszentrum, das die Welt jemals gesehen hatte. Mit unbeirrter Hemmungslosigkeit beschlagnahmten sie dort öffentliches Eigentum. Sie hatten die Kontrolle über ihre eigenen Finanzmittel und konnten praktisch jeden Beamten in ihrem Zuständigkeitsbereich suspendieren. Alles, was auch nur entfernt einem ordentlichen Gerichtsverfahren oder internationalem Recht glich, erachteten sie für ein bloßes Ärgernis und verzichteten großzügig darauf. Und fast völlig im Geheimen agierend, entschieden sie mit einem Fingerschnipsen oder einem Zwinkern über das Schicksal von fast zwei Millionen unschuldigen Menschen.
Selbst als das Deutsche Reich 1944 extrem unter Druck geriet, selbst als Hitlers Gesundheit sich verschlechterte und die Intrigen zahlreicher verärgerter Splittergruppen und Fraktionen im NS-Imperium stark zunahmen, geriet Auschwitz niemals ins Wanken. Bis zum Sturz der Nationalsozialisten war es scheinbar allmächtig.
Im Jahr 1944 war Auschwitz weit über das einzelne Vernichtungslager, das bis zu diesem Zeitpunkt Auschwitz II oder Birkenau hieß, hinausgewachsen. Es war inzwischen ein ganzes Netzwerk des Todes, des krankhaften Experimentierens und der Sklavenarbeit. So gab es Auschwitz I, das Stammlager, und außerdem die unter dem Namen Auschwitz III zusammengefassten Nebenlager inklusive Monowitz mit dem Buna-Werk zur Produktion von synthetischem Kautschuk. Am Ende entstand ein ehrgeiziger Komplex aus etwa 40 mit Auschwitz verbundenen Neben- und Außenlagern. In diesen Lagern arbeiteten die SS und die deutsche Privatwirtschaft mit eiskalter, skrupelloser Effizienz Hand in Hand. Angelockt von der billigen Zwangsarbeit – bemerkenswerterweise stellte die SS den Privatfirmen jeden Arbeiter in Rechnung, gewährte staatlichen Unternehmen aber Preisnachlässe –, profitierten binnen Kurzem eine Reihe von Branchen vom ausgedehnten Auschwitz-System: Da waren Konsumgüterproduzenten, Chemikalienhersteller und Metallerzeuger. Da war die beim Konzentrationslager Auschwitz III betriebene Fabrik der I.G. Farben zur Herstellung von Treibstoff aus Steinkohle und von synthetischem Kautschuk (die I.G. Farben hielt auch das Patent auf das in den Gaskammern verwendete Zyklon B). Und da waren die berühmte Friedrich Krupp AG, die Siemens-Schuckert-Werke, die Schlesischen Schuhwerke, die Schlesische Feinweberei AG, die Erdölraffinerie Trzebinia und die Reichsbahn. Zu ihnen gesellten sich die von der SS betriebenen Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, die Deutsche Lebensmittel GmbH, die Deutsche Ausrüstungswerke GmbH und die Zementfabrik AG Golleschau sowie verschiedene Kohlegruben. Es gab sogar eine Fisch- und Geflügelzucht (Harmense) und ein landwirtschaftliches Gut der SS. Aber für die Häftlinge waren diese Unternehmen mehr oder weniger austauschbar. Überall erwartete sie derselbe Hunger, dieselbe harte Arbeit und dieselbe rücksichtslose Ausbeutung.
Das Leben der gewöhnlichen Deutschen im Lager oder in der nahe gelegenen Stadt blieb von dem Massenmord auf erschreckende Weise weitestgehend unberührt. Mit einem eigentümlichen Pioniergeist, vergleichbar dem der Amerikaner, die im 19. Jahrhundert gen Westen zogen, trafen deutsche Siedler aus allen Teilen des Altreiches in Auschwitz und Umgebung ein: aus Hamburg, Köln, Münster, Magdeburg, München und sogar Wien. Diese reichsdeutschen Neubürger waren von einem lebhaften Glauben an ihre eigene Zukunft und von dem Gefühl erfüllt, es sei ihre Pflicht, dem rückständigen slawischen Osten die aufgeklärte deutsche Kultur zu bringen. Sie kamen mit freudigen Herzen – oder heuchelten es –, um Hitlers koloniale Vision zu verwirklichen und eine neue Gesellschaft aufzubauen, eine, die nicht bloß auf Geld, Status und Namen beruhe, sondern auf Mut und Charakterfestigkeit.
Während ausgemergelte, verängstigte Juden in die Gaskammern schlurften oder Insekten aßen, um ihren Hunger zu lindern, oder mitansahen, wie ihre Liebsten sich auf den Wink eines SS-Mannes hin zum Sterben anschickten, versammelten sich Angehörige der Lager-SS abends im „Deutschen Haus“, einem turbulenten Lokal direkt gegenüber vom Bahnhof Auschwitz. Auf der einen Straßenseite beaufsichtigten Mengele und sein medizinisches Personal den Selektionsprozess, auf der anderen Seite tranken SS-Männer dunkles Bier, schliefen in einem angrenzenden Hotel mit willigen jungen Frauen und erzählten sich bis Mitternacht Witze. Trunkenheit war an der Tagesordnung.
In der Tat scheute die NS-Verwaltung scheinbar keine Kosten, um der „tüchtigen“ SS Ablenkung, Amüsement und Zerstreuung zu bieten. Auch im Lager selbst kamen die SS-Männer zum gemeinsamen Singen, zu musikalischen Darbietungen und allen möglichen Belustigungen zusammen (in der Weihnachtszeit wurden Juden in einem Chor gezwungen, „Stille Nacht“ zu singen). Das Lager besaß seinen eigenen Konzertflügel, und Schauspiel-Ensembles aus Deutschland reisten regelmäßig in den Osten, um die SS zu unterhalten. Auschwitz verfügte auch über ein eigenes Theater, das seichte Stücke brachte, etwa sogenannte „Diebeskomödien“ oder frivole Schwänke wie Gestörte Hochzeitsnacht und Heimliche Brautfahrt, aber auch Varieté-Abende, die unter dem Motto „Humorvoller Angriff“ für brüllende Heiterkeit sorgten. Auch die Hochkultur kam nicht zu kurz, wenn etwa das Staatstheater Dresden ein Programm mit dem Titel „Goethe einst und jetzt“ darbot. Und wie um die langen Schatten der Gaskammern zu verbannen, ließen die Nationalsozialisten zur „Verschönerung“ des Lagers Gartengestalter, Landschaftsarchitekten und Botaniker kommen, darunter ein angesehener Professor für Landschafts- und Gartengestaltung von der landwirtschaftlichen Hochschule Berlin.
An Silvester 1943, nur wenige Wochen bevor eine Gruppe ungarischer Juden nach Auschwitz deportiert wurde, feierten deutsche Bewohner der Stadt ein rauschendes Fest im Gasthaus „Ratshof“ am Marktplatz.8 Aus Berlin hatte man Tanzkapellen engagiert und aus Österreich einen berühmten Conférencier. Das Festmahl bestand aus einer Abfolge von Delikatessen – Gänseleber und Ochsenschwanzsuppe, Karpfen blau in Aspik, Hasenbraten und Biskuitrolle, Sekt und Pfannkuchen. Die ausgelassene Lustbarkeit zog sich bis tief in die Nacht, woraufhin drei Sorten Dessert, begleitet von Heringssalat und Kaffee, serviert wurden. Und als die Musik aufhörte, unterhielt ein vom Lager gestellter Komiker die Gäste.
Gab es in Auschwitz jemals irgendein Gefühl der Scham? Oder Gewissensbisse unter den Nationalsozialisten? Oder einfachen Abscheu? Nein. Und die Nationalsozialisten waren weder glücklose Niemande noch lediglich kleine Rädchen in einer riesigen Bürokratie des Todes. In Auschwitz war der Blutdurst niemals gestillt. Mit eiskalter Entschlossenheit beklagten sich die nationalsozialistischen Mörder sogar über Schlupflöcher, welche die Deportation einiger Juden nach Auschwitz verhinderten. Im Gegensatz dazu erhoben selbst auf dem Höhepunkt der europäischen und amerikanischen Sklaverei einige der wortgewaltigsten zeitgenössischen Denker – wie etwa der junge britische Premierminister William Pitt oder die Schriftstellerin Harriet Beecher Stowe, deren Buch Onkel Toms Hütte zum Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkriegs beitrug – ihre Stimmen immer lauter und wütender zur Verteidigung der Menschlichkeit. Und neben all jenen, die von Sklavenarbeit profitieren wollten, gab es auch einige, wie den Töpfermeister Josiah Wedgwood, der 1787 ein berühmtes Medaillon schuf, das im Relief einen knienden Schwarzen in Ketten zeigt, der demonstrativ fragt: „Bin ich kein Mensch und Bruder?“9
Fast nichts dergleichen fand in Auschwitz, in der umfassenderen deutschen Verwaltung oder in der deutschen Bevölkerung statt. Stattdessen kehrten die Deutschen das berühmte Märchen von Hans Christian Andersen um – nichts sang hier in den Flammen, sondern alles verstummte für immer, kein Wesen tanzte zur Sonne, und die Kinder hier wussten viel zu viel.
In Hitlers manichäischem Weltbild sollte der Konflikt zwischen Gut und Böse im Kampf zwischen der arischen Rasse und den Juden seinen Höhepunkt erreichen.10 Was auch immer auf den Schlachtfeldern geschah, im Kampf um die Ausrottung des europäischen Judentums durfte es ihm zufolge kein Erbarmen geben. „Mitgefühl mit den Juden“, sagte Hitler einmal, sei „ganz und gar nicht am Platze.“11 Derselben Logik folgend würde Adolf Eichmann eines Tages bereuen, dass die Nationalsozialisten „nicht mehr“ getan hatten. Folglich würde Heinrich Himmler damit prahlen, dass die SS beim Massenmord an den Juden „moralisch anständig“ geblieben sei, und beklagen, dass dieses „ruhmreiche Kapitel“ der Vernichtung nie geschrieben würde.
Aber während die riesige alliierte Armada sich in Großbritannien für die D-Day-Invasion sammelte und Präsident Roosevelt sich erholte, war ein einzelner Insasse in Auschwitz entschlossen, dafür zu sorgen, dass seine Geschichte aufgeschrieben und von der Welt gelesen würde. Er war entschlossen, Roosevelt warnend auf das drohende Massaker an den ungarischen Juden hinzuweisen und die Kräfte der Rettung und des Aufruhrs zu mobilisieren. Und er war entschlossen, etwas zu tun, was niemand zuvor vollbracht hatte: aus Auschwitz zu fliehen.
Auf den ersten Blick schien kein Mann weniger geeignet, die Absichten der Nationalsozialisten zu durchkreuzen oder das Schicksal der verbleibenden Juden Europas auf seine Schultern zu laden, als Rudolf Vrba.12 Mit seinen 19 Jahren eher ein naiver Jüngling als ein Mann, hatte er jedoch sicher mehr Erfahrungen gesammelt als andere bis ins hohe Alter und mehr Leid gesehen, als ein Mensch auf Erden ertragen kann. Er wurde 1924 als Walter Rosenberg in Topolcany in der Slowakei geboren. 1944 änderte er seinen Namen in den eleganteren und weniger semitisch klingenden Rudolf Vrba, und seine Freunde nannten ihn fortan liebevoll Rudi. Er kam aus bürgerlichen Verhältnissen: Seinem Vater gehörte ein Sägewerk, seine Mutter war Schneiderin und Hausfrau und ziemlich stolz auf ihre Kochkünste. Sie neckte ihn gern, und er neckte gern zurück. Körperlich war er eindrucksvoll: Auffallend attraktiv, mit einer pechschwarzen Mähne, einem breiten Kreuz und einer schlanken Figur. Buschige Augenbrauen umrahmten seine lebhaften dunklen Augen, und sein Gesicht prägte ein markantes Kinn. Er war zugleich empfindsam und berechnend, eigensinnig und weichherzig und nach Aussagen anderer „ungestüm“ und „impulsiv“. Und seit seinem 17. Lebensjahr befand er sich entweder auf der Flucht oder in einem Vernichtungslager.
Seine Schulbildung war überschaubar, nachdem er aufgrund der antijüdischen Gesetze in der Slowakei, die sich an den Nürnberger Gesetzen orientierten, mit 15 Jahren das Gymnasium hatte verlassen müssen. Aber was das Lernen und eigentlich auch alles andere betraf, verlor er nie die Hoffnung. Statt aufzugeben, fand er Arbeit als ungelernter Arbeiter und brachte sich selbst Russisch und Englisch bei. Auch Deutsch sprach er fließend und irgendwann auch Polnisch und Ungarisch. In den schlimmsten Zeiten – und die machten im Grunde seine ganze späte Jugend aus – bewahrte er sich irgendwie stets sein ansteckendes Grinsen und seine einnehmende Art. Beide sollten ihm noch gute Dienste leisten.
Nachdem den Juden die Schule versagt worden war, kamen bald weitere schleichende Einschränkungen. Zuerst durften Juden nicht mehr umziehen, nur noch in bestimmten Orten leben und selbst dort nur in bestimmten Vierteln. Dann wurde die Reisefreiheit beschnitten. Ghettos entstanden plötzlich, und Juden mussten einen gelben Davidstern auf ihrer Kleidung tragen.13 Dann kamen die Deportationsgesetze; den Juden in der Slowakei wurde mitgeteilt, dass sie „in eine Art Reservat in Polen umgesiedelt“ würden, „wo man [ihnen] beibringen würde, zu arbeiten und eigene Gemeinschaften aufzubauen“.14 Und als die Nationalsozialisten sein Land noch stärker in die Zange nahmen, war Vrba entschlossen, sich in die Freiheit durchzuschlagen. Im März 1942, während noch Schnee fiel, riss er sich den Davidstern von seiner Kleidung, stopfte sich 200 Kronen in die Tasche, sprang in ein Taxi, das von einem Bekannten seines Vaters gefahren wurde, und machte sich nicht, wie so viele andere, in Richtung Osten auf, sondern wagemutig gen Westen, in Richtung Großbritannien, wo er sich der tschechoslowakischen Exilarmee anschließen wollte. Kurz vor Tagesanbruch überquerte er die Grenze nach Ungarn und begab sich zum Haus eines Schulfreundes. Nach vier Stunden setzt er seine Reise fort: Er hatte versucht, sich einen glaubwürdigen Anschein als Nichtjude zu geben, und trug nun einen Straßenanzug sowie unter dem Arm die örtliche Faschistenzeitung. Mit einer Fahrkarte zweiter Klasse war er in einen Schnellzug nach Budapest gestiegen. Doch je näher er der Freiheit kam, in desto größere Gefahr brachte er sich. Nachdem er in Budapest beinahe von einer zionistischen Organisation der Polizei übergeben worden war (ironischerweise erhielt er mehr Hilfe von einem pragmatischen Faschisten, dessen Namen ihm die Familie seines Schulkameraden genannt hatte), versuchte Vrba als Arier in die Slowakei zurückzukehren. Stattdessen wurde er von ungarischen Grenzposten aufgegriffen, als Spion verdächtigt, brutal verhört und zur ungarisch-slowakischen Grenze gebracht, wo slowakische Grenzer ihn fanden, als „jüdische[n] Mistkerl“ verhöhnten und in das Durchgangslager Nováky steckten.15 Dort lernte er schnell den Kodex eines Konzentrationslagers: Bestechung, Gier, Betrug.
Irgendwie entkam er nach ein paar Wochen. Er wanderte verzweifelt durch einen dichten Wald und machte sich wieder auf den Weg in seine Geburtsstadt, wo er mehrere Tage blieb, bis er erneut geschnappt wurde. Diesmal wurde er der SS übergeben und in ein gefürchtetes Vernichtungslager geschickt, Lublin-Majdanek.
In Majdanek sah er endlose Reihen hässlicher Baracken, bedrohliche Wachtürme und Starkstrom-Stacheldraht. Und er sah zahllose Menschen aus seiner Heimatstadt: Bibliothekare und Lehrer, Werkstattbetreiber und Ladenbesitzer, alle in zerlumpter gestreifter Häftlingskleidung, alle mit kahlgeschorenen Köpfen, alle zur Ermordung vorgesehen. Dann begann das Schießen. Während aus Lautsprechern Tanzmusik oder Soldatenlieder dudelten, führte die SS Männer und Frauen in getrennten Reihen an die Ränder von Gräben, bevor sie sie mit Maschinengewehren niedermähten. Vrba sah all das entgeistert mit an. Er sah manche, die mit offenen Augen starben, erstarrt in einem Ausdruck unfassbarer Qual. Er sah manche, die wegzukriechen versuchten, nachdem sie nur angeschossen worden waren. Und er sah manche, die sofort zusammensackten und starben, wo sie standen. 17.000 starben an diesem Tag. Unter ihnen war Sam, Vrbas Bruder.
Nur zwei Wochen später, am Abend des 30. Juni 1942, wurde Vrba nach Südwesten verlegt, nach Auschwitz. Anfangs dachte er in seiner Naivität, Auschwitz wäre ein weniger gefährlicher Ort als Majdanek. Er wurde rasch eines Besseren belehrt. „Überall sah ich Ordnung, Sauberkeit und Stärke, die eiserne Faust im antiseptischen Gummihandschuh.“16 Ihm wurde der Kopf rasiert und eine Nummer in den Arm tätowiert – Rudolf Vrba war nun Häftling 44.070.
Welche Hoffnung zu überleben er auch gehegt haben mochte, sie wurde bald zerstört. Auschwitz war, wie ihm klar wurde, ein stinkendes Schlachthaus.
Aber während manche anderen Häftlinge das äußerste Extrem der Einsamkeit erreichten oder ihre schwindenden Tage in roboterhaftem Stumpfsinn verbrachten, hatte Vrba stets seine fünf Sinne beisammen. Während manche schrien und um ihre Hinrichtung bettelten, hielt Vrba seine Gefühle immer unter Kontrolle. Während andere Überlebende untröstlich waren, nachdem ihre Liebsten, nackt und zitternd, in den Tod geführt worden waren, gelang es ihm irgendwie, im Geiste Erinnerungen an sein früheres Leben heraufzubeschwören. Ehrgeizig, verschlossen und mit einem eisernen Willen entwickelte er von Anfang an eine Überlebensstrategie. Im Bewusstsein, dass Essen Kraft bedeutet – auch wenn der Tee wie Spülwasser schmeckte und das klumpige Brot Sägemehl enthielt –, beschloss er, so gut zu essen wie möglich. Er erfuhr schnell von dem Schwarzmarkt im Lager, der hier und da ein paar Glückliche am Leben erhielt und unzähligen anderen Folter und Tod brachte.
Vrba hatte Glück. Zunächst einmal war er kräftig, sodass er ein begehrter Arbeiter war. Dann wurde er im August 1942 dem sogenannten Aufräumungskommando zugeteilt, das sich um die Habe der vergasten Opfer kümmerte. Er arbeitete jetzt auf dem berühmten Magazingelände des Lagers, dem Häftlinge, die sich das reale Kanada als ein beinahe magisches Land voller Reichtümer vorstellten, den Spitznamen „Kanada“ gegeben hatten. Hier sortierte er das Hab und Gut der nach Auschwitz deportierten Juden. Er durchwühlte deren Taschen, nachdem sie aus dem Zug gestiegen waren, und manchmal betrat er die leeren Waggons, um die Körper der Toten wegzuschaffen. Als Arbeiter in „Kanada“ hatte Vrba Zugang zum Lebensmittellager der SS, wo sich die Konserven stapelten – Marmelade, Nüsse, Gemüse, Schinken, Rindfleisch und Obst –, zusammengestellt für den Genuss der SS und fast alles leicht zu stehlen. Er lernte, dass Zitronen äußerst wertvoll waren, weil sie Vitamin C enthielten, und für die Risikofreudigen gab es sogar Steak.
Wenn er nicht gerade sein Überleben plante, studierte Vrba sehr genau den Vernichtungsapparat. Während der nächsten elf Monate hatte er einen seltenen Blick auf die Geschehnisse, weil er nicht nur im Lager lebte, sondern auch bei der Ankunft der meisten Transporte anwesend war. Fassungslos sah er, wie wenig die verstörten und orientierungslosen Neuankömmlinge über Auschwitz wussten, wenn sie kraftlos aus den Zügen stiegen. Bei der Durchsicht ihres Gepäcks stellte er fest, dass sie Pullover für den Winter, kurze Hosen für den Sommer, feste Schuhe für den Herbst, Baumwollhemden fürs Frühjahr eigepackt hatten – kurz, Kleidung für ein ganzes Jahr. Sie hatten Gold und Silber und Diamanten mitgebracht, um für Waren zu bezahlen oder Bestechungsgelder anzubieten. Auch die wesentlichen Dinge häuslichen Lebens hatten sie dabei, Gegenstände wie Tassen, Besteck und andere Utensilien, ein offensichtliches Anzeichen dafür, dass viele tatsächlich glaubten, sie würden lediglich irgendwo in den Osten „umgesiedelt“.
Nicht ein Tag verging, an dem Vrba nicht von Flucht träumte. Obwohl es ihm bislang gelungen war zu überleben, war ihm stets bewusst, dass ihn jeder Tag „dem Tod in der einen oder anderen Form näher brachte“. 17 Dennoch verbesserte er im Sommer 1943 seine Stellung in Auschwitz dramatisch, als er zunächst „Hilfsblockschreiber“ und dann „Blockschreiber“ im Quarantänelager von Birkenau wurde, wo er normale Kleidung erhielt. Auch durfte er sich fortan relativ ungehindert im Lager bewegen und hatte Zugang zu besserem Essen. Er knüpfte weitere Kontakte zu einem noch in den Kinderschuhen steckenden Lager-Untergrund – der jedoch nie aus den Kinderschuhen herauskam, weil seine Angehörigen ständig getötet wurden.
Und geduldig und fleißig begann er Statistiken über die tagtäglich begangenen Massenmorde zusammenzustellen. Sein Gedächtnis war phänomenal. Er merkte sich jeden Transport, der ankam, und vor allem die Anzahl der Waggoninsassen. Er lernte die Nummernserien auswendig, die jeder Opfergruppe bei der Ankunft zugewiesen wurden. Und indem er sich mit anderen Blockschreibern austauschte, konnte er die verbrannte Brennstoffmenge und somit die Zahl der eingeäscherten Leichen errechnen. Außerdem befragte er das Sonderkommando, jene Gruppe kräftiger, junger, überwiegend jüdischer Häftlinge, die von den Nationalsozialisten ausgesucht wurden, um die Leichen aus den Gaskammern und Krematorien zu entfernen (wer für das Sonderkommando ausgewählt wurde und sich weigerte, wurde vergast oder erschossen). Auf diese Weise erfuhr er, wie die Gaskammern genau funktionierten. Schließlich wurde er, obwohl noch jung, Kurier für den Widerstand innerhalb des Lagers.18
Wenn Überleben ein Befähigungstest ist, dann war Vrba der Fähigste von allen, wie er sich sicher durch eine Krise nach der anderen manövrierte und dabei dem Tod, Schlägen und der Entdeckung entging. Er schien neun Leben zu haben, und er verschacherte und verkaufte sie alle. Einmal wäre er fast gestorben, aber er schaffte es, so lange immer wieder der „Beförderung für würdig befunden“ zu werden, anders kann man es nicht ausdrücken, bis er schließlich „zumindest halbwegs als zum lebenden Inventar [des Lagers] gehörig betrachtet“19 wurde. Weil er sich das Vertrauen der Deutschen verdiente, soweit das überhaupt möglich war, litt er niemals Hunger; und während andere grausam verhungerten, kam er gelegentlich in den Genuss von Schokolade, Sardinen oder von „reine[m] Zitronensaft mit Wasser und Zucker“.20
Die Leute fingen sogar an, ihn beim Vornamen zu nennen, was ebenfalls selten vorkam.
Wie wurde er mit all dem Leid und Tod um ihn herum fertig? Zu wissen, dass diese Dinge passierten, und sie überstanden zu haben, muss ein unsagbares Grauen gewesen sein. Und jetzt, im Spätsommer 1943, war Vrba über ein Jahr in Auschwitz am Leben geblieben. Er war inzwischen nach eigener Aussage „schon ein wenig taub gegenüber dem Leiden geworden“.21 Aber dann verwandelte sich die Welt von Auschwitz. Am 7. September trafen 4000 tschechoslowakische Juden aus dem Ghetto Theresienstadt ein. Sie kamen als Familien, die Männer trugen Gepäck, und die Kinder hielten Puppen und Teddybären umklammert. Die SS-Männer flachsten herum mit diesen Neuzugängen. Sie spielten mit den Kindern. Die Häftlinge wurden weder in die Gaskammern geschickt noch ins Arbeitslager abkommandiert. Die Familien wurden nicht getrennt, und ihre Köpfe wurden nicht rasiert. Sie durften ihre eigene Zivilkleidung behalten und in relativem Komfort in einem angrenzenden Lager wohnen, das eigens für sie errichtet worden war. Weit davon entfernt, verprügelt zu werden, wurden sie regelrecht gehätschelt.
Über den Stacheldraht hinweg sahen Vrba und die anderen verhungernden Überlebenden staunend zu. Während jeden Tag Tausende von Lagerinsassen dahinsiechten, mit den Füßen schlurften, wenn das Gehen zu schwierig wurde, und Blut oder schwarzen Speichel spuckten, schienen diese Tschechen ein beinahe idyllisches Leben zu führen. Die Kinder hatten einen Spielplatz, wo die SS Spiele für sie organisierte. In einem hölzernen Schuppen war eine kleine Schule eingerichtet worden, die ein ehemaliger Berliner Sportlehrer leitete. Die Familien bekamen Seife, Medikamente und besseres Essen. Und die Wachen brachten Süßigkeiten und Obst für die herumtollenden Kinder, mit denen sie sich liebevoll balgten. Die Frage war natürlich, warum?
Je mehr Vrba bohrte, desto mehr erfuhr er. Zunächst erlitt er einen kleinen Schock: Beim Herumschnüffeln im Büro des Lagerschreibers fiel ihm auf, dass die eintätowierten Nummern der tschechischen Häftlinge nicht zu den sonstigen Nummern in Auschwitz passten. Dann folgte ein größerer Schock: Er sah außerdem, dass jeder Häftling mit einer ganz besonderen Karte registriert war, auf der stand: „Sechs Monate Quarantäne mit Sonderbehandlung“.22 „Sonderbehandlung“ war die Chiffre für Vernichtung.
Vrba kam bald dahinter: Das Ghetto Theresienstadt und seine Juden waren eine verdrehte Phantasie des „Dritten Reiches“.23 Theresienstadt war einer der Orte, zu denen die Nationalsozialisten Beobachtern des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes regelmäßig Zugang gewährten, um die sich immer weiter verbreitenden Gerüchte über Massenhinrichtungen zu zerstreuen. Ende Februar 1944 zeigte sogar Adolf Eichmann persönlich dem Leiter der Auslandsabteilung des Deutschen Roten Kreuzes, Max Niehaus, das Auschwitzer Familienlager als Beweis dafür, dass Deutschland Juden menschlich behandele. Im nationalsozialistischen Märchen, das vorgab, die Millionen von Juden würden nicht in Todeslagern vernichtet, sondern lediglich in Arbeitslager im Osten umgesiedelt, spielten die Tschechen eine Hauptrolle. Daher wurden diese 4000 abgesondert – abgesondert von den Vergasungen und den systematischen Prügeln, vom Elend und den monströsen Gräueltaten. Sechs Monate lang ging es diesen 4000 gut. Sie schlossen Freundschaften, unterrichteten ihre Kinder, aßen im Kreis der Familie, verliebten sich, führten ihr Leben fast normal fort und träumten von Freiheit. Aber das Ende kam so plötzlich wie der Anfang. Am 5. März wurden die Insassen des Familienlagers angewiesen, Postkarten nach Hause zu schreiben und ausführlich über die Annehmlichkeiten zu berichten, die sie hier genössen. Aber die Nationalsozialisten stempelten diese Karten schlauerweise, um das Geheimnis von Auschwitz zu wahren, mit „Birkenau bei Neuberun, Oberschlesien“24 – Neu-Berun war ein zehn Kilometer nordwestlich des eigentlichen Vernichtungslagers gelegenes Städtchen. Um das Täuschungsmanöver perfekt zu machen, wurden die Insassen aufgefordert, ihre Verwandten um Lebensmittelpakete zu bitten und sämtliche Karten um drei Wochen vorzudatieren.
Dann plötzlich, am 7. März, auf den Tag genau sechs Monate nach Ankunft der tschechoslowakischen Juden aus Theresienstadt, waren die Schritte von SS-Wachen zu hören, die das Sonderlager umstellten.
Dem Sonderkommando war bereits befohlen worden, die Feuer der Krematorien zu schüren.
Am Nachmittag kamen die Lastwagen. Unempfänglich für die Schreie der Kinder und gnadenlos mit Knüppeln auf die Häftlinge eindreschend, trieb ein kleines Heer von Kapos sie auf die Transporter und fuhr Richtung Gaskammern. Beim Anblick des Auskleideraums wurde ihnen die Ungeheuerlichkeit ihres Schicksals klar. Seit Monaten hatten sie den Geruch aus den Krematorien gerochen. Sie wussten, was sie erwartete. Zu spät gingen sie auf die Wachen los und wehrten sich mit ihren Fäusten. Aber das Ende kam so schnell wie der Anfang. Die SS-Männer waren bereit. Schnell und entschlossen ausschreitend, prügelten sie die aufbegehrenden Opfer mit Gewehrkolben und setzen, wenn das nicht genügte, Flammenwerfer ein. Mit eingeschlagenen Schädeln und stark aus ihren Wunden blutend, wurden die nackten Häftlinge in die Kammer getrieben. Als die Zyklon-B-Kügelchen durch das Dach nach unten fielen, stimmten sie zuerst die tschechoslowakische Nationalhymne Kde domow muj, „Wo ist meine Heimat?“, und dann das hebräische Lied haTikwa, „Hoffnung“, an, bis sie sich still in ihre Hinrichtung ergaben.25
Vrba war todunglücklich. Nachdem er vergeblich auf einen Aufstand unter den Häftlingen gehofft hatte, erkannte er nun, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als zu fliehen und irgendwie die Welt zu warnen. Monatelang hatte Vrba heimlich seine Flucht geplant: Er wusste, dass bislang noch jeder Versuch gescheitert war, doch ihm blieb keine andere Wahl mehr.
Anfang 1944 hatten die Nationalsozialisten in Auschwitz mit dem Bau einer zusätzlichen dreispurigen Gleisanlage begonnen, die direkt zu den Gaskammern und Krematorien führte. Künftig wären keine Lastwagen und keine Selektionen mehr nötig; die Waggontüren würden sich einfach öffnen, und Männer, Frauen und Kinder würden unmittelbar in den Tod geschickt. Bestürzt sah Vrba die neuen Gleise von seinem Bürofenster aus, erblickte jeden Morgen, „dass die Schienen ihrem Ziel wieder ein paar Meter nähergekommen waren“.26 Er beobachtete, wie sich die Häftlinge auf ihnen abschufteten, selbst nachts noch im Licht der Bogenlampen, um die Arbeitsstunden zu verlängern. Auch bemerkte er, wie andere Insassen hämmerten und bauten, um das Lager beinahe um das Doppelte zu vergrößern. Diese Erweiterung von Auschwitz konnte nur eines bedeuten: Die Nationalsozialisten bereiteten sich auf die Ankunft einer weiteren großen Gruppe von Juden vor. Das einzige Land, in dem noch eine derart große jüdische Bevölkerungsgruppe übrig war, war Ungarn. Vrbas Vermutungen wurden von der SS bestätigt, die angab, das Lager erwarte neue Transporte, und grausam über „ungarische Salami“ witzelte. Und Vrba wusste, was das bedeutete: Als Juden aus den Niederlanden vergast worden waren, hatte er gehört, wie die SS damit prahlte, sich am Käse aus deren Reiseproviant gütlich getan zu haben. Als französische Juden eintrafen, labte sich die SS an Sardinen, als griechische Juden ins Lager kamen, aß sie Halwa und Oliven aus ihren Bündeln.
Vrba und seine Freunde schätzten, dass eine Million Juden in Ungarn in Gefahr waren. Eine solche Anzahl zu transportieren und zu töten wäre ein Rekord, selbst für Auschwitz. Dennoch schien es nicht nur glaubhaft, sondern möglich. Deutsche Zeitungen, die einige der Häftlingsanführer fanden, berichteten, dass die deutsche Wehrmacht in Ungarn einmarschiert sei, um „die Ordnung wiederherzustellen“.27 Ein Kollaborationsregierung unter Döme Sztójay sei eingesetzt worden, und nun liege das Schicksal der Ungarn in den Händen der Nationalsozialisten. Langsam verarbeitete Vrba diese wuchtigen Fakten. Er wollte jetzt mehr tun als lediglich die nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu dokumentieren. Er hegte die ehrgeizige Hoffnung, Verbrechen zu verhindern und die Ungarn warnen und aufrütteln zu können: „[…] eine Million Menschen musste sich zu einer Armee formieren, die eher kämpfen als sterben würde“.28 Wenn die Ungarn wüssten, was sie erwartete, glaubte Vrba, könnten sie zumindest Gegenwehr leisten, bevor sie die Transporte bestiegen, und vielleicht sogar gerettet werden.
Gewissenhaft bildete Vrba sich ein Urteil über jeden früheren gescheiterten Fluchtversuch, analysierte die Fehler und tüftelte aus, wie sie zu vermeiden wären.
Er machte sich kaum Illusionen über die Schwierigkeit, die Sicherheitsvorkehrungen von Auschwitz zu knacken. Aber obwohl er akzeptierte, dass alle anderen im Lager starben, war ihm der Glaube an sein eigenes Entkommen zum Prinzip geworden. Er kannte die Strafen für eine gescheiterte Flucht, hatte er sie doch schon in seiner allerersten Woche in Auschwitz mitangesehen. Als er eines Nachmittags mit seinem Arbeitskommando zurück zu seinem Block marschierte, erblickte Vrba zwei mobile Galgen. Unter den wachsamen Augen von Rudolf Höß, dem Lagerkommandanten, waren Tausende von Häftlingen versammelt worden. Dann brüllte ein Oberscharführer mit lauter, tragender Stimme, dass zwei polnische Häftlinge bei einem Fluchtversuch erwischt worden seien: „Das duldet die Lagerleitung nicht.“29 Daraufhin führte eine SS-Kolonne die zwei ausgemergelten, dreckverschmierten, barfüßigen Häftlinge in ihrer Mitte hinaus zu den Galgen. Die Schritte der Häftlinge wurden begleitet von anschwellendem Getöse, das eine Reihe SS-Männer mit vor den Bauch geschnallten Trommeln erzeugte, aber die Gefangenen zeigten „keine Anzeichen von Furcht, Traurigkeit oder Panik“. Erst beim Erreichen der hölzernen Stufen stockten sie. Einer von ihnen setzte zu einer Rede an, aber der Lärm der Trommler übertönte seine Worte. Vergeblich redete er weiter, während der Henker ihm und seinem Gefährten die Seile um den Hals legte und dann die Hebel umlegte. Die Falltüren öffneten sich, es tat einen dumpfen Schlag, dann noch einen. Doch zu Vrbas Entsetzen fielen die Häftlinge „kaum fünfzehn Zentimeter tief“. Sie wurden nicht erhängt, sie wurden langsam erwürgt. Die versammelten Männer sahen zu, wie die gescheiterten Flüchtlinge sich panisch wanden und krümmten, erst hektisch, dann langsam, dann gar nicht mehr.
Die Trommeln verstummten, „und ein Vakuum der Stille entstand“, unterbrochen nur von dem barschen Befehl, der Vrba und die übrigen Häftlinge eine weitere Stunde strammstehen und auf die leblosen Körper starren hieß. Kommandant Höß zog sich zurück, und die SS marschierte „samt Trommeln und Maschinenpistolen in schönster preußischer Marschordnung ab“.30 Unter einer sinkenden Sonne blickte Vrba, jede Kränkung schluckend, auf die baumelnden Häftlinge, während in ihm der Entschluss zum Ausbruch reifte.
Die Herausforderung bestand darin, dass das Stammlager Auschwitz, wo sich Vrba befand, unterteilt war in ein äußeres Lager, in welchem die Insassen arbeiteten, und ein inneres Lager, wo sie schliefen. So gesehen musste er nicht einmal entkommen, sondern zweimal. Um das innere Lager von Auschwitz-Birkenau verlief ein Wassergraben, sechs Meter breit und fünf Meter tief, wie bei einer mittelalterlichen Burg. Dieser Graben wiederum war mit gut drei Meter hohem elektrisch geladenen Stacheldraht umzäunt. Und zusätzlich zu diesen materiellen Barrieren gab es menschliche. Tag und Nacht richteten SS-Männer von ihren Wachtürmen aus Maschinengewehre auf die Häftlinge. Sobald die Dämmerung einsetzte, tauchten Lampen die Baracken und die Stacheldrahtzäune des inneren Lagers in gleißendes Licht. Falls es irgendeinem Häftling gelang, diese Hindernisse zu durchbrechen, schrillten Sirenen und Trillerpfeifen, sobald die äußeren Türme Alarm gaben. Binnen Sekunden hetzten 3000 Mann und 200 knurrende Hunde los, um das gesamte Areal abzuriegeln. Und das offene Gelände zwischen dem inneren und dem äußeren Lager, um das sie patrouillierten, war vollkommen kahl und ausdrücklich als Todeszone angelegt. Jeder entflohene Häftling, der diese staubige, leere Fläche überquerte, wäre eine leichte Beute und völlig dem Kreuzfeuer der Wachtürme ausgeliefert, welche die innere und äußere Lagerumzäunung in zwei Reihen säumten.
Ein Hoffnungsschimmer für Vrba war, dass bei höchster Alarmstufe die Soldaten und Hunde das Lager nur drei Tage und Nächte durchkämmten. Wenn der Flüchtige bis dahin nicht gefasst war, wurden die Postenketten in der Annahme abgezogen, dass der Häftling es nach draußen geschafft hatte. An diesem Punkt wurde die Suche dem weiten Netz der SS-Behörden außerhalb von Auschwitz übergeben. „Aus alledem schloss ich“, erzählte Vrba später, „dass ein Mann, der sich drei Tage und drei Nächte außerhalb der inneren Absperrung versteckt halten konnte, eine reelle Chance hatte.“31
Eine reelle Chance vielleicht, aber bislang hatte noch niemand einen Weg gefunden, sie zu ergreifen. Und so begann Vrba, während er nachts auf seiner harten Holzpritsche lag, vor dem Einschlafen mit dem, was er seine „erste wissenschaftliche Studie“ über die „Methoden der Flucht“ nannte.
Bald fand Vrba einen Verbündeten. Ein Lagerinsasse aus Russland, der große, stämmige Dmitri Volkov, nahm Vrba unter seine Fittiche. Vrba hatte ihm oft seine Brot- und Margarinerationen gegeben, und weil Vrba sich selbst ein wenig Russisch beigebracht hatte, tauschten sich die beiden seit Monaten über bedeutende russische Schriftsteller aus. Dann änderte sich eines Tages ihr Gesprächsgegenstand. Volkov, der selbstbewusste, kluge ehemalige Hauptmann der Roten Armee und nunmehrige Kriegsgefangene, gab Vrba einen Intensivkurs in den Grundlagen einer erfolgreichen Flucht. Volkov erklärte, Vrba werde ein Messer brauchen, um sich zu verteidigen, und eine Rasierklinge, um sich selbst die Kehle aufzuschlitzen, falls er gefasst werde. Um sich den Weg zeitlich einzuteilen, werde er eine Uhr benötigen, die ihm auch als Kompass dienen könne. Und er solle nur nachts unterwegs sein, tagsüber solle er schlafen. Außerdem werde er Salz brauchen, denn mit Salz und Kartoffeln könne er sich „monatelang am Leben halten“. Geld hingegen solle er nie bei sich haben, weil er sonst nur in Versuchung käme, Essen zu kaufen. Stattdessen, sagte Volkov, müsse er sich von Menschen fernhalten. Und er schärfte Vrba ein: „Berausch dich nicht an der Freiheit.“ „Vergiss nie“, sagte Volkov, „dass der eigentliche Kampf erst beginnt, wenn du aus dem Lager heraus bist.“32
Sein vielleicht nützlichster und für Vrba später lebensrettender Ratschlag war, in Benzin getränkten und wieder getrockneten russischen Tabak mitzunehmen und ihn auf dem Körper zu verteilen. Der Geruch, versprach Volkov, werde die Spürhunde in die Irre führen.
Nachdem Volkov mit seinen Lektionen fertig war, sprachen sich die beiden Männer nie wieder. Warum? Wurde Volkov zu einer Gaskammer abtransportiert? Vrba erfuhr es nie.
Im Januar 1944 waren fünf andere Insassen, darunter einer von Vrbas slowakischen Freunden, in die vermeintliche Freiheit gerannt; sie hatte es kaum über Auschwitz hinaus geschafft. Binnen drei Stunden hatte die SS sie brutal ermordet: Sie wurden mit Dumdumgeschossen getötet, die ihr Fleisch in Stücke rissen. Ihre „bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten“ Körper wurden ins Lager geschleift und von der SS auf Stühle gesetzt. Schilder, mit denen man in sadistischer Weise ihre Körper drapierte, verkündeten: „Wir sind wieder da!“33
Alles sah so aus, als wären Vrbas Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber dann freundete er sich mit Charles Unglick an, einem ehemaligen Hauptmann in der französischen Armee, der tapfer in Dünkirchen gekämpft hatte. Unglick war einer jener wenigen in Auschwitz, die unverwüstlich zu sein schienen. Kräftig, unverfroren, „ein richtiger Schurke“, gelang es ihm, beträchtlichen Einfluss im Lager zu erlangen, indem er die Kapos einschüchterte und die SS bestach. Auch das Sonderkommando drangsalierte er. Unglick fand heraus, dass eine der SS-Wachen eine Waise war und von Jiddisch sprechenden Juden aufgezogen worden war. Binnen Kurzem ersann er einen verwegenen Plan, um diesen Wachtposten mit Gold und Diamanten zu bestechen, die er aus „Kanada“ entwendet und in seiner Baracke unter einem Dielenbrett versteckt hatte.34 Dafür würde der SS-Mann sowohl Unglick als auch Vrba herausschmuggeln, und sie würden sich durch die feindlichen Linien nach Paris durchschlagen. Doch warum sollte der Wachtposten das tun? Vrba war misstrauisch. Unglick behauptete steif und fest, der Mann hege heimliche Sympathie für die Juden.
Als Zeitpunkt für ihren Ausbruch setzten sie den 25. Januar 1944, sieben Uhr abends, fest, das war in drei Tagen. Als er an jenem Abend beim Zählappell stand, während der Wind durchs Lager fegte und die Insassen zitterten, konnte Vrba seine Aufregung kaum zügeln. Ungeduldig erwartete er seine Verabredung mit Unglick und dem SS-Posten. Mein letzter Appell, dachte er. Freiheit. Und Hilfe für jene Juden, die sich noch nicht in Auschwitz befanden.
Es wurde sieben Uhr und später. Dann war es 7.05 Uhr. Dann 7.10 Uhr. Dann 7.15 Uhr. Vrba hatte die schreckliche Vorahnung, dass alles schiefgegangen war. Wie das Glück es wollte, wurde er, während er unruhig hin und her lief, aufgefordert, einen seiner „Blockältesten“, einen bekannten slowakischen Intellektuellen, aufzusuchen. Vrba war so nervös, dass er kaum zu denken vermochte. Unsicher suchte er den Blockältesten auf und teilte sich mit ihm eine Schüssel Gulaschsuppe. Kaum war Vrba wieder draußen, rannte ein anderer Blockschreiber auf ihn zu und erklärte, Unglick habe überall nach ihm gesucht und wolle ihn dringend sprechen.
Vrba hetzte zurück zum Treffpunkt, aber da war kein Unglick, kein Lastwagen, kein SS-Wachtposten. Waren sie entkommen? Schließlich sah er in Unglicks Zimmer unter dem lockeren Dielenbrett nach und stellte fest, dass der Sack mit dem Gold und den Diamanten verschwunden war. Ohne Gewissheit zu haben, war ihm klar, dass seine Gelegenheit verstrichen war.
Verstört und enttäuscht kehrte Vrba in seinen Block zurück. Er unterhielt sich fahrig mit anderen Häftlingen, murmelte unverständliches Zeug, bis plötzlich gegen acht Uhr ein gefürchteter Schrei die Nacht durchbrach: „Blockältester 14!“
Teils im Dunkeln, teils im Schein der Lagerlampen stolperte Vrba zum Hof von Block 14. Sein Herz stand still. Dort lag Unglicks Leiche, mit einem Einschussloch in der Brust, und Blut lief ihm über Gesicht und Hals. Vrba war am Boden zerstört. In Auschwitz wurden selten dauerhafte Beziehungen geknüpft; nur Wenige lebten lange genug oder hatten Kraft genug, sie zu pflegen. Aber Vrba hatte Unglick seine Freundschaft geschenkt, hatte mit ihm gescherzt und geträumt.
Wie sich herausstellte, hatte der SS-Mann Unglick die ganze Zeit hintergangen. Dann hatte er sich das Gold und die Diamanten einfach in die eigene Tasche gesteckt, Unglick eine Kugel ins Herz gejagt und der Lagerleitung gemeldet, er habe einen Fluchtversuch vereitelt.
Als Vrba auf Unglicks verdrehten Körper starrte, war er der vollkommenen Verzweiflung nahe. Er hatte das Schicksal überlisten wollen, aber vergeblich. Wie durch ein Wunder hatte er die Selektion überlebt. Wie durch ein Wunder hatte er die Gräuel von Auschwitz überlebt, wo Zigtausende binnen Wochen umkamen. Doch jetzt war ihm seine vermeintlich beste und vielleicht einzige Chance durch die Lappen gegangen. Mit Unglicks Tod starben Vrbas sämtliche Hoffnungen.
Überwältigt von Traurigkeit und schwelender Wut suchte Vrba sich zu fangen, anfangs ohne Erfolg. Bis sich in den kommenden Wochen eine andere Gelegenheit ergeben sollte.
Zu Vrbas Netzwerk in Auschwitz gehörten noch andere Freunde, vor allem einer: Fred Wetzler, der ebenfalls Blockschreiber war und aus derselben Stadt in der Slowakei stammte wie Vrba. Dieser glaubte, dass er Wetzler „bedingungslos“ vertrauen könne. Wie Vrba war auch Wetzler eine Rarität in Auschwitz. Der 25-Jährige war ungeheuer beliebt, selbst bei den Deutschen. Er wusste, wie die Dinge in Auschwitz liefen, und schien sich bestens im Lager auszukennen. Vrba mochte ihn und legte nun sein Leben in Wetzlers Hände.
Wetzlers Fluchtplan war anders als alle anderen. Weil die Nationalsozialisten das Lager erweiterten, um die Flut der Ungarn unterbringen zu können, herrschte mehr Durcheinander als gewöhnlich. Von ein paar slowakischen Landsleuten erfuhr Wetzler von einem großen Stoß Bretter, die im Außenlager aufgestapelt worden waren; dieser Holzstoß war faktisch ein speziell präpariertes Versteck inmitten der gewaltigen Masse an Baumaterial. Im Innern des Stapels war ein Hohlraum, groß genug, um vier Leute aufzunehmen. Der Holzstoß selbst befand sich jenseits der Wachtürme und Starkstromzäune des inneren Lagers. Wenn man sich also darin drei Tage erfolgreich verbarg, würde der Suchtrupp abgezogen. Danach müsste man sich nur noch schleunigst in Sicherheit bringen. Dieser Plan war ebenso wahnsinnig wie genial. Vrba und Wetzler würden sich kühn in Sichtweite des Lagers verstecken.
Zufällig wollten vier andere Slowaken als Erste gehen. Zu Vrbas Freude hatten sie Erfolg. Die SS startete eine fieberhafte Suche, die von Tag zu Tag hektischer wurde. Doch nach drei Tagen waren die Slowaken immer noch nicht entdeckt worden. Vrba und Wetzler beschlossen, noch zwei Wochen zu warten und dann selbst wegzulaufen. Aber sieben Tage später wurden ihre Hoffnungen zunichte gemacht, als die SS mit den übel zugerichteten Flüchtlingen zurückkam. Stumm sah Vrba zu, wie die Männer einer nach dem anderen öffentlich brutal mit Lederpeitschen gefoltert wurden, bevor sie zum weiteren Verhör abgeführt wurden. Es wäre, überlegte Vrba, nur eine Frage der Zeit, bis die SS sie kleinkriegen und von dem wertvollen Versteck erfahren würde.
Aber Vrba und Wetzler wollten sich trotzdem vergewissern.
Vrba gelang es, sich unter einem Vorwand Zutritt zum Strafblock zu verschaffen, wo einer der Häftlinge ihm zuflüsterte, sie hätten die Existenz des Hohlraums nicht verraten.
Konnte man ihnen trauen? Spielte die SS ein raffiniertes Spiel, wie sie es schon so viele Male getan hatte? Vrba und Wetzler beschlossen, dass sie es darauf ankommen lassen mussten.
Das ganze Unternehmen war voller Tücke, aber die Einzelheiten waren schnell geregelt. Vrba hatte Gelegenheit, kurz eine Karte von Oberschlesien zu studieren, und prägte sich eine ungefähre Route für ihre Flucht ein. Sie würden dem Fluss Sola und dann den Bahngleisen folgen, denselben Gleisen, über die Waggon um Waggon voller Juden rollte. Aus den Lagerbeständen von „Kanada“ hatten die beiden Männer feine holländische Tweed-Sakkos und Mäntel entwendet, außerdem schwere Stiefel und einen weißen Wollpullover. Sie fanden den kostbaren russischen Tabak und tränkten ihn sorgfältig in Benzin, bevor sie ihn trockneten. Vrba war es auch gelungen, ein Messer aufzutreiben, das er wegsteckte. Als Rationen würden sie Brot und Margarine besorgen und als Flüssigkeit ein Fläschchen Wein. Von entscheidender Bedeutung war, dass sie außerdem zwei andere Häftlinge, beide Polen, überreden konnten, die Bretter über ihren Köpfen wieder an Ort und Stelle zu schieben, sobald sie ins Innere des Holzstoßes geschlüpft waren. Sie wussten, dass die logistischen Probleme schwierig waren. Sie wussten auch, dass sie Schläue, Glück, tadelloses Timing und Durchhaltevermögen brauchten: Drei Tage lang würden sie Gefahr laufen, von den Hunden entdeckt zu werden.
Als Zeitpunkt setzten sie zunächst den 3. April 1944, zwei Uhr nachmittags, an, aber ihre Absicht wurde durchkreuzt, als in Wetzlers Lager ein misstrauischer SS-Mann vor dem Tor Posten bezog, und Wetzler sich klugerweise weigerte zu gehen.
Am nächsten Tag, dem 4. April, schaltete ein südafrikanischer Pilot in einem amerikanischen Aufklärungsflugzeug, das in 8000 Metern Höhe Auschwitz überflog, seine Kamera ein. Er war vom alliierten Militärflughafen Foggia in Süditalien gestartet und genau nach Norden geflogen. Er suchte nach Bombenzielen. Während er sein Flugzeug über diesen Teil Oberschlesiens steuerte, klickte die Kamera und machte 20 Aufnahmen von dem Zwangsarbeiterlager Monowitz, wo sich die Produktionsstätte der I.G. Farben befand. Vier Kilometer westlich von Monowitz lagen die Gaskammern von Auschwitz. An eben diesem Tag traf in Auschwitz ein Judentransport aus der norditalienischen Stadt Triest ein, die noch von den Deutschen kontrolliert wurde. In den Waggons befanden sich 132 Deportierte, von denen 29 „in die Baracken eingewiesen, registriert und mit Nummern versehen“ und 103 sofort ins Gas geschickt wurden.35
Das Fotografieren dauerte nicht länger als ein paar Minuten. Der unentwickelte Film wurde anschließend an die Auswertungsspezialisten der britischen Royal Air Force in Medmenham an der Themse, westlich von London, geschickt, die ihn entwickelten und die körnigen Bilder studierten. Sie suchten nach spezifischen Industrieanlagen, die bombardiert werden konnten. Aber als sie die Fotografien analysierten, entdeckten sie, dass drei der Bilder nicht die Fabrikzone von Monowitz, sondern Reihen von Baracken zeigten. Dies waren die ersten bekannten Fotografien des Lagers Auschwitz.36
Weitere vier Tage lang probierten es Vrba und Wetzler vergeblich. Jedes Mal wurde ihre Absicht durchkreuzt, weil plötzlich etwas schiefging: Ein Komplize wurde aufgehalten, oder es gab eine Verzögerung. Hatte die SS Verdacht geschöpft? Vrba und Wetzler konnten es nicht wissen.
Schließlich beschlossen sie, den Ausbruch am 7. April zu wagen. An diesem Morgen erledigten sie ihre routinemäßigen Arbeiten, als ob alles normal wäre. Aber am frühen Nachmittag machte sich Vrba erneut zu dem Holzstoß auf. Überall wurde gehämmert und gebaut, geschwitzt und geflucht, allerorten herrschte Chaos. Innerlich zitternd vor Angst, fand sich Vrba plötzlich zwischen zwei SS-Männern wieder, die er noch nie gesehen hatte. Sie fingen an, sich über seine Kleidung zu mokieren, nannten ihn eine „Schneiderpuppe“. Als Blockschreiber war Vrba fürwahr eine Ausnahme in Auschwitz, weil er „in punkto Garderobe beträchtliche Freiheit besaß“. Trotzdem hatten diese Wachen etwas gegen seinen Mantel und fingen von oben herab an, seine Manteltaschen zu durchstöbern, wobei sie eine Handvoll loser Zigaretten fanden. Vrba erstarrte. War sein Plan vereitelt worden, noch bevor er umgesetzt wurde? Er hatte Mühe, Haltung zu bewahren, und fing heftig zu schwitzen an. Er wusste, wenn sie seinen Mantel öffneten, würden sie den Anzug darunter sehen. Eine gründlichere Suche würde die Uhr zutage fördern, die er für die Reise gestohlen hatte; sie befand sich in diesem Moment unter seinem Hemd und drückte gefährlich gegen seine Haut. Allein wenn die Uhr gefunden wurde, würde man ihn mit Sicherheit wegen „Fluchtversuchs“ exekutieren. Doch dann waren da auch noch die Streichhölzer und das Messer, die er versteckt hatte. Ein paar abgerissene Knöpfe, und alles wäre verloren.
Aber die Deutschen durchsuchten lediglich seine Taschen und ließen seinen Mantel zugeknöpft. Stattdessen fingen sie an, ihn auszulachen, ihn zu verspotten, und einer schlug ihm mit einem dicken Bambusstock gegen die Schulter. Vrba „wankte ein wenig“, und „in [s]einem Kopf schwirrte alles durcheinander“. Mit einem höhnischen Lächeln traten die Deutschen einen Schritt zurück, um ihn weiter zu überprüfen. Sie sagten Vrba, es sei an der Zeit, dass er das Innere von Block 11 kennenlerne, wohin Häftlinge zur Bestrafung gebracht wurden. Dann schlug einer der SS-Männer ihm unvermittelt voll ins Gesicht und schrie ihn an: „Los, du Schwein, beweg dich! Geh mir aus den Augen!“ Zu perplex, um nachzudenken, und kaum imstande zu sprechen, wartete Vrba, was sie als nächstes tun würden. Dann befanden die beiden SS-Männer genauso schnell, dass sie keine Lust auf den Abstecher zum Block 11 hatten. Stattdessen wollten sie Vrba der Politischen Abteilung melden, die ihn nach dem abendlichen Zählappell abholen sollte.
Vrba war jetzt ein gesuchter Mann, dem nur Stunden blieben, bevor man ihn aus dem Verkehr zöge.
Er hetzte folgsam zurück zum Tor seines Abschnitts, machte aber, sobald er außer Sichtweite war, abermals kehrt, in Richtung Holzstoß. Während er versuchte, „wie beiläufig“ zu schlendern, sah er sie alle dort warten. Die Polen standen oben und arbeiteten; Wetzler stand unten. Sie sperrten Mund und Nase auf, aber ansonsten herrschte Schweigen; keiner sagte ein Wort oder gab sonst einen Laut von sich. Sie machten nun sehr schnell, da ihnen nur Sekunden blieben, um ihr Täuschungsmanöver zu vollenden. Die Polen schoben die Bretter beiseite „und nickten uns beinahe unmerklich zu“. Vrba und Wetzler zögerten einen Moment, dann kletterten sie schnell auf den Stapel, steckten zunächst die Beine in die Öffnung und ließen sich dann in den Hohlraum hinab. Sie hörten, wie die Planken über ihren Köpfen wieder an Ort und Stelle gerückt wurden, und dann das Geräusch von Füßen, als die Polen vom Holzstoß kletterten.
Drinnen war es stockfinster. Die Luft war stickig. Die beiden Männer waren gezwungen, dazuhocken wie Vögel, in einer unbequemen, verkrampften Haltung. Etwa eine Viertelstunde lang rührten Vrba und Wetzler keinen Muskel und sprachen kein Wort.
Das Einzige, was sie vernahmen, war ihr eigener rasselnder Atem.
Eine gute Viertelstunde verging, und noch brach draußen kein Tumult los. Dann machte sich Vrba an die Arbeit. Um die Hunde auszutricksen, füllte er die engen Zwischenräume zwischen den Brettern mit dem pulverigen russischen Tabak-Benzin-Gemisch. Es kostete ihn fast eine Stunde mühseliger Arbeit. Als er fertig war, saßen Vrba und Wetzler allein mit ihren Gedanken da. Es war erst halb vier Uhr nachmittags. Die Stunde der Wahrheit würde um 17.30 Uhr anbrechen, wenn der Abendappell begann und die Häftlinge Aufstellung nahmen. Vrba war zugleich ängstlich und aufgeregt. Nervös fingerte er ständig an seiner Uhr herum, sah, inzwischen an das Dunkel gewöhnt, nach, wie spät es war, und hielt sie sich ans Ohr, um sich zu vergewissern, dass sie nicht stehen geblieben war. Schließlich zwang er sich, die Uhr wegzulegen. Im Holzstoß brauchten weder er noch Wetzler sie. Beide Männer konnten einfach aus den Geräuschen, die von draußen hereindrangen, auf die Uhrzeit schließen. Die Abläufe im Lager waren immer die gleichen. Und tatsächlich hörten sie dann auch, zusammengekrümmt in der Finsternis, die Marschtritte der Stiefel, als die Häftlinge von der Arbeit zurückkehrten und sich zum Appell aufstellten.
Um 17.25 Uhr war Vrba überzeugt davon, die SS wüsste bereits, dass sie verschwunden waren, und überlegte, wie sie reagieren sollte. Um 17.30 Uhr bekam er Herzrasen. Aus irgendeinem Grund hatte niemand den Alarm ausgelöst. Um 17.45 Uhr war es immer noch unheimlich ruhig. Vrba rechnete damit, dass sie jeden Moment das Geräusch der zur Seite geschobenen Bretter vernehmen und in die Läufe von Maschinenpistolen blicken würden. Um 18 Uhr war immer noch keine Sirene ertönt.
„Sie spielen mit uns“, flüsterte Vrba. „Sie wissen garantiert, wo wir sind.“37 Wetzler hatte zu viel Angst, um auch nur ein Wort zu erwidern, aber er nickte zustimmend.
Dann zerriss plötzlich ein schriller Laut die Stille – das Heulen der Sirene.
Nach wenigen Minuten, während sich das Zwielicht der Abenddämmerung über das Lager senkte, konnten Vrba und Wetzler das Stampfen von SS-Stiefeln hören, derweil ihre Verfolger überall im Lager Position bezogen. Die Zwinger wurden geöffnet, und die 200 speziell abgerichteten Hunde fingen an, unter wildem Gebell das Gelände von Auschwitz-Birkenau zu durchkämmen. Es war eine eindrucksvolle Machtdemonstration vonseiten der Deutschen. Sie krochen in jeden Winkel des Lagers und waren überall zwischen den Hunderten von niedrigen, einstöckigen Baracken. Tausende von Männern schlugen jetzt Türen ein, hoben Dielenbretter hoch und rannten von einem Gebäude zum nächsten. Vrba wusste, was das bedeutete: Alle Baracken würden unverzüglich durchsucht. In jedem Gebäude und in jeder Einrichtung auf dem Lagergelände, von den Latrinen bis zu „Kanada“, würde drei Tage lang das Unterste zuoberst gekehrt. Jeder Häftling würde überprüft, immer wieder, stundenlang, und viele würden brutal gefoltert.
Vrba und Wetzler packte abwechselnd freudige Erregung beim Gedanken an einen möglichen Erfolg und panische Angst bei der Aussicht, gefasst zu werden. Letztere sollte sich noch steigern.
Anfangs waren die Deutschen noch weit weg – Auschwitz war ein riesiger, ausgedehnter Komplex –, aber sie kamen bald näher. Plötzlich hörten die beiden Männer einen SS-Offizier brüllen: „Hinter den Brettern! Ihr sollt hier gefälligst alles durchsuchen, nicht frische Luft schnappen!“ Vrba und Wetzler erstarrten, als sie hörten, wie die Deutschen auf ihren Holzstoß kletterten. Als grober Sand herabrieselte, hielten die beiden Männer sich die Hände vor die Nasen, aus Angst, niesen zu müssen. Das Fangnetz zog sich zusammen, so wie sie es erwartet hatten. Zusätzlich zum heiseren Keuchen der Wachen konnten sie jetzt das Hecheln und hektische Schnüffeln der Hunde und das Kratzen ihrer Krallen hören, als sie direkt über ihren Köpfen von Brett zu Brett rutschten. Himmler selbst hatte einmal damit geprahlt, dass die Hunde von Auschwitz darauf abgerichtet worden seien, einen Menschen „zu zerreißen“.38
Selbst durch die Dunkelheit konnte Vrba erkennen, „dass auch Fred bereit war, die Zähne zusammengebissen, das Gesicht vor Anspannung zu einem Lächeln verzerrt“.39 Wie es aussah, verließ sie ihr Glück. Vrba packte sein Messer fester. Er hatte geschworen, sich ihnen nicht lebend zu überlassen.
Doch die SS-Männer hörten nichts, und die Hunde rochen nichts. Das russische Benzin-Tabak-Gemisch hatte funktioniert, und niemand war auf die Idee gekommen, die Bretter beiseite zu schieben. Die Hunde jagten davon und folgten den vielen Gerüchen zu einem anderen Abschnitt des Lagers. Ihnen hinterher liefen die Wachen, bis die Suche kaum mehr war als ein fernes Geräusch. Es war ein Triumph für Vrba und Wetzler. Aber sie wussten, dies war nur der Anfang gewesen.
Die ganze Nacht setzten Männer und Hunde die Suche fort und strichen dabei immer wieder um den Holzstapel herum. Wie Wetzler sich erinnerte, banden er und Vrba sich, um ihre eigenen Geräusche zu dämpfen, Flanellstreifen um den Mund und zogen sie fest, sobald einer von ihnen ein Kribbeln im Hals verspürte.
Und dann hörten sie ein anderes, vertrauteres qualvolles Geräusch: das Dröhnen und Rattern der Lastwagen, die neue Opfer zu den Gaskammern transportierten. Vrba zählte im Geiste mit. Erst waren es zehn, dann zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig. Sogar inmitten dieser intensiven Suche ging das Geschäft des Todes in Auschwitz unvermindert weiter. Vrba und Wetzler „dachten daran, wie die Menschen ruhig und geordnet in die ‚Duschen’ gingen“; und sie konnten sich die herzzerreißenden Schreie und das Wimmern der Juden vorstellen. Dann hörten sie nichts mehr bis auf das „monotone, unheimliche Geräusch“ der toten Leiber, die einer nach dem anderen in die Öfen geschoben wurden.40 Wie der Zufall es wollte, lag ihr Versteck in unmittelbarer Nähe von Krematorium IV.
Stunde um Stunde lauschten sie, wie das Sonderkommando die eisernen Türen des Krematoriums öffnete und die bereits geschrumpften und deformierten Körper in die Flammen schob, wo sie zu Asche zerfielen. Stunde um Stunde rochen sie verbrennendes Fleisch und brennendes Haar. Dies war ein Transport belgischer Juden gewesen; 319 Menschen, darunter 54 Kinder, waren unmittelbar nach ihrer Ankunft vergast worden.
Der zweite Tag war schlimmer. Die Suchtrupps waren verzweifelter, und Vrba und Wetzler hatten noch mehr Angst. Sie hatten seit mehr als 24 Stunden weder gegessen noch getrunken. Sie waren verdreckt, unrasiert und erschöpft. Alle paar Minuten nickten sie kurz ein, nur um von weiteren Jagdgeräuschen abrupt in die Realität zurückgeholt zu werden. Auch vernahmen sie jetzt neue Laute: erregt gerufene Losungsworte; die Schritte der Wachen, die um den äußeren Ring patrouillierten; von Offizieren geblaffte Befehle, hier zu suchen und dort zu suchen.
Gegen zwei Uhr am Nachmittag des dritten Tages, den die Männer im Holzstoß verbrachten, ließ die Intensität der Suche endlich nach: Während sie angestrengt lauschten, hörten Vrba und Wetzler, wie draußen zwei Deutsche Gerüchte über den Verbleib der Flüchtlinge austauschten. Diese Männer waren überzeugt davon, dass sie nicht schon Kilometer entfernt, sondern noch im Lager waren und den rechten Augenblick abwarteten. Einer der Männer blickte offensichtlich herüber zum Holzstoß.
„Meinst du, sie verstecken sich da irgendwo drin?“, fragte der eine seinen Begleiter.
Der andere Mann, der wahrscheinlich den Kopf schüttelte, sagte, die Hunde hätten sie mit Sicherheit gerochen, gab aber zu bedenken: „Es sei denn natürlich, sie haben es irgendwie geschafft, den Geruch zu überdecken.“
„Es ist zwar ziemlich unwahrscheinlich … aber einen Versuch wert“, kam die Antwort des ersten Mannes.41
Die beiden Männer kletterten auf den Stapel und fingen an, die Bretter wegzuziehen. Vrba und Wetzler hatten ein abscheuliches Gefühl des Déjà-vu – das hier war genau wie am ersten Tag. Erneut zückten sie ihre Messer. Vrba hielt den Atem an und drückte sich mit dem Rücken gegen die Wand des Hohlraums, als könnte er so irgendwie verschwinden. Die Deutschen waren jetzt nur noch Zentimeter davon entfernt, ihre Jagdbeute zu finden. Doch kurz bevor das nächste Brett entfernt werden konnte, kam ein ungeheurer Lärm von der anderen Seite des Lagers. Die Deutschen rannten in Richtung des Tumults davon, wahrscheinlich im Glauben, die Flüchtlinge seien gefasst worden. Doch die hockten nach wie vor sicher in ihrem Holzstoß.
Für Vrba und Wetzler, die in ihrem Versteck nur noch wenige Stunden von der möglichen Freiheit trennten, war der 9. April ein Tag der Stille. Aber es war alles andere als ruhig in Auschwitz. Wie an allen anderen Tagen rumpelten auch an diesem wieder die Lastwagen mit den Opfern, die vergast und anschließend verbrannt werden sollten, die Straße hoch. Ausgerechnet heute transportierten sie jene Juden, die im Konzentrationslager Lublin-Majdanek interniert gewesen waren,42 wo Vrba vor seiner Deportation nach Auschwitz zwei Wochen verbracht hatte. Angesichts des Vorstoßes der rachedurstigen Roten Armee nach Westen hatte die SS das Lager überhastet geräumt und schickte sich an, es aufzugeben. In einem letzten Triumph nationalsozialistischer Niedertracht verplombten die Deutschen sogar dann noch beharrlich die hölzernen Viehwaggons voller Evakuierter, als sie schon ihre eigenen Dokumente vernichteten und das Lager auflösten. In einem vergeblichen Versuch, ihre Verbrechen zu verschleiern, exhumierten und verbrannten sie außerdem die Überreste von etwa 18.000 Leichen, die im Wald verscharrt worden waren.43 Die Zehntausende von Schuhen anderer Opfer hatten sie nicht beseitigen können. Diese Schuhe türmten sich zu Haufen, wie aufgeschüttetes Getreide. Viele Babyschuhe waren darunter, so klein, dass zwei davon problemlos in der Handfläche eines erwachsenen Mannes Platz fanden.
Acht Tage lang war der Zug von Majdanek schrill pfeifend über abgefahrene Gleise nach Westen gekrochen. Für die Häftlinge war die Fahrt eine Tortur. Ohne Wasser und medizinische Versorgung machten sich die ausgemergelten und glatzköpfigen Evakuierten, die kaum mehr als Fetzen am Leib trugen, keine Illusionen. Aber diesmal wehrten sich einige. Bei einem Zwischenhalt auf einem Bahnhof entlang der Strecke gelang es 20 von ihnen, durch ein in den Waggonboden geschnittenes Loch ins Freie zu schlüpfen und einen Fluchtversuch zu unternehmen. Die SS erschoss alle 20. Von den übrigen Evakuierten waren 99 bei der Ankunft in Auschwitz tot; inmitten des ekelerregenden Gestanks von Schweiß und Abfall waren sie einfach unterwegs gestorben. Und die Überlebenden? Sie waren schwach, erschöpft, manche beinahe außerstande, sich zu bewegen. Bei der Ankunft erging es ihnen wie allen anderen.
Aber es waren nicht bloß diese Geräusche des Todes, welche die Luft erfüllten. Am frühen Abend hörten Vrba und Wetzler ein entferntes Brummen am Himmel. Aus dem Brummen wurde ein Dröhnen, das Geräusch schwerer Flugzeuge, das näher kam. Kurz darauf war eine Serie von Pfeiftönen zu hören. Der Holzstoß erbebte, während das Gelände von Explosionen gesprenkelt wurde. Vrba und Wetzler hielten den Atem an. War das Lager endlich entdeckt worden? Würden die Alliierten endlich die Wachtürme und die Elektrozäune bombardieren? „War das“, fragten sie sich, „das Ende von Auschwitz?“ Für einen flüchtigen Moment hegte Vrba die irrwitzige Vorstellung, dass sie soeben befreit wurden. Die Explosionen wurden mit abgehackten Flakfeuersalven beantwortet; es waren Geschütze aus dem Lager, die wild in den Himmel feuerten. Der Holzstoß zitterte, grober Sand rieselte herab, und strahlende Blitze tauchten die Fluchthöhle in ein hartes, gleißendes Licht. Aber Auschwitz selbst wurde nicht angegriffen; es waren die mehrere Kilometer entfernten industriellen Ziele, die von den alliierten Bomben beharkt wurden. Das Lager blieb unangetastet, und nachdem der Lärm der Flugzeuge verebbt war, hörten Vrba und Wetzler erneut das Klirren der Roste und rochen das brennende Fleisch aus den Krematorien.
Den 10. April verbrachten sie schweigend. Um kurz vor halb sieben Uhr abends, drei Tage nachdem die erste Sirene ertönt war, hörten sie Rufe, die von Wachturm zu Wachturm gebrüllt wurden und sich rings um das Lager fortpflanzten: „Postenkette abziehen!“ Das war der Befehl, mit dem die interne Suche in Auschwitz abgebrochen wurde. Die Wachen würden auf ihre Posten und in ihre Unterkünfte zurückkehren, die Hunde würden wieder in ihre Zwinger gesperrt. Die Suche war vorbei. Jetzt war es an dem Netzwerk der SS außerhalb der Mauern von Auschwitz, die Flüchtlinge zu fangen.
Bereits am 9. April hatte SS-Obersturmbannführer Friedrich Hartjenstein ein Telegramm mit der Nachricht vom Ausbruch an das Berliner Büro der Gestapo geschickt.44 Sämtliche Gestapo-Einheiten im Osten, sämtliche Einheiten der Kriminalpolizei und sämtliche Grenzposten sollten nach zwei Juden Ausschau halten. Mit derselben brutalen Effizienz, mit der sie bei der Verwaltung des Lagers zu Werke gingen, kabelten die Nationalsozialisten Berichte und streckten ihre Fühler aus. Im Falle der Gefangennahme sei ein „ausführliche[r] Bericht“45 an Auschwitz zu übermitteln.
Im Innern des Holzstapels wagten Vrba und Wetzler nicht, sich zu rühren, aus Angst, das Ende der Suche könnte nur vorgetäuscht sein, um sie aus ihrem Versteck zu locken. Sie zitterten in der kühlen Abendluft – und warteten.
Bis neun Uhr hörten die beiden Männer keine ungewöhnlichen Geräusche, nichts, was darauf hindeutete, dass irgendjemand dachte, sie befänden sich noch innerhalb von Auschwitz. Nachdem sie tagelang zusammengekauert in Schmutz und Dunkelheit ausgeharrt hatten, erhoben sie sich nun steif und fingen an, gegen die noch verbliebenen Holzbretter ihres „Dachs“ zu drücken. Sie drückten und pressten, aber die Bretter rührten sich nicht. „Ächzend und schwitzend mobilisierten wir das letzte Quäntchen Kraft, das wir noch hatten“, und allmählich gelang es ihnen, die Bretter ein paar Zentimeter anzuheben und mit den Fingern die rauen Kanten zu packen. Schließlich wuchteten sie das Holz beiseite und sahen „plötzlich am schwarzen mondlosen, noch winterlichen Himmel Sterne“.46
Hätten die beiden Deutschen nicht begonnen, den Holzstoß zu überprüfen, und einige der Bretter bewegt, hätten Vrba und Wetzler jetzt möglicherweise vollends in der Falle gesessen, ohne Chance herauszukommen.
Vorsichtig schoben die beiden Männer die Bretter wieder an ihren Platz, hockten sich dann oben auf den Holzstoß „und betrachteten das innere Lager, das wir – dieser Entschluss stand für uns fest – nie wiedersehen würden“.47 Für einen flüchtigen Augenblick sah Vrba Auschwitz noch einmal von außen – so wie es Hunderttausende Opfer bei der Ankunft sahen. Als er von dem flachen Land emporblickte, sah er die hellen Lampen, die das Lager umgaben und deren schimmernder Schein die Dunkelheit durchbrach. Er sah die gefürchteten Umrisse der Wachtürme, die drohend in den Himmel ragten. Und er wusste, dass hinter dem Draht und den Mauern, hinter dieser Lichterkette ein Massenmord stattfand, dessen Ausmaß beispiellos in der Geschichte war.
Vrba und Wetzler kletterten vom Holzstapel, legten sich flach auf den Bauch und begannen langsam auf einen kleinen Birkenwald zuzukriechen. Sobald sie dort waren, rannten sie in gebückter Haltung los und blickten sich kein einziges Mal um.