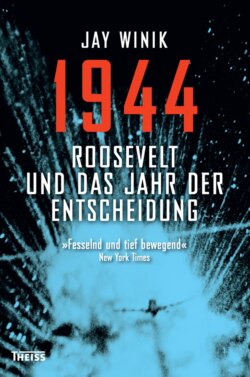Читать книгу 1944 - Jay Winik - Страница 11
Kapitel 2 „Ich möchte immer nur schlafen – zwölf Stunden am Tag“
ОглавлениеSchon 1940 hatte ein triumphierender Hitler zu Hermann Göring gesagt: „Der Krieg ist zu Ende.“
Nun, nach dem Teheraner Gipfel und zu Beginn des Jahres 1944, verzeichneten die Nationalsozialisten immer mäßigere Erfolge, und für die Alliierten schien der Weg zum Sieg klar erkennbar zu sein, doch vorüber war der Krieg noch immer keineswegs, und sein Ergebnis war nicht mit Sicherheit abzusehen. Am 3. Januar startete die britische Royal Air Force einen weiteren Großangriff auf Berlin. Diesmal jedoch waren die Schäden in der Stadt minimal, während die RAF 27 Flugzeuge und 168 Besatzungsmitglieder verlor. Die monatliche Verlustrate britischer Flugzeuge lag bei zehn Prozent. Und in Italien, der einzigen aktiven Front im Westen, waren die Alliierten an der scheinbar unüberwindlichen „Gustav“-Linie stecken geblieben. Doch obschon er einräumte: „wir [haben] noch einen sehr langen Weg zurückzulegen“, blickte Franklin D. Roosevelt optimistisch in die Zukunft.1
Getrieben von einer Überzeugung, die zu verstehen der Geschichte selbst heute noch schwerfällt, hatte Roosevelt mitgeholfen, aus der Verzweiflung im Ausland eine Allianz zu schmieden; hatte den Isolationismus im eigenen Land überwunden; in finstersten Tagen einen demokratischen Geist entfacht; und war zum Führer der freien Menschen überall auf der Welt geworden. Hitler mag ihn verhöhnt haben, aber ein empfindsamer Winston Churchill wusste es besser, als er Roosevelt einmal als „den großartigsten Menschen, den [er] je kennengelernt habe“, bezeichnete. Dem pflichtete der legendäre Journalist Edward E. Murrow bei, der berichtete, dass für die Männer, die in diesem Krieg kämpften oder sich für den Kampf rüsteten, „der Name ‚Roosevelt’ ein Symbol [sei], das Codewort für eine Menge Jungs namens ‚Joe’, die irgendwo da draußen mit Panzertruppen auf dem Weg nach Osten [seien]“.2
Doch nichts an diesem Krieg sollte leicht sein, nicht am Anfang, nicht in der Mitte und nicht am Ende. In Wirklichkeit waren die englischsprachigen alliierten Verbände, als Murrow diese Worte sprach, noch gar nicht Richtung Osten unterwegs; sie steckten noch mitten in der Invasion Italiens und bahnten sich mühsam einen Weg nach Norden. Der Vormarsch ging brutal langsam vonstatten. Es war die reine Hölle für die Soldaten:3 Dörfer mussten Haus für Haus erobert werden, während die Deutschen sich entlang der Küstenlinie in undurchdringlichen Gebirgsstellungen eingruben und die alliierten Soldaten einen nach dem anderen ins Visier nahmen. Inmitten der wogenden Wolken aus dichtem wabernden Rauch, der Feuerstöße der Mörser und des donnernden Getöses explodierender Granaten witzelte ein Soldat treffend und in Anlehnung an Shakespeares Richard III, dies sei der „Winter des Missvergnügens“. Für die durchnässten und fröstelnden GIs waren der Schlamm, der Dreck, der Schneeregen und die Täler genauso unversöhnliche Feinde wie die Nationalsozialisten. Scheußliche Unwetter verwandelten Straßen aus Lehm in Sturzbäche; und sämtliche Vorstöße der Alliierten blieben stecken, weil sich die Truppen in den deutschen Linien verkeilten. Jeeps kamen in den Sümpfen nicht voran, und Panzer waren praktisch vollkommen nutzlos. Der Nachschub wurde mit Maultieren herangeschafft, die sich manchmal über Leichen hinweg einen Weg suchen mussten, ungefähr so wie im Ersten Weltkrieg an der Westfront. Und wohin die alliierten Soldaten sich auch wandten, stets schlug ihnen beißende Kälte und heulender Wind entgegen.
Das Elend der Männer, die ungeschützt auf scharfkantigen Felsvorsprüngen hockten, war in der Tat erbarmungswürdig. Fußbrand war genauso wie Frostbeulen weit verbreitet in den feuchten, kalten Schützenlöchern. Gepeitscht von schweren Unwettern, standen die Soldaten oft bis zu den Oberschenkeln im Regenwasser. Wenn das Schießen für einen Moment nachließ und die Männer die Köpfe heben konnten, sahen sie aasfressende Hunde, die sich an den Gedärmen toter GIs gütlich taten. Nachts hörten sie die Schreie der Verwundeten, die sich wegen des alles niedermähenden Maschinengewehrfeuers nicht rühren konnten und außer Reichweite ihrer Kameraden ihrem Schicksal ausgeliefert waren. Während die Stunden verstrichen, wurden die Schreie schwächer und vereinzelter, aber immer verzweifelter. Die deutschen Verteidigungsstellungen schienen überall und nirgends zu sein, obwohl amerikanische Flugzeuge mit heulenden Motoren pausenlos die deutschen Außenposten und Nachschublinien beharkten. Wie vorauszusehen, sank die Moral, und die alliierten Opferzahlen stiegen. Isoliert in ihren zerklüfteten Schluchten und Hohlwegen, eingeschlossen in Drahtverhauen, umgeben von feindlichen Minen oder gebeutelt vom ständigen Pop! Pop! Pop! des feindlichen Artilleriefeuers, wurden die Männer bis an die Grenzen menschlichen Durchhaltevermögens getrieben. Viele von ihnen brachen unter Kriegsneurosen zusammen, andere vor lauter Erschöpfung, oder sie verloren gänzlich den Verstand. Manche nässten sich spontan ein wegen der unablässigen Anspannung und Belastung. Als die Wochen und Monate sich dahinschleppten, tauften die GIs diesen Teil des Gebiets, das einst die Keimzelle des Römischen Reiches gewesen war, „Purple Heart Valley“, nach der einzigen Verwundetenauszeichnung der amerikanischen Streitkräfte.4
Dennoch wuchs mit dem Herannahen des Frühlings Roosevelts Überzeugung, dass die Alliierten die Pattsituation in Kürze durchbrechen würden. Er hoffte sogar, dass der bevorstehende Fall Roms den Beginn einer sehr viel umfassenderen Operation einläuten würde, der lang erwarteten Invasion über den Kanal, die „Operation Overlord“.
Dieser Angriff über den tückischen Ärmelkanal sollte die größte amphibische Invasion in der Geschichte und der entscheidende Schlag des Krieges werden.5 Weitab von der alliierten Gipfelpolitik, waren militärische Planer den größten Teil des Jahres mit den Vorbereitungen auf den D-Day beschäftigt gewesen. Jetzt, wo Dwight D. Eisenhower das Heft in der Hand hielt, würde die Operation sehr viel konkretere Formen annehmen. Und das war auch dringend notwendig. Die einzige brauchbare westliche Route ins Innere Deutschlands führte durch Frankreich, und das Überraschungsmoment war entscheidend. Hitler wusste, dass die Invasion erfolgen würde, aber er wusste nicht, wo. Noch immer konnten die Deutschen 55 Divisionen ins Feld führen – darunter elf Panzerdivisionen –, während Roosevelt am ersten Tag nur acht eigene Divisionen an Land bringen konnte. Die schiere Größenordnung von „Overlord“ war also erstaunlich und jedes operative Detail entscheidend. Beteiligt sollten anfangs 180.000 GIs sein, die mit mehr als 5000 Schiffen und 1000 Transportflugzeugen befördert wurden, von elf Häfen aufbrechen und an nur fünf Landeköpfen zusammenkommen würden. Alle diese Männer warteten nun atemlos auf das Signal – „Okay, auf geht’s!“
Wesentlich für die Invasion war der Ort, an dem sie stattfand: die Normandie, ein beeindruckender Küstenstrich ohne Häfen, begrenzt von zwei Flüssen und breiten Streifen Ackerland. Mittels Tausender von Aufklärungsflügen über den Küstengewässern hatten die Alliierten sich seit Monaten bemüht, feindliche Bunker und schwere Artillerie auszumachen, während Kleinstunterseeboote vor den französischen Stränden patrouillierten und versuchten, deutsche Verteidigungsstellungen auszukundschaften. Unterdessen hatten Roosevelt und die Alliierten eine raffinierte List ersonnen, um die Deutschen zu verwirren. Sich des Know-hows der amerikanischen Filmindustrie bedienend, kreierte die Spionageabwehr praktisch eine Scheinarmee unter dem Kommando des berühmten Generals George S. Patton. Eine Phantomstreitmacht aus erstaunlich realistischen Attrappen von Panzern, Flugzeugen, Artilleriegeschützen und anderem Kriegsgerät sowie maßstabsgetreu angefertigten Landungsbooten aus Holz und Gummi sollte die Deutschen glauben machen, dass die Alliierten sich zu einem Generalangriff auf die französische Küste im Départment Pas-de-Calais und nicht in der Normandie rüsteten. Sogar ein entsprechender Funkverkehr wurde simuliert, und Meldungen über erfundene sportliche Begegnungen zwischen fiktiven Einheiten wurden abgesetzt, sodass die meisten der Generäle Hitlers tatsächlich von einer bevorstehenden Invasion im Pas-de-Calais überzeugt waren. Währenddessen sammelte sich unbemerkt anderswo im Vereinigten Königreich die echte Invasionsstreitmacht.
Es war eine beispiellose militärische Karawane: Zehntausende getarnter Panzer – Schwimmpanzer, Dreschflegelpanzer – sowie Lastwagen, Jeeps, Geschütze, Gleitsegler, Schreibmaschinen, Medikamente, Mustang-Kampflugzeuge und Lokomotiven („Hunderte“) wurden in Erwartung des kommenden verheerenden Zusammenstoßes still und heimlich über Kilometer in Südengland am Straßenrand aufgestellt. Derweil führten Hundertausende von Männern, aufs Äußerste gespannt und abgeschottet vom Rest der Welt, Giftgasübungen durch, gruben Schützenlöcher, wurden in Demontage und im Durchtrennen von Leitungen ausgebildet und brüteten über detaillierten Karten und Fotografien feindlicher Befestigungsanlagen. Bis Anfang Juni sollte sich ihre Zahl auf fast drei Millionen belaufen. Sie erhielten reichlich vom sogenannten Invasionsgeld, glänzende Drahtscheren und Seitenschneider, Gasmasken, neue Zahnbürsten, frische Zigaretten, Tabletten gegen Seekrankheit, Extrasocken und natürlich Extramunition. Es dürfte niemanden überraschen, dass französische Reiseführer und Kondome besonders begehrt waren.
Zur selben Zeit wurden 15 Lazarettschiffe für die Unterbringung von 8000 Ärzten vorbereitet; an Bord genommen wurden 57.000 Liter Blutplasma, 600.000 Dosen Penizillin und 50.000 Kilogramm Sulfonamide. Etwa 124.000 Krankenhausbetten wurden bereitgehalten. In ruhigeren Momenten schlossen die GIs die Augen, bekreuzigten sich und senkten die Köpfe zum Gebet, denn sie wussten, was bevorstand.6 Aber ruhig war es selten.
Jede Nacht rumpelten Stunde um Stunde kilometerlange Konvois über die Straßen Südenglands. Und angesichts der endlosen Reihen von Bürogebäuden und Lagerhäusern, der ausgedehnten Unterkünfte und der unzähligen Hafenarbeiter, die Versorgungsgüter und Verpflegung stapelten – 100.000 Päckchen Kaugummi, 12.500 Pfund Kekse, 6200 Pfund Süßigkeiten, Reservereifen ohne Ende, gewaltige Kabeltrommeln und Zehntausende Räder und Holzkisten –, wäre es ein Leichtes gewesen, das militärische Nervenzentrum dieser stetig wachsenden Armada mit einer riesigen Handelsmetropole zu verwechseln. Die Logistik von „Overlord“ war in der Tat atemberaubend. Es war, als planten die Alliierten die gesamte Bevölkerung von Boston, Baltimore und Staten Island – jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, jedes Auto und jeden Lieferwagen – in völliger Dunkelheit über 180 Kilometer bewegte See in lediglich zwölf Stunden überzusetzen.
Der Befehlsstand für diesen Großangriff befand sich in einem harmlos aussehenden Wohnwagen unweit der Werft von Portsmouth. In dessen Inneren fielen auf einem schlichten hölzernen Schreibtisch lediglich ein rotes Telefon – dieser Apparat übermittelte verschlüsselte Anrufe an Roosevelt und das Kriegsministerium in Washington – und ein grünes Telefon auf, das eine direkte Verbindung zu Churchill in 10 Downing Street war.7
Im Spätfrühjahr war alles in Bereitschaft. Das Einzige, was jetzt noch ausstand, war der Angriffsbefehl von jenem Mann im Wohnwagen, von General Eisenhower. Er, Roosevelt und die Alliierten hatten keinen echten Plan B für den Fall, dass die Invasion scheitern sollte. Wie der General es ausdrückte: „Wir können es uns nicht leisten zu scheitern.“8 „Overlord“ bedeutete daher alles oder nichts.
Zur selben Zeit schritt auf der anderen Seite des Ärmelkanals Generalfeldmarschall Erwin Rommel auf und ab, einer von Hitlers gescheitesten und wagemutigsten Generälen, der bereits in Ägypten gegen die Alliierten gekämpft hatte, am Ende aber schlecht weggekommen war. Nun hatte Rommel in Frankreich den uneingeschränkten Oberbefehl inne und war der Ansicht, Deutschlands Chance wäre am größten, wenn es gelänge, die alliierten Streitkräfte an Ort und Stelle zu stoppen – an den Stränden.9 Und genau dazu war er entschlossen. Ein halbes Jahr lang hatten etwa 500.000 Deutsche in Erwartung der Alliierten akribisch massive Bunker und tödliche Hindernisse gebaut. Es war die Elite der Wehrmacht, die fortan jederzeit Rommels Befehle erwartete – es waren jene Männer, die in die Tschechoslowakei einmarschiert waren, die den Polen dreist einen Schock versetzt hatten, die Norwegen und Belgien überrannt und ein wie vor den Kopf gestoßenes Frankreich ausmanövriert hatten und die, um das Maß voll zu machen, die Jugoslawen und die Griechen überlistet hatten. Welche Zweifel Rommel auch insgeheim hinsichtlich einer alliierten Invasion hegen mochte, er wusste, dass jeder Meter verlustreich vom Feind errungen werden musste. Und er wusste auch – oder hoffte zumindest –, dass selbst seine zweit- und drittklassigen Verbände – ein zusammengewürfelter Haufen, bestehend aus Kindern, alten Männern und „Freiwilligen“ aus Kroatien, Polen, Estland, Lettland, Litauen und von der Krim – mit Fanatismus wettmachen konnten, was ihnen an tatsächlicher Ausbildung fehlte. Außerdem wusste er, dass jede alliierte Verstärkung, jede Granate, jede Dosis Morphium, jeder Druckverband und jede Lebensmittelkonserve erst den Ärmelkanal überqueren musste, um Hitlers „Festung Europa“ zu erreichen.
Letztendlich war sich Rommel darüber im Klaren, wie kompliziert amphibische Operationen grundsätzlich waren. Bei solchen Unternehmungen konnte einfach alles schiefgehen. Schon Napoleon war an der Kanalüberquerung kläglich gescheitert, Hitler selbst war es nicht anders ergangen, und als eine große alliierte Kommandostreitmacht im August 1942 entlang der französischen Küste Dieppe angriff, wurde sie von den Deutschen fast vollständig aufgerieben. Seit Wilhelm dem Eroberer im Jahr 1066 war am Ärmelkanal keine militärische Landung mehr erfolgreich gewesen – und im Gegensatz zu den Alliierten hatte Wilhelm den umgekehrten Weg genommen. Und Beispiele von anderen Meeren boten dasselbe Bild: Im Ersten Weltkrieg hatten die Briten, behindert durch Wetter und Wasser, bei Gallipoli eine schmähliche Niederlage erlitten, eine Erinnerung, die Churchill noch ein Vierteljahrhundert später verfolgte.
Also errichteten Rommels Männer wochenlang in fieberhaftem Tempo ein gewaltiges, durch ein weit verzweigtes Tunnelsystem verbundenes Netz aus Stützpunkten und Verteidigungsanlagen.10 Sie stellten mehr als eine halbe Million Panzersperren in der Brandung auf – „Belgische Tore“ und angespitzte, ineinandergreifende Eisenträger –, welche die Rümpfe der Landungsboote zerfetzen und dadurch die Alliierten zwingen sollten, auf die Ebbe zu warten, wenn das streichende Feuer deutscher Maschinengewehre am mörderischsten und wirkungsvollsten wäre. Sie fluteten raffiniert über Hunderte von Kilometern die Felder der Normandie, um eine natürliche Todeszone zu schaffen, die feindliche Flugzeuge zu Bruchlandungen zwingen würde. Und sie platzierten alle möglichen versteckten Bomben und Sprengfallen, darunter Hundertausende von Landminen, die detonieren sollten, wenn ein Draht aktiviert oder durchtrennt wurde. Dazu kamen Panzerabwehrgräben und unzählige Rollen Stacheldraht, eine endlose Folge schrecklicher Hindernisse, durch das sich die alliierten Truppen zunächst eine Bresche schlagen müssten, bevor sie auch nur in die Nähe der eigentlichen Küstenbefestigungen, Hitlers berühmtem Atlantikwall, kämen. Und natürlich erhob sich überall Beton: vier Meter dicke Stahlbetonmauern; Maschinengewehrnester aus Beton, in denen Männer wachsam Ausschau hielten; und Raketenabschussbasen aus Beton. Unterdessen warteten in der Ferne tödliche deutsche Panzer darauf, ihre Kanonen abzufeuern und die Angreifer ins Meer zurückzuwerfen.11
War dies das nationalsozialistische Gegenstück zur Maginot-Linie? Nur die Zukunft würde es zeigen. Rommel versicherte einem Adjutanten jedenfalls feierlich, dieser Krieg werde an den Stränden gewonnen oder verloren: „Glauben sie mir, Lang, die ersten 24 Stunden der Invasion sind die entscheidenden; von ihnen hängt das Schicksal Deutschlands ab.“
Es werde, prophezeite er mit einem Blick in die Ferne, „für die Alliierten wie für uns […] der längste Tag“.12
Bis dieser längste Tag kam, blieb nichts weiter zu tun als abzuwarten. Also wartete Roosevelt – im Oval Office, im Kartenraum oder wenn er mit dem Auto durch die Straßen der Hauptstadt fuhr. Er wusste, wie eine Nation im Krieg aussah, er kannte ihre Geräusche und ihre Wunden. Damit konnte er umgehen. Er wusste, dass es noch „entsetzlich lange“ dauern konnte, bis der Krieg gewonnen war. Auch damit konnte er umgehen. Und er würde mit den Schiffsladungen aus Särgen umgehen können, die, wie er wusste, in Kürze heimkehren würden. Aber während die Alliierten sich anschickten, die wichtigste gemeinsame Kriegsanstrengung zu starten, gab es einen Umstand, dem der Präsident ausgeliefert war: Seit seiner Reise nach Teheran lief seine eigene Zeit rapide ab. Während „Overlord“ immer näher rückte, wurde er mehr und mehr zu einem sterbenden Mann.13
Er hätte dies nach außen niemals zugegeben, und genauso unwahrscheinlich war, dass er es jemals sich selbst eingestand. Warum? War es unverantwortliche Gleichgültigkeit, wo Amerika sich gerade auf eine Operation vorbereitete, die das Schicksal Europas entscheiden würde, oder Selbstbetrug? War Roosevelt, der resolute und klarsichtige Führer in Kriegszeiten, einfach nicht bereit, irgendeine persönliche Schwäche oder irgendeine Niederlage zu akzeptieren? Trotz seiner Behinderung war er an der Spitze der alliierten Koalition stets von beeindruckender physischer Präsenz gewesen. Doch plötzlich, in den ersten Monaten des Jahres 1944, als seine Energie und Tatkraft am dringendsten gebraucht wurden, wirkte und verhielt sich der Präsident wie ein ernsthaft kranker Mann.
Roosevelt war erst 62, doch er stand bereits drei Jahrzehnte im Licht der Öffentlichkeit, seit Woodrow Wilson ihn zum Staatssekretär im Marineministerium ernannt hatte. Jetzt, elf Jahre nach Übernahme der Präsidentschaft, bot der Präsident in jeglicher Hinsicht ein Bild der Erschöpfung. Seine Wangen waren eingefallen, und seine Hand zitterte heftig, wenn er nach einer Zigarette griff. Sein Gesicht war kreidebleich, abgesehen von Augenringen, die so dunkel waren, dass sie auf Fotografien wie Hämatome wirkten. In den Morgenstunden war er zu erschöpft, um zu arbeiten, während er sich in den Abendstunden zu krank fühlte, um zu schlafen. Wenn er an seinem wuchtigen Schreibtisch im Oval Office Positionspapiere durchging, hatte er allzu häufig einen leeren Blick, beim Sichten der Post hingen seine Mundwinkel herab, und – kaum zu glauben – beim Diktieren schlief er ein. Als wäre es mit diesem halben Stupor noch nicht genug, wurde er einmal fast ohnmächtig, als er seinen Namen schrieb, und hinterließ auf dem Blatt Papier nichts als verlaufene Tinte und ein zusammenhangloses Gekritzel. Ein andermal stellten seine Secret-Service-Agenten fassungslos fest, dass er aus seinem Rollstuhl gefallen war und hilflos ausgestreckt am Boden lag.14 Und immerzu waren da diese Kopfschmerzen und ein chronischer Husten.
Einer von Roosevelts politischen Verbündeten gestand nach einem Abendessen im Weißen Haus, er sei bestürzt gewesen, wie „müde und erschöpft“ der Präsident gewirkt habe.15 Robert E. Sherwood, Roosevelts Redenschreiber und seit 1943 Direktor des United States Office of War Information (OWI), des Amtes für Kriegsinformation der US-Regierung, äußerte sich noch unverblümter, indem er die Gesichtszüge des Präsidenten als „fast schon verwüstet“ bezeichnete. „Erschrocken über seine äußere Erscheinung“, machte Sherwood eine Bemerkung darüber, wie viel Gewicht Roosevelt verloren habe und wie „abgemagert“ sein Hals sei. Winston Churchill vertraute seinem eigenen Leibarzt Lord Moran an, dass der Präsident aussehe wie ein „sehr müder Mann“.
Erwartungsgemäß gab es Gerüchte. Wie sorgfältig Roosevelt und der Stab des Weißen Hauses auch auf sein Image in der Öffentlichkeit achteten, es wurde doch bekannt, dass er eine Reihe von Verpflichtungen hatte absagen müssen, darunter Pressekonferenzen, was zu Gerede über eine schwere Erkrankung führte. Das Weiße Haus dementierte, Roosevelt habe lediglich „eine Grippe“ – die er seit seiner Reise um die Welt und seinem Gipfeltreffen mit Churchill und Stalin im fernen Teheran auch wirklich hatte –, doch damit war nicht alles gesagt: Dem Präsidenten ging es alles andere als gut. Wie sein Sohn Elliott später schrieb: „Die Grippe wollte einfach nicht loslassen. Er fühlte sich ständig müde.“ Er fügte hinzu: „Ein Ungemach folgte auf das andere – eine chronische Magenverstimmung zwang ihn, darauf zu verzichten, Geschäft und Essen zu verbinden; einmal war er schweißgebadet; ein phlegmatischer Husten quälte seine Lunge.“16
Roosevelt hatte in jenem Winter sehr viel Zeit in Hyde Park verbracht, aber nicht einmal der Aufenthalt dort trug nennenswert zu seiner gesundheitlichen Besserung bei. Schon im Januar wachte der Präsident morgens immer später auf. Am 28. Januar notierte Roosevelts getreuer Berater William Hassett in seinem Tagebuch: „Der Präsident schlief wieder lange“, denn schon am 25. Januar war Roosevelt erst gegen Mittag nach unten gekommen. Bis zur zweiten Märzhälfte, wieder in Hyde Park, baute Roosevelt rasch weiter ab. Jetzt wachte der Präsident schon auf, wenn das erste Grau des Morgenlichts durch die Fenster hereinströmte, aber müde und zittrig. Außerstande zu arbeiten oder sich zu konzentrieren, beschränkte er sich meist auf sein Schlafzimmer und nahm sogar sämtliche Mahlzeiten auf einem Tablett im Bett ein. Am 24. März notierte Hassett: „Der Präsident sah nicht so gut aus heute Morgen in seinem Schlafzimmer, auch nicht später, als er eine Presseund Rundfunkkonferenz gab – die Stimme belegt und heiser-krächzend. Diese letzte Erkältung hat ihn ziemlich ausgelaugt.“ Jeden Morgen lauteten Roosevelts ewiggleichen Antworten auf die Frage, wie er sich fühle: „mies“ oder „hundeelend“. Bis zum 26. März war seine Temperatur auf 40 Grad gestiegen. „Chef sieht krank aus, ungesunde Gesichtsfarbe“, notierte Hassett abermals. Als der Präsident lustlos in seinem Essen herumstocherte, ängstigte das seine Tochter Anna schließlich derart, dass sie seinen Arzt, Admiral McIntire, zur Rede stellte, der ihre Besorgnis beiseitewischte und auf die Spätfolgen von Grippe und Bronchitis verwies. Doch Anna wusste es besser und bestand darauf, dass sich ihr Vater im Bethesda Naval Hospital gründlich untersuchen ließ. Widerstrebend regelte McIntire alles Nötige, wobei er die strikte Anweisung gab: nicht ein Wort zum Präsidenten selbst über seinen Zustand.
Als Roosevelt am 28. März 1944 für die Fahrt zum Krankenhaus behutsam in seine Limousine gesetzt wurde, murmelte er Hassett einmal mehr zu: „Ich fühle mich hundeelend.“17
Von Motorrädern eskortiert rollte Roosevelts Autokolonne die Wisconsin Avenue hoch zum Bethesda Naval Hospital. Dort hob man den Präsidenten aus seinem Wagen und setzte ihn in einen bereitstehenden Rollstuhl. Augenblicklich trug er eine fröhliche Miene zur Schau, winkte und flachste ausgelassen, als man ihn ins Krankenhaus und den schwach erleuchteten Gang hinunter fuhr, vorbei an einer anschwellenden Menge, die sich eingefunden hatte, um den Anführer der alliierten Armeen zu sehen. Während Roosevelts Leibarzt, ein Hals-, Nasen-, Ohrenspezialist, vor allem ausgesucht worden war, weil Roosevelt an einer chronischen Stirnhöhlenerkrankung litt, über die er bekanntermaßen oft klagte, wurde er hier von Dr. Howard Bruenn empfangen, einem jungen, hoch angesehenen Kardiologen. Bruenn, Korvettenkapitän in der Marinereserve und bekannt für seine strenge, sachliche Art, war beunruhigt über das, was er feststellte. Er vermutete von Anfang an, dass „etwas furchtbar im Argen lag“. Als er das Licht im Behandlungszimmer anknipste, stellte er fest, dass Roosevelts Gesicht „sehr grau“ und „fahl“ war, und er sah, dass seine Lippen und Haut eine „bläuliche Verfärbung“ aufwiesen, was bedeutete, dass der Blutkreislauf seine grundlegendste Funktion nicht erfüllte, nämlich das Gewebe mit Blut zu versorgen. Roosevelt hustete ständig und konnte nicht länger als 35 Sekunden die Luft anhalten.18
Als Bruenn Herz und Lunge mit einem Stethoskop abhörte, bestätigte das seine Befürchtungen: Während Roosevelt ein- und ausatmete, hörte Bruenn pulmonale Nebengeräusche, ein verdächtiges Rasseln oder Blubbern, was darauf hindeutete, dass sich in der Lunge des Präsidenten Flüssigkeit ansammelte. Was bei Roosevelt eingesetzt hatte, war im wahrsten Sinne des Wortes ein langsamer Prozess des inneren Ertrinkens. Es handelte sich nicht einfach um eine Bronchitis oder die Spätfolgen einer Lungenentzündung, wie McIntire ihm eingeredet hatte. Tatsächlich erkannte Bruenn von Anfang an, wie schwer Roosevelt schon das Atmen fiel; das einfache Umwenden von einer Seite auf die andere löste ein beunruhigendes „Schnaufen“ aus. „Es war schlimmer, als ich befürchtet hatte“, erinnerte sich der Arzt später.19
Die Schwere von Roosevelts Erkrankung trat im Laufe der weiteren Untersuchung noch deutlicher zutage. Eine flüchtige Durchsicht von Roosevelts Krankenunterlagen ergab, dass bei ihm schon im Februar 1941, als er den leichten Herzinfarkt gehabt hatte, ein Blutdruck von 188 zu 105 gemessen worden war. Was danach geschehen war, wusste niemand. Laut Roosevelts Patientenakte hatte McIntire seitdem den Blutdruck des Präsidenten nicht mehr gemessen. In Bruenns Behandlungszimmer betrug er jetzt 186 zu 108. Röntgenuntersuchung und EKG ergaben, dass sein Herz vergrößert und seine Lungengefäße verstopft waren. Und Roosevelts Herzschatten war erheblich vergrößert. Als wäre all dies nicht schon erschreckend genug gewesen, entdeckte Bruenn mit seinem Stethoskop auch ein systolisches Rauschen, ein Hinweis darauf, dass die Mitralklappe des Präsidenten sich nicht richtig schloss.
Bruenn stellte rasch seine Diagnose: Franklin Delano Roosevelt, Präsident der Vereinigten Staaten, litt an Herzinsuffizienz, Bluthochdruck und einer hypertensiven Herzerkrankung, verschlimmert durch eine akute Bronchitis. Ohne einen erheblichen Eingriff hätte Roosevelt nicht mehr länger als ein Jahr zu leben. Bruenn sollte recht behalten.
Getreu McIntires dezidierter Anweisung ließ Bruenn gegenüber dem Patienten nicht ein Wort über seine Befunde verlauten. Roosevelt jedoch legte, todkrank, wie er sich fühlte, ohnehin ein bemerkenswertes Desinteresse an den Tag. Er fügte sich fröhlich in diese Farce und plauderte über Gott und die Welt – seine Standardmethode zur Vermeidung unangenehmer Themen –, erkundigte sich aber niemals nach seiner Gesundheit. Vielmehr bestand er darauf, schon am selben Nachmittag bei einer zuvor bereits angesetzten Pressekonferenz zugegen zu sein, um jegliche öffentliche Besorgnis zu zerstreuen. Er lieferte eine brillante Vorstellung. Sämtliche Befürchtungen wegen einer Lungenentzündung vom Tisch wischend, ließ der Präsident ein Lächeln aufblitzen, täuschte einen Pseudohusten vor und klopfte sich auf die Brust, um zu zeigen, dass er gesundheitlich auf der Höhe sei. Während Blitzbirnen platzten, fiel die Presse darauf herein, und sogar die New York Times berichtete: „Teint und Stimme des Präsidenten […] waren besser.“20
Doch das war bloß vorgespielt: Als Eleanor und ihre gemeinsame Tochter Anna ihn später in seinem Arbeitszimmer im Weißen Haus aufsuchten, litt er sichtlich und war selbst zum Sprechen zu müde. Um halb acht Uhr abends lag er bereits im Bett.
Unterdessen diktierte Dr. Bruenn, entschlossen, Roosevelt wie jeden anderen Patienten zu behandeln, ein Memorandum, in dem er seine Empfehlungen skizzierte. Ein paar davon waren leicht umzusetzen, etwa eine salzärmere Ernährung, ein Programm zur Gewichtsreduzierung, die Einnahme von Digitalis (obwohl die Festsetzung der Dosis etwas kompliziert war, und zu den möglichen Nebenwirkungen Halluzinationen und verschwommene Sicht gehörten), die tägliche Einnahme leichter Abführmittel und eine etwas aufgerichtete Schlafposition, um seine nächtliche Atemnot zu lindern. Hatte Roosevelt zuvor bis zu 30 Zigaretten am Tag geraucht, so lautete Bruenns Anweisung nun, diesen Konsum wie auch die Zahl seiner abendlichen Cocktails erheblich zu reduzieren. Doch Bruenns wichtigste Empfehlungen waren heikler, zum einen, weil Roosevelt Präsident der Vereinigten Staaten war, zum anderen, weil es nur noch zwei Monate bis zur alliierten Invasion in Frankreich waren. Er riet Roosevelt dringend zu einer mehrwöchigen strikten Bettruhe bei bester Pflege, wobei jede „Anspannung“ zu vermeiden sei.
McIntire, dem unerhörterweise die meisten Erkrankungen des Präsidenten entgangen waren und der sich nach wie vor gegen die Vorstellung wehrte, sein Patient habe irgendein Herzleiden, explodierte beinahe bei dem Vorschlag. „Der Präsident kann sich nicht freinehmen, um sich ins Bett zu legen“, blaffte er. „Wir reden hier vom Präsidenten der Vereinigten Staaten!“21 Also zog er ein Team aus führenden Spezialisten zusammen, um Bruenns Diagnose zu überprüfen. McIntires handverlesene Spezialisten schlugen sich auf seine Seite, aber Bruenn, der überzeugt war, das Leben des Präsidenten sei in Gefahr, weigerte sich, klein beizugeben. Schließlich willigte McIntire ein, Roosevelt durch zwei unabhängige Spezialisten untersuchen zu lassen. Nachdem diese den Präsidenten gesehen hatten, ergriffen sie entschieden Partei für Bruenn.
Einer der auf Bruenns Initiative hinzugezogenen Spezialisten, Dr. Lahey, ließ durchblicken, dass er sich auch um den Magen-Darm-Trakt des Präsidenten sorge. Lahey hinterließ kein konkretes Dokument über den Grund seiner Besorgnis, aber einiges deutet darauf hin, dass er möglicherweise glaubte, einen inoperablen und wahrscheinlich bösartigen Tumor in Roosevelts Magen gefunden zu haben. Es handelte sich vielleicht um ein Sekundärkarzinom, das seinen Ursprung in einem bösartigen Muttermal über dem linken Auge des Präsidenten hatte oder in einer Talgzyste am Hinterkopf, die ihm inzwischen entfernt worden war. Aber die unmittelbare Gefahr für Roosevelt ging von seinem Herzen aus.
Das Ärzteteam stand mithin vor einer beinahe unüberwindlichen Herausforderung. Der Präsident durfte nicht arbeiten – Arbeit konnte ihn umbringen –, und er konnte unmöglich nicht arbeiten: Das Land brauchte ihn. Was tun? Man einigte sich auf eine abgespeckte Version der Empfehlungen von Dr. Bruenn, einschließlich einer maximalen Begrenzung der Anrufe während der Mahlzeiten. Außerdem sollte seine Gesundheit fortan sehr viel häufiger und sorgfältiger überwacht werden. Bruenn erschien nun jeden zweiten Tag vor den Toren des Weißen Hauses, um nach seinem Patienten zu sehen, und nach den ersten zwei Wochen schien die Kur immerhin anzuschlagen. Röntgenbilder zeigten, dass die Lunge frei und die Bronchitis abgeklungen war, wozu wahrscheinlich auch der teilweise Verzicht auf Zigaretten beigetragen hatte. Roosevelt bekam wieder etwas mehr Farbe, und sein Husten hörte auf. Sogar die Größe seines Herzens nahm ab. Der Präsident schlief auch besser und berichtete, dass er sich wohler fühle. Trotzdem war er alles andere als gesund, was McIntire indes nicht davon abhielt, Öffentlichkeit und Presse unverfroren in die Irre zu führen. Am 3. April versicherte er, dem Präsidenten gehe es gut, die Untersuchung habe nichts Gravierendes ergeben und der Präsident brauche jetzt lediglich „etwas Sonnenschein und mehr Bewegung“.22
Doch schon am nächsten Tag stieg Roosevelts Blutdruck auf 226 zu 118, und im Gegensatz zu seinem üblichen Benehmen war der Präsident ungewöhnlich apathisch, ungeduldig und unkonzentriert. Der notorisch optimistische Roosevelt gestand Eleanor sogar, dass auch er beunruhigt sei und vermute, die Ärzte wüssten nicht, wo das Problem liege. Als er unerklärliche Schmerzen im Rektalbereich verspürte, fürchtete er selbst, dass sie von einer bösartigen Krebsgeschwulst herrührten, obwohl die Beschwerden irgendwann wieder abklangen. Aber weiterhin nahm er seine Tabletten, ohne zu fragen, wofür sie waren, und vermied jedes offene Gespräch über seine Erkrankung.
Ob er diese Vermeidungsstrategie wählte, weil sie für ihn bei Polio so wunderbar funktioniert hatte, oder ob er sie sich bereits beim Auftreten des letztendlich tödlichen Herzleidens seines Vaters angeeignet hatte, ist unklar. Jedenfalls war sie der Weg, den Roosevelt wählte. Er zog es vor, weiterhin völlig im Dunkeln zu tappen.23
Allerdings erkannte das Ärzteteam des Präsidenten in diesem Stadium, dass es kaum eine Alternative gab. Krieg hin oder her, Präsident hin oder her, wenn Roosevelt überleben wollte, musste mehr getan werden. Man informierte den Präsidenten, dass er eine beträchtliche Ruhepause brauche, fernab vom Weißen Haus.
Für Roosevelt muss es ein qualvoller Augenblick gewesen sein. Eine beträchtliche Ruhepause, fernab vom Weißen Haus? Er hatte entgegen allen Erwartungen Polio überwunden und war zum Präsidenten gewählt worden, hatte der Großen Depression getrotzt, leitete jetzt die bevorstehende D-Day-Invasion und hielt die alliierte Koalition zusammen. Aber plötzlich drohten die verheerenden Auswirkungen seiner schlechten Gesundheit ihn zu erledigen. „Ich sehe keinen Ausweg, und ich bin wütend“, sagte Roosevelt erregt zu Churchill. Würde die gemeinsame alliierte Aktion trotz seines Todes stattfinden? Roosevelt wusste ebenso wie Churchill gut genug, dass Kriege durch unerwartete Ereignisse – den Tod eines kommandierenden Generals im eigenen Feuer, „Strategiefehler“, fehlerhafte Geheimdienstinformationen oder auch durch einen Präsidenten, der plötzlich die Nerven verlor – eine ebenso unerwartete Wende nehmen konnten. Und Roosevelt wusste auch, dass es die Aufgabe großer Befehlshaber war, Wege zu finden, um Hindernisse zu überwinden, nicht, sich von ihnen ausbremsen zu lassen.24 Befehlshaber hatten auch dann noch zu führen, wenn sie beeinträchtigt waren, sie mussten immer weitermachen, und dies galt auch für Roosevelt.
Mochten seine Ärzte auch verzweifelt sein, er fühlte sich herausgefordert. Während seiner gesamten Präsidentschaft war schon der bloße Akt des Aufstehens mit fast acht Kilo schweren Metallschienen an den Beinen eine Tortur. Während ihm der Schweiß über das Gesicht lief und er die Zähne zusammenbiss, hatte er oft Mühe zu stehen oder zu gehen, wobei er stockend und krummbeinig seine Hüften vorwärts schwang. Jahrelang versuchte er vergeblich, Treppen allein zu bewältigen, während er vor sich hin murmelte: „Ich muss diese Treppe hinunterkommen, ich muss.“ Aber auch wenn er körperlich geschwächt war, war sein Geist ungebrochen. Als Präsident nötigte er Beobachtern mit seinem Durchhaltevermögen oft Respekt ab. Die Nation, ja die Welt kannte ihn nicht wegen seiner Behinderung, sondern wegen seiner Vitalität: seiner volltönenden Stimme, seines singenden Tonfalls und seiner Sentenzen, seines wallenden Capes und seines berühmten Lächelns. Und vor allem wegen des Umstands, dass er in der Sprache seiner Zeit redete und dachte.
Dementsprechend nahm er diese Hürde wie jede andere in seinem bisherigen Leben: mit unbändiger Zuversicht. Hatte er der Verzweiflung früher schon energisch die Stirn geboten, so gedachte er es jetzt wieder zu tun.
Anfang April bot Winston Churchills guter Freund, der Finanzier und ehemalige Präsidentenberater Bernard Baruch, Präsident Roosevelt sein geräumiges Herrenhaus als abgeschiedenen Rückzugsort an. Es stand auf Hobcaw Barony, einer berühmten Plantage in South Carolina, „zwischen den Wassern“ der Winyah Bay und des Atlantiks. Hier gab es alle möglichen Fischarten und massenhaft wild lebende Tiere, von Wachteln bis zu Füchsen, von Alligatoren bis zu Truthähnen, rauschende Bäche, sich kilometerweit erstreckende herrliche Felder und Salzsümpfe sowie dichte Wälder voller Kiefern und jahrhundertealter, von Louisianamoos bewachsener Eichen. Hier, weit weg von jeder kriegerischen Auseinandersetzung, konnte sich der Präsident erholen. Hobcaw war in der Tat so friedlich, dass Baruch nicht einmal erlaubte, dort Telefonleitungen zu spannen. Roosevelts Taschen wurden gepackt und sein langsamer Privatzug bereitgemacht. „Ich möchte immer nur schlafen“, sagte Roosevelt bei seiner Ankunft am Ostersonntag, dem 9. April 1944, „zwölf Stunden am Tag.“ Es sollte ursprünglich eine zweiwöchige Flucht werden. Roosevelt blieb einen ganzen Monat.25
Genau zu der Zeit, als Roosevelt sich auf den Weg nach South Carolina machte und die alliierten Streitkräfte sich für den D-Day rüsteten, arbeitete auch ein besonderer Bereich des NS-Imperiums auf Hochtouren: die Gaskammern von Auschwitz. Diese Gaskammern stellten die letzte schreckliche Bemühung dar, eine noch verbliebene große jüdische Bevölkerungsgruppe in Europa zu vernichten – jedes Kind und jede Mutter, jeden Vater und jeden Großelternteil, jeden, der als untauglich für schwere Arbeit oder für medizinische Experimente oder einfach als „lebensunwert“ erachtet wurde. Diesmal traf es die ungarischen Juden. Ihre Vergasung würde den größten einzelnen Massenmord in der Geschichte der Welt darstellen. Für Hitler bedeutete er die Verwirklichung eines lang gehegten Traums.
Auschwitz war seit seinen mittelalterlichen Anfängen eine Grenzstadt gewesen, die Völker und Kulturen, slawische und deutsche, teilte.26 Ihr polnischer Name, Oswiecim, leitet sich ironischerweise aus dem altpolnischen Wort für Heiliger ab. Die slawischen Bewohner brachten ihre Kultur und die später folgenden deutschen Siedler ihre Rechtsordnung mit. Am Zusammenfluss von Weichsel und Sola gelegen, entwickelte sich Oświęcim zu einem kleinen Handelszentrum. Im Laufe der Jahrhunderte ging es von polnischen Herrschern über ans Heilige Römische Reich und später dann an die böhmischen Könige von Prag, wodurch Tschechisch zur Amtssprache wurde. Im Jahr 1457 fiel die Stadt an Polen zurück, nachdem sie für 50.000 Silbermark verkauft worden war. Bei der Ersten Polnischen Teilung 1772 wurde Oswiecim von Österreich beansprucht, unter den Habsburgern wurde der Name dann in Auschwitz geändert, und Deutsch wurde zur Amtssprache. Bis zum Zusammenbruch des Habsburgerreiches 1918 führte der Kaiser von Österreich neben seinen vielen anderen Titeln auch den Titel eines Herzogs von Auschwitz.
Obwohl die Einwohner von Oswiecim überwiegend Katholiken waren, gab es dort auch Juden, aber nur ein Häuflein Deutscher. Die Stadtgesetze untersagten es Juden nicht, innerhalb der Mauern zu wohnen und Handel zu treiben, auch wurden sie nicht in Ghettos verbannt, sodass sich nach und nach in der Stadt eine blühende jüdische Gemeinde entwickelte. Juden besaßen Banken und Fabriken, arbeiteten als Ladenbesitzer und Händler, und ihnen gehörte sogar eine beliebte Brennerei. Im Laufe der Zeit wurde Auschwitz ein so wichtiges Zentrum des jüdisch-orthodoxen intellektuellen Lebens und der zionistischen Bewegung, dass manche vom „Oswiecimer Jerusalem“ sprachen. Tatsächlich entsprach der jüdische Bevölkerungsanteil dem katholischen oder übertraf ihn sogar leicht, was sich auch im politischen Leben der Stadt niederschlug: So war der Bürgermeister zwar immer ein Katholik, aber der Posten des stellvertretenden Bürgermeisters ging ausnahmslos an einen Juden.
Das erste Lager der Stadt wurde an der Wende zum 20. Jahrhundert errichtet, doch nur, um die Legionen von Saisonarbeitern unterzubringen. Nach dem Ersten Weltkrieg beherbergte es Flüchtlinge, hauptsächlich Polen, die aus der neu geschaffenen Tschechoslowakei geflohen waren. Die Dinge begannen sich erst zu ändern, als in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg unter den Einwohnern erste Anzeichen von Antisemitismus auftraten. Juden wurde nun verboten, sowohl einen beliebten Badeplatz am Ufer der Sola als auch den Stadtpark zu benutzen. Derweil boykottierten polnische Einwohner stillschweigend jüdische Handwerker, was einige zwang, ihre Werkstätten zu schließen. Aber niemand konnte vorhersagen, was passieren würde, als 1939 Deutschland die polnischen Streitkräfte bezwang, ein großes Gebiet annektierte, darunter auch Auschwitz, und es zu einem Teil des Deutschen Reiches machte.
Damals, zu Beginn des Jahres 1940, „fiel Himmlers Blick auf Auschwitz“, wie die Historikerin Sybille Steinbacher schreibt.27
Heinrich Himmler, der berüchtigte Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, suchte nach Örtlichkeiten zur Errichtung von Konzentrationslagern für politische Gegner. Das alte Lager der Saisonarbeiter in der Nähe von Auschwitz, das sogenannte „Sachsengängerlager“, kam als einer von drei Orten in die engere Auswahl, obwohl einiges gegen ihn sprach. Die Gebäude und Baracken waren baufällig, das Gelände war sumpfig und malariaverseucht, und die Wasserversorgung war schlecht. Zwei wesentliche Eigenschaften sprachen dennoch für den Standort: Er verfügte bereits über eine gute Verkehrsanbindung, lag er doch an einem Eisenbahnknotenpunkt, und er war leicht vor den neugierigen Blicken der Außenwelt abzuschirmen. So wurde Auschwitz im April 1940 das 70. Konzentrationslager des Reiches, und alles entsprang aus diesem Anfang.
Ende 1940 wuchs Auschwitz derart an, dass es sich Dörfer, Wälder, Teiche und landwirtschaftliche Flächen einverleibte, bis sich das offizielle „Interessengebiet des K.L. Auschwitz“ schließlich über ausgedehnte 40 Quadratkilometer erstreckte. Und das war längst nicht genug. Im Herbst 1941 begannen in Birkenau, etwa zwei Kilometer vom „Stammlager“ Auschwitz I entfernt, die Bauarbeiten für einen zweiten Lagerbereich. Ursprünglich waren in Auschwitz in erster Linie politische Gefangene aus Polen und sowjetische Kriegsgefangene interniert gewesen. Aber im Januar 1942 kündigte Himmler die Ankunft von 150.000 Juden an, ein Drittel von ihnen Frauen. – Sie kamen mit dem Zug, immer.
Es spielte sich folgendermaßen ab: Wenn die brechend vollen Züge in Auschwitz einfuhren, herrschte mehrere Augenblicke lang düsteres Schweigen, durchbrochen nur von zartem Geflüster, plötzlichen Schluchzern und traurigen Blicken. Familien drängten sich eng zusammen und begannen leise zu sprechen. Mütter hielten Söhne fest, Töchter klammerten sich an Väter, Kinder ergriffen die Hände beider Eltern, küssten sie immer wieder. Manche Häftlinge waren ungewöhnlich gefasst, lauschten einfach aufmerksam. Andere waren nahe daran durchzudrehen, zählten in panischer Angst und Vorahnung die Sekunden. Wieder andere wähnten sich in einem unheimlichen Traum; und Stille –„jeder menschliche Laut verstummte nun“ – senkte sich über die Viehwaggons voller menschlicher Fracht.
Der Zug kam mit einem Ruck zum Stehen, und die Türen flogen auf. Draußen herrschten Chaos, Verwirrung und Entsetzen. Für die Juden war es nach Tagen des Eingesperrtseins in den abgedunkelten Viehwaggons beinahe unerträglich, plötzlich in das grelle Licht der Scheinwerfer längs der Bahngleise zu blinzeln. Ebenso unerträglich war der Gestank, der mit nichts vergleichbar war, was sie jemals gerochen hatten. Zu dem Zeitpunkt konnten sie es noch nicht wissen, aber es war der Geruch von verbranntem Menschenfleisch und brennendem Menschenhaar. Draußen hörten sie alle möglichen Geräusche, laut bellende Hunde und Befehle, die sie nicht verstanden. Sie wurden auf Deutsch herumkommandiert; SS-Männer mit Maschinenpistolen schritten den Bahnsteig auf und ab, und Wachtposten brüllten kurze, abgehackte Befehle: „Macht schnell!“ Wenn die Ungarn, orientierungslos und verängstigt, aus den Viehwaggons stolperten und zaghaft Fragen zu stellen begannen, schrien die Deutschen zurück: „Raus, raus, raus!“
In der Ferne konnten die Häftlinge hohe Schornsteine sehen, die den Horizont beherrschten, und hell-orangefarbene Flammenzungen, die in die Wolken zu schießen schienen.
Weil sie nicht wussten, was sie sonst tun sollten, machten sich die Häftlinge an ihrem Gepäck zu schaffen, flüsterten zögernd mit einem Familienmitglied oder riefen einer Freundin oder einem Freund leise etwas zu, als wäre alles normal, doch das war es ganz und gar nicht. Inzwischen gelang es ein paar Lagerhäftlingen mit tief liegenden Augen und ausgemergelten Körpern durch die Reihen der Neuankömmlinge zu schlüpfen, wobei sie alten Männern zuraunten, dass sie sagen müssten, sie seien „jünger“, und kleinen Jungen einschärften zu sagen, sie seien „älter“. Sie baten alle eindringlich abzustreiten, dass sie schwach, krank, ausgehungert oder erschöpft seien. Gleichzeitig stiefelte ein dichter Kordon aus SS-Männern mit eiskalten Blicken unheilverheißend hin und her. Bald fingen sie an, die Juden im Eiltempo zu verhören, in gebrochenem Holländisch, Slowakisch, Tschechisch oder Ungarisch. „Dein Alter?“ – „Gesund?“28 Während die Häftlinge sich schlurfend aufstellten, stieg einer der höheren Offiziere auf den Bahnsteig. Der berüchtigtste von ihnen war Dr. Josef Mengele. Der Arzt – „ein typischer SS-Offizier, grausame Gesichtszüge, aber nicht ohne Klugheit, Monokel im Auge, einen Taktstock in der Hand“29 – begann in die eine oder andere Richtung zu zeigen: „Links raus!“, „Rechts raus!“, „Links raus!“, „Rechts raus!“. Alle, die gesund oder kräftig waren, mussten sich in einer Reihe aufstellen. Die Übrigen – ausnahmslos die Alten, Mädchen, kleine Kinder und Säuglinge – wurden in einer anderen Reihe aufgestellt. Die eine Reihe bedeutete Arbeitslager. Die andere Reihe bedeutete Gaskammern, wobei die Häftlinge nach Geschlechtern getrennt wurden.
Nachdem eine volle Zugladung angekommen war, fragte Mengele einen Vater: „Alter, was machst du?“
„Landarbeit“, erwiderte der Angesprochene zögernd. Er wurde angewiesen, nach rechts zu gehen, bis Mengele ihm hinterherschrie, er solle zurückkommen. „Streck deine Hand aus!“ Mengele schlug ihm heftig mitten ins Gesicht und stieß ihn in die andere Reihe – die Reihe derer, auf welche die Gaskammer wartete. „Schnell!“, rief er. „Schnell!“ Es war das letzte Mal, dass der halbwüchsige Sohn des Mannes seinen Vater sah.
Die angeleinten Hunde, Deutsche Schäferhunde und Dobermänner, bellten in einer Tour weiter.
Irgendjemand brachte den Mut auf, sich nach seinem Gepäck zu erkundigen. Hier bewies die SS, dass sie ebenso gerissen wie erbarmungslos war. „Gepäck nachher“, kam die barsche Antwort. Mütter wollten stets bei ihren Kindern bleiben. Die SS sagte: „Gut, gut, mit Kind bleiben.“ Ein Ehemann wollte seine Frau begleiten – sie waren in unterschiedlichen Reihen aufgestellt worden –, und die SS bestand ruhig darauf: „Nachher wieder zusammen.“
Nachdem die Selektionen vorgenommen worden waren, wurden diejenigen, die zum Sterben bestimmt waren, unter einem Hagel von Stockschlägen, die unterwegs bei jedem Schritt auf sie niederprasselten, zu einer von fünf Gaskammern geführt.30 Doch sie hatten keine Ahnung, was ihnen bevorstand; die Nationalsozialisten hatten ihre wahren Absichten in jeder Phase sorgfältig kaschiert. Die Häftlinge wurden an einem mit Stacheldraht bespannten Tor vorbeigeführt, zwischen doppelten Reihen von SS-Männern hindurch, die einen gewundenen Pfad säumten, und vorbei an drohenden Wachtürmen, auf denen deutsche Soldaten mit Maschinengewehren postiert waren. Jedes der Krematorien war wie sein eigenes Potemkinsches Dorf, es verfügte über einen separaten Eingang und wurde durch einen hübschen Weidenzaun teilweise verborgen; dazu kamen gepflegte Blumenbeete, die dem ganzen Bau ein beinahe einladendes Aussehen, ja einen Anschein von Ruhe verliehen.
Aber die aufwändige Täuschung gelang nie gänzlich. Obwohl ihr Marsch in die Gaskammern von einem Geheimnis umgeben war, lastete zugleich schreckliche Angst auf ihm. Zitternd und verunsichert wurden jeweils 300 bis 400 verängstigte Häftlinge zu einer Treppe getrieben, die hinabführte zur Tür eines Kellers, der als Auskleideraum diente. Die sich schlängelnde Reihe der Häftlinge, die draußen warteten, erstreckte sich über die Länge mehrerer Fußballfelder.
Sie wussten, dass etwas nicht in Ordnung war, denn der gesamte Bereich war umringt von bewaffneten SS-Männern und knurrenden Hunden, aber sie blieben aus unterschiedlichen Gründen größtenteils gefasst. Sie waren erschöpft von der langen Reise, eingeschüchtert durch die Umgebung oder einfach starr vor Angst. Vielleicht ließen sie sich auch durch den beruhigenden Anblick eines mit einem roten Kreuz gekennzeichneten Lastwagens täuschen, der in der Nähe parkte. Nur wenige wollten an das Grauen glauben, das sie erwartete. Nur wenige hätten sich vorstellen können, dass von ihnen binnen weniger Stunden nur noch Asche übrig sein würde. In was für einer Welt war ein derart grauenhaftes Schicksal auch möglich?
Dennoch kam es vor, dass eine Mutter in Panik geriet und ein Kind hemmungslos zu schreien anfing, woraufhin beide sofort von SS-Wachen hinter das Gebäude geführt wurden. Ein Lagerinsasse, der es schaffte zu überleben, erinnerte sich später, dass er in seiner Baracke lag, die Hände auf die Ohren presste und dennoch hörte, wie draußen Menschen erschossen wurden. Er wusste, dass sich der fallende Schnee bald mit Aschepartikeln aus dem Krematorium vermischen würde.
Frauen, Kinder und alte Männer wurden zuerst hineingeschickt, erst danach folgten die gesünderen, kräftigeren Männer. Als sie in den Auskleideraum kamen, sahen sie, dass er das beruhigende Aussehen eines internationalen Informationszentrums hatte. Harmlos wirkende Schilder auf Französisch, Deutsch, Ungarisch und Griechisch wiesen den Neuankömmlingen den Weg zu „Bad“ und „Desinfektionsraum“. Im Auskleideraum selbst gab es sowohl ordentliche Bänke, auf denen Menschen bequem sitzen konnten – in dieser Phase eine willkommene Erholung –, als auch längs der gesamten Wand fein säuberlich nummerierte Kleiderhaken. Um den falschen Schein zu vervollkommnen, wiesen die Nationalsozialisten die Häftlinge an, sich ihre Nummern sorgfältig zu merken, damit sie ihre persönliche Habe nach dem Duschen leichter wiederfänden. Als die Häftlinge sich umschauten, sahen sie außerdem Schilder mit Parolen wie „Durch Reinlichkeit zur Freiheit“, „Eine Laus kann dich töten“ und „Wasch dich“. Um jeden Widerstand zu unterbinden, versprachen die Deutschen den ausgehungerten Häftlingen außerdem eine Mahlzeit unmittelbar nach der „Desinfektion“.
Das Täuschungsmanöver dauerte bis zu den allerletzten Momenten. Zu griechischen Juden, die im Vorraum der Gaskammern Anstalten trafen, sich zu entkleiden, sagte SS-Obersturmführer Franz Hößler, wie sich Augenzeugen erinnerten, dies sei kein Erholungsort, sondern ein Arbeitslager, und sie würden hier zum Wohle eines „neuen Europa“ arbeiten, so wie die deutschen Soldaten an der Front ihr Leben für den Sieg des „Dritten Reiches“ riskierten. Man werde sich um ihre Gesundheit kümmern und ihnen gut bezahlte Arbeit bieten. Nach dem Krieg würden sie entsprechend ihrer Verdienste beurteilt und behandelt.
Sodann forderte Hößler alle in ruhigem Ton auf, sich zu entkleiden, ihre Sachen an die dafür vorgesehenen Haken zu hängen und sich die Nummer zu merken, bevor er seine Ansprache mit den Worten schloss: „Nach dem Baden gibt es für jeden eine Portion Suppe und Kaffee oder Tee. Ja, damit ich es nicht vergesse, halten Sie nach dem Baden alle Lehrbriefe, Diplome, Schulzeugnisse und sonstigen Dokumente bereit, damit wir jeden nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten einsetzen können. Noch etwas: Diabetiker, die keinen Zucker zu sich nehmen dürfen, melden sich nach dem Baden beim diensthabenden Personal.“31
Kinder waren, obwohl die Nationalsozialisten sich nach Kräften bemühten, zwangsläufig verängstigt. Zu bizarr, zu kalt, zu abstoßend war die Szenerie. Viele Mütter, inzwischen beinahe im Hoffnungswahn, beeilten sich, die Ersten in der Reihe zu sein und alles so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, und sei es nur um ihrer Kinder willen. Dennoch reichte selbst der Anblick vermeintlicher Duschköpfe nicht, um die Zweifel, die sich einschlichen, zu zerstreuen. Ebenso wenig wie der Umstand, dass einige SS-Männer, die tatsächlich weiße Kittel trugen, Seife austeilten und Handtücher ausgaben, bevor sie die schweren Türen zu den Gaskammern zuschlugen.
In dieser Phase fingen die Häftlinge normalerweise an, miteinander zu flüstern. Zuletzt wurden die Männer in die Kammern gestoßen. Bis zu 2000 Menschen waren nun dicht an dicht eingezwängt in einem Raum, der eigentlich nur für die Hälfte ausgelegt war.
Rund 2000 – etwa so viele Menschen wurden auch bei Picketts Angriff in Gettysburg niedergemetzelt oder fielen in der erbitterten Schlacht von El Alamein in Nordafrika auf alliierter Seite. Und etwas weniger als doppelt so viele starben bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001.
Jetzt hieß es warten, und dieses Warten, das manchmal zwei Stunden dauerte, war die Hölle. Durchbrochen wurde es von kleinen, grausamen Momenten. SS-Männer machten sich oft einen Spaß daraus, die Lampen in der Gaskammer ein- und auszuschalten, eine perverse Form von Folter. Wenn kein Wasser aus den Duschköpfen kam und das Licht ausgeschaltet wurde, fingen die Häftlinge hysterisch zu kreischen an. Jetzt wussten sie, dass sie irgendwie sterben würden. Aber wenn das Licht wieder eingeschaltet wurde, gab es einen Laut, einen gewaltigen kollektiven Seufzer von Menschen, die sich Hoffnungen machten, das Unternehmen sei abgebrochen worden und man gewährte ihnen wie durch ein Wunder eine Gnadenfrist. Doch die gewährte ihnen niemand.
Die massive luftdichte Tür zur Gaskammer war mit einem eisernen Riegel verschlossen, der sich festschrauben ließ. Mit gnadenloser Effizienz öffneten SS-Männer die Dosen mit dem Zyklon B und schütteten die erbsengroßen Kugeln in spezielle Vorrichtungen aus Drahtgittern: „Das Zyklon B drang durch vier besondere Vorrichtungen in den Raum: vermeintlichen Stützpfeilern, die von Metallgittern umschlossen waren und aus dem Dach ragten.“32 Ein SS-Arzt überwachte den gesamten Ablauf; er sah durch ein Guckloch zu, das aus einer Doppelglasscheibe mit einem dicken Metallgitter bestand und stark genug war, um den verzweifelten Schlägen erstickender Häftlinge standzuhalten. Jetzt wurde das Licht zum letzten Mal ausgeschaltet. Niemand konnte etwas sehen.
Das Ende nahm mit einer Reihe kleiner Vorgänge seinen Lauf: Nach dem Verriegeln der Tür begann das Gas sich rasch im Raum auszubreiten, nicht von der Decke aus, wie man erwarten würde, sondern vom Boden aufwärts. Kleine Kinder fingen an, ihre Eltern heftig zu umarmen – wenngleich verängstigte Jungen und Mädchen allzu oft von ihren Eltern getrennt worden waren, umherkrochen und verzweifelt nach ihnen riefen. Paare hielten sich mit Herzrasen an den Händen. Dann begann das Schreien. Und ein fürchterliches Ringen. Jene, die dem ausströmenden Gas am nächsten standen, fielen beinahe augenblicklich tot um. Aber viele von den anderen kämpften mit all ihrer Kraft ums Überleben. Sie drängten sich zusammen, sie schrien zusammen, sie schnappten zusammen nach Luft. Und tragischerweise kämpften sie in jenen letzten Minuten oft erbittert gegeneinander. Hunderte von Menschen versuchten sich instinktiv einen Weg zur Tür zu bahnen, da sie wussten, wo sie war. Sie hofften, mit Gewalt nach draußen zu entkommen; dabei wurden jedoch die Schwächeren, die Alten und die Kinder zu Tode getrampelt, und ihre zerquetschten Leiber stapelten sich. Derweil versuchten manche Opfer, höher zu klettern, denn je höher sie kamen, desto mehr Luft gab es. Die Kräftigsten schafften es in jenen letzten grauenvollen Todeskämpfen, „an den vor ihnen Sterbenden hochzukriechen […]“. „Ich beobachtete“, schrieb der Augenzeuge Dr. Miklos Nyiszli später, „daß zuunterst im Leichenberg immer Säuglinge, Kinder und Frauen lagen, ganz oben die kräftigeren Männer.“33
Kinderschädel wurden zerschmettert. Im Dunkeln wild um sich schlagend, wurde Hunderte von Menschen bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Es stank nach Erbrochenem und Blut – aus Nasen und Ohren –, und überall waren menschliche Exkremente.
Während die Minuten verrannen und die Stahltür sich nicht bewegen wollte, strömte unaufhörlich das Gas. Bald wurde aus den markerschütternden Schreien ein Röcheln und aus dem Todesröcheln ein kaum noch vernehmliches Keuchen. Nach wenigen Minuten waren alle zusammengesunken, und allmählich wich jedes Leben aus den Körpern. Hände bewegten sich nur noch schwach; Füße zuckten kläglich; Blicke brachen. Nach 20 Minuten war alles vorbei.
Draußen vor der schweren, verstärkten Tür verfolgten die Aufsicht führenden Ärzte das Töten. Die meisten sahen nicht zu. Hans Münch, einer der Lagerärzte in Auschwitz und im Krakauer Auschwitzprozess freigesprochen, weil ehemalige Häftlinge zu seinen Gunsten aussagten, erinnerte sich an die Beschaffenheit der Tür: „Doppelwandig. Ich weiß es deswegen, dem, von dem Geräusch, was dann entstand, nicht wahr, wenn die Panik ausbrach, hat man also, wenn man, mußte man also sehr nahe hingehen, um etwas zu hören, das war eben sehr, sehr instruktiv. Das war, war wie ein Summen, ein lautes Summen von einem Bienenkorb ungefähr, so viel hat man nach außen gehört.“34
Wenn alle tot waren, saugte ein Ventilator das Giftgas ab. In den Gaskammern der Krematorien IV und V, wo es keine Entlüftungsanlage gab, wurden einfach die Türen ins Freie geöffnet.
Die Leichen lagen auf großen Haufen, bis zu anderthalb Meter hoch oder höher. Nachdem sie fortgeschafft worden waren, wurde der Vorgang innerhalb von Stunden immer wieder aufs Neue wiederholt.
Ein kleines Mädchen schrieb auf dem Weg nach Auschwitz: „Wozu ist die Sonne gut in einer Welt ohne Tag? Wozu ist ein Gott gut, wenn es seine einzige Aufgabe ist zu strafen?“
Während dieses Morden im Gange war, blieb jenen Lagerinsassen, die bei der Ankunft an der Rampe nicht sofort ins Gas geschickt worden waren, nichts anderes, als auf ihren eigenen Tod zu warten, der in wenigen Monaten unweigerlich folgen würde. Laute Motoren liefen und Hupen schrillten, um die Schreie und die anderen Laute der Sterbenden zu übertönen, aber die übrigen Häftlinge wussten es besser.
Angehörige des sogenannten Sonderkommandos aus überwiegend jüdischen Lagerinsassen wurden dazu gezwungen, die Leichen aus der Gaskammer zu ziehen.35 Ihre Tätigkeit war qualvoll und anstrengend. Meist waren die Körper so „ineinander verkrampft“, dass sie nur schwer zu entwirren waren. Nachdem sie diese auseinandergerissen hatten, mussten die Häftlinge des Sonderkommandos den Toten systematisch die Goldzähne aus dem Zahnfleisch brechen, ihnen Eheringe von den Fingern ziehen und, indem sie über die Leichenberge stiegen, jene trennen, die sich im Tod an ihre Liebsten geklammert hatten. Man befahl ihnen sogar, die After und Vaginen der Leichen aufzureißen, um nach verstecktem Schmuck zu suchen. Stumm und mit benommenen Mienen schnitten sie das wallende Haar der toten Frauen ab und sortierten es zunächst zu gewaltigen Haufen, bevor sie es in große Säcke stopften. Schwitzend und betäubt vor Entsetzen schafften die Trupps die Leichen per Lastenaufzug oder auf Loren, bis zu zehn frisch ermordete Menschen auf einmal, in den Verbrennungsraum, wo andere Häftlinge sie auf eiserne Pritschen legten, die mittels Rollwägen vor die Ofenöffnungen geschoben und anschließend mithilfe eines Schiebers in den Ofen befördert wurden.36 Weil die Öfen pausenlos in Betrieb waren, überhitzten sich die Krematorien wiederholt und fielen aus, sodass andauernd Spezialisten aus Berlin geholt wurden, um die Anlagen zu reparieren. Wenn die Krematorien vorübergehend außer Betrieb waren, wurden die Leichen stattdessen in Massengräbern oder Einäscherungsgräben verbrannt. Selbst die Nationalsozialisten empfanden das als ein mühsames, kompliziertes Verfahren.
Unter Aufsicht der SS-Wachen mussten die Häftlinge des Sonderkommandos immer wieder große Feuer schüren. Mit schweren Stahlhaken bewegten sie die brennenden Körper. Wenn die Flammen die Leichname erfassten, entstand der süßliche Geruch von brennendem Fleisch – ein Lagerarzt beschrieb ihn einmal euphemistisch als „unangenehmen Rauchgeruch“ –, und der Rauch waberte langsam ins Lager und setzte sich über der Stadt Auschwitz selbst ab.
Schauderhafterweise wurden die Toten, wenn sie zu Asche verbrannt waren, niemals begraben, sondern stattdessen weiterverwertet. Die feinen, grauen Überreste wurden nicht nur verwendet, um die Felder der zum Lager gehörenden Gehöfte zu düngen, sondern auch als Füllmaterial für neue Straßen und Gehwege und sogar zur Wärmedämmung der SS-Unterkünfte gegen die eisige polnische Kälte. Alle unverbrannten Knochen, meist die Beckenknochen, wurden zu Pulver zerstampft, während das haufenweise gesammelte Menschenhaar auf den Dächern des Krematoriums getrocknet wurde.
Keine Kleinigkeit war dabei zu gering für das Deutsche Reich: In Auschwitz übersahen die Deutschen anscheinend nichts und zogen so ungeheuren Profit aus den Toten. Die Haufen übriggebliebener Brillen – ganz gleich ob die Gläser gesprungen oder unversehrt, ob die Gestelle verbogen oder zerbrochen waren – wurden dem Staat übergeben. Die Haufen Menschenhaar, ob grob oder fein, hell oder dunkel, wurden verwendet, um Matratzen zu stopfen, wurden zu Garn gesponnen oder zu Seilen gedreht. Auch zu Filz für die Kriegsindustrie wurde das Haar verarbeitet. Kunden zahlten hübsche Summen für diese menschlichen Produkte: Die Bremer Woll-Kämmerei bot 50 Pfennig pro Kilo; die Filzfabrik Alex Zink in der Nähe von Nürnberg war ein weiterer Abnehmer. Und Düngemittelfirmen bezogen säckeweise Knochenmehl von der SS.
Dann war da noch das Gepäck der Toten, das akribisch eingesammelt und sortiert wurde. Auch hier wurde keine Beutequelle übersehen. Da waren Massen an Lebensmitteln und Jacken, Hemden, Socken, Seidenstoffe, Nerze, Mäntel, schwarze Gehröcke, goldbestickte Blusen, alle möglichen Pelze, Gürtel und Unterwäsche; da waren Arzneifläschchen und Hunderttausende Tabletten; und da waren die Karrenladungen Hausrat und kistenweise Stühle, Tische und Teppiche. Dazu kamen Bündel Bargeld in verschiedenen Währungen – Lire, Francs, englische Pfund und Schwarzmarktdollar –, ganz zu schweigen von allerlei Uhren, glitzernden Juwelen und anderem schönen Schmuck bis hin zu Parfümflakons von Chanel, Kölnischwasser und zart duftenden Seifen. Und das war längst nicht alles. Allein die Menge an Schuhen war atemberaubend: Arbeitsschuhe, Straßenschuhe, Soldatenstiefel, alte Schuhe, neue Schuhe, Leder- und Gummistiefel, Gamaschen und Hausschuhe, Schuhe mit durchgelaufenen Sohlen, Schuhe aus glänzendem neuen Leder. Sie waren schwarz und grau und rot, sogar weiß. Da waren Schuhe mit hohen und solche mit flachen Absätzen und Sandaletten. Da waren edle Slipper und holländische Holzpantinen, Pumps, Strandsandalen und hochgeschnürte Damenstiefeletten. Da waren die winzigen Schnallenschuhe so vieler kleiner Kinder, die ihren Müttern entrissen worden waren. Diese persönliche Habe wurde in 30 abgesonderten, von Stacheldraht umgebenen Baracken gehortet. Dieses Magazingelände wurde „Kanada“ genannt, hielten die Lagerinsassen, die sich den Namen ausdachten, Kanada doch für ein sagenhaft reiches Land.
Die Habe der Toten wurde Staatseigentum und das deutsche Volk ihr Empfänger. Die Schätze waren gewaltig: Jeden Monat wurden mehr als zehn Tonnen Schmuck, zu Barren eingeschmolzenes Gold und haufenweise Devisen in schwere, verplombte Kisten geladen und nach Berlin versandt. Deutsche Piloten und U-Boot-Besatzungen wurden mit den Armbanduhren der Toten bedacht, desgleichen Berliner, deren Wohnungen und Häuser durch die alliierten Luftangriffe in Schutt und Asche gelegt worden waren. Volksdeutsche Umsiedler erhielten Unmengen an Hausrat, französischem Parfüm, Toilettenseifen und Textilien; Knirpse in Berlin erhielten das gesammelte Kinderspielzeug. Die berüchtigte Reichsbank bekam kostbare Edelmetalle, die ehrgeizige Reichsjugendführung Geld, der unersättliche deutsche I.G.-Farben-Konzern Gold und Silber. Die Soldaten an der Ostfront erhielten umgearbeitete Pelzmäntel, während Hunderttausende von Herrenhemden und Damenblusen an Städte und Gemeinden innerhalb Deutschlands geschickt wurden. Und was passierte mit so seltenen Luxusartikeln wie Diamanten und juwelenbesetzten Armbändern? Die steckte die SS kurzerhand selbst ein. Sogar die Zivilisten der Stadt Auschwitz wollten von den Magazinbeständen profitieren: Sie fragten bei der Lagerverwaltung an, ob die Besitztümer der Toten möglicherweise verbilligt zum Verkauf stünden oder, noch besser, verschenkt würden.
Es hatte einmal eine Zeit gegeben, da waren die Deutschen die Zierde eines großen Zeitalters gewesen. Sie hatten in Kunst und Wissenschaft den Ton angegeben und die schöne Literatur geliebt. Sie hatten die schönste Dichtkunst, die großartigste Musik und die beste Philosophie gefördert. Aber nun, während der D-Day näherrückte, waren sie vor allem Spezialisten in einer Disziplin: der Wissenschaft des Mordens.