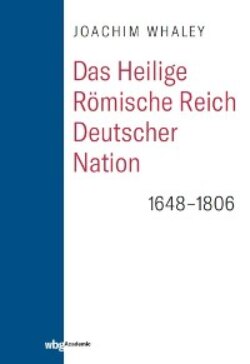Читать книгу Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien - Joachim Whaley - Страница 45
20. Schwindende Kaisermacht? (1733–1740)
ОглавлениеDie Garantie des Reichs für die Pragmatische Sanktion markierte den Höhepunkt der kaiserlichen Macht Karls VI. In den folgenden Jahren wurde über weitere Garantien verhandelt. 1733 sagte Friedrich August von Sachsen seine Unterstützung zu, wofür ihm der Kaiser Rückendeckung für seinen eigenen Wunsch versprach, seinem am 1. Februar verstorbenen Vater auf den Königsthron von Polen nachzufolgen. 1738 schloss sich auch Frankreich an. Nur Bayern und die Pfalz blieben ausweichend. Ende 1732 brach die Korrespondenz mit Karl Philipp in Mannheim ab. Karl Albrecht von Bayern versuchte Wien 1734 mit dem Vorschlag zu locken, die siebzehnjährige Maria Theresia solle seinen achtjährigen Sohn Maximilian heiraten. Selbst unter den oft ungewöhnlichen Umständen dynastischer Heiraten war dieses Angebot bizarr und trug nichts dazu bei, den Eindruck zu vertreiben, Bayern sei grundsätzlich nicht vertrauenswürdig.1
1732 war die Pragmatische Sanktion durch Garantien so gut abgesichert, dass die wankelmütigen Wittelsbacher kaum noch eine Rolle spielten. Wichtig war nur die Zustimmung Frankreichs. Dass sie als Teil des Wiener Friedens nach dem polnischen Erbfolgekrieg erreicht werden konnte, unterstreicht deutlich die grundsätzlichen Fehler der Politik, die Österreich mehr als ein Jahrzehnt lang so vehement betrieben hatte. Die Entwicklungen nach 1733 zeigten auch, dass Prinz Eugen mit seiner Ansicht, üppige Geldmittel und eine gute Armee seien mehr wert als Versprechen auf Papier, nicht falsch gelegen hatte. So wichtig die Garantien auch waren, letztlich waren sie ohne das zu ihrer Sicherung notwendige Kapital wenig wert.
Die neue Machtposition des Kaisers war nicht von Dauer. Der Wiener Vertrag von 1731 zwischen Österreich und Großbritannien markierte zwar die Rückkehr zum »alten System« einer Allianz zwischen Österreich und den Seemächten, brachte aber keine Stabilität. Frankreich, das durch den Vertrag isoliert worden war, verfolgte den Fortgang der Heiratspläne zwischen Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen, der 1729 Herzog wurde, zunehmend beunruhigt.2 Damit hätte sich die französische Hoffnung auf dauerhafte Übernahme dieser Gebiete zerschlagen. Lothringen war praktisch eine Enklave auf französischem Gebiet und seine Vereinigung mit Österreich hätte eine starke habsburgische Präsenz an der Westgrenze des Reichs geschaffen, die Frankreich bedrohte. Im Lauf des Jahres 1731 kam der französische Premierminister Kardinal Fleury zu der Überzeugung, dass die Gefahr nur durch einen Krieg gegen Österreich abzuwenden war. Bis 1732 wurde die Strategie entworfen, Spaniens Begehren nach Neapel und Sizilien zu unterstützen, in der Hoffnung, Lothringen werde im Rahmen einer umfassenden territorialen Neuordnung an Frankreich fallen. Den Vorwand für einen Konflikt lieferte die Krise in Polen nach dem Tod Augusts des Starken im Februar 1733.
In den 1720er Jahren bildeten Russland, Österreich und Polen eine Art Schutzgemeinschaft für das polnische Königreich, die im Dezember 1732 in der Entente cordiale der drei Schwarzen Adler gipfelte.3 Anfangs waren sie unwillig, den Königssohn Friedrich August zu unterstützen, Preußen wollte vor allem die Verbindung zwischen Sachsen und Polen kappen. Bald wurde indes klar, dass ihr bevorzugter Kandidat Prinz Emanuel von Portugal nicht wählbar war, und so wurde zu Preußens Verdruss doch der Sachse vorgeschlagen. Gleichzeitig warb Frankreich, das seit dem späten 16. Jahrhundert »freie« Wahlen in Polen befürwortete, für seinen eigenen Kandidaten Stanislaus Leszczyn ski, der von 1704 bis 1709 König gewesen und während seines anschließenden Exils in Frankreich der Schwiegervater Ludwigs XV. geworden war. Heimlich aus Frankreich angereist, lieferte Leszczyn ski am 8. September einen dramatischen Auftritt in Warschau, bei dem er nicht europäische Kleidung, sondern einen polnischen Kaftan trug. Eine Woche darauf wurde er von 13.000 versammelten Adligen zum König ausgerufen. Dies führte zum sofortigen Eingreifen russischer Streitkräfte, die eine zweite Wahl am 5. Oktober erzwangen, in der lediglich 1.000 polnische Adlige Friedrich August von Sachsen als August II. akklamierten. Der Krieg war schnell vorbei: Die russischen Truppen besetzten den größten Teil Polens im Namen von August, Frankreich entsandte eine Abteilung zur Verteidigung Danzigs, wo Stanislaus kurz als König regierte. Bald jedoch war er wieder im französischen Exil.
Frankreich machte wenig Anstalten, Polen zu halten, sondern konzentrierte sich auf den Rhein und Italien, die wahren Objekte seiner Interessen. Da es angekündigt hatte, keine Militäroperation in Polen zu dulden, erklärte es im Oktober dem Kaiser den Krieg, eroberte Lothringen und nahm die Festung Kehl am Rhein. Zugleich griffen französische, spanische und sardische Truppen Stellungen der Habsburger in Italien an. Wien wartete vergeblich auf die erhoffte britische und niederländische Hilfe – beide boten an, zu vermitteln, aber nicht zu kämpfen – und so mussten die Österreicher auf ihre beschränkten eigenen Mittel vertrauen. In Italien unterschätzten sie die Bedrohung total; ihre Verteidigung im Norden brach schnell zusammen und binnen Jahresfrist hatte Spanien Neapel und Sizilien erobert.
Die Abwehr im Westen war wirkungsvoller. Die Assoziation der Vorderen Kreise war im Herbst 1733 mobilisiert. Im April 1734 erklärte der Reichstag Frankreich den Krieg. Unter den bilateralen Abkommen zwischen Wien und den deutschen Höfen wurden etwa 50.000 Mann ausgehoben, weitere 35.000 bildeten die Reichsarmee der Kreise.4 Behindert wurden die Kriegsanstrengungen durch die Verweigerung der Unterstützung durch Bayern, die Pfalz und Köln. Prinz Eugens Bewegungen an der Rheinfront 1734 litten an der Furcht vor dem bayerischen Feind im Rücken, obwohl die bayerische Armee nicht in der Lage war, große Schwierigkeiten zu machen. Rein defensiv war die Verteidigung des Rheins im Ganzen erfolgreich. Die Franzosen durchbrachen die deutschen Linien nur einmal ernsthaft, und obwohl Frankreich Kehl und Philippsburg besetzt hielt, gelangen den deutschen Streitkräften einige beeindruckende Vorstöße. Da sich Frankreich zum Großteil auf Italien konzentrierte, war auch ihr Feldzug an der Reichsgrenze überwiegend defensiv.5
Das verspätete Eintreffen unter dem österreichisch-russischen Beistandspakt von 1726 widerwillig abgestellter russischer Truppen in Schwaben sorgte für die Entscheidung, aber Deutschland blieb ein Nebenschauplatz.6 Wichtiger war, dass im Herbst 1735 in Italien nur noch die Festung Mantua in österreichischer Hand blieb und die hoffnungslos unterlegene kaiserliche Armee nordwärts ins Trentino zurückweichen musste.7 Die russische Bedrohung Frankreichs und die französisch-spanisch-sardische Bedrohung der Habsburger zwang beide Seiten an den Verhandlungstisch.
Das Ergebnis war der Wiener Vorfrieden vom 3. Oktober 1735. Österreich trat Neapel, Sizilien und die strategisch wichtigen Häfen des toskanischen Stato dei Presidi an den spanischen Thronfolger Karl ab, die Lombardei fiel wieder an Wien, wobei zwei Provinzen – Novara und Tortona – an Sardinien gingen. Dazu erhielt Österreich Parma und Piacenza, das Erbfolgerecht in der Toskana wurde jedoch von Karl auf Franz Stephan von Lothringen übertragen. Er musste dafür sein Herzogtum (ohne das Stimmrecht im Reichstag) Stanislaus Leszczyn ski überlassen, der dazu Metz, Toul, Verdun und das Herzogtum Bar bekam. Nach seinem Tod sollten alle seine Ländereien an den französischen König fallen.8 Friedrich August wurde als polnischer König August II. bestätigt, Stanislaus durfte jedoch den Titel »König von Polen und Herzog von Litauen« behalten. Frankreich schließlich gab Kehl und Philippsburg an das Reich zurück und bestätigte die Pragmatische Sanktion.
Die schwersten Folgen hatte dieser Friede in Italien. Die Habsburger hatten es nicht geschafft, die Spanier aus dem Land fernzuhalten; ihre dramatischen Verluste wurden indes durch die Festigung der Herrschaft über Norditalien aufgewogen. Langfristig war ein habsburgischer Block von größerem Nutzen als ein Haufen verstreuter Territorien, getrennt durch den Kirchenstaat. Die Konsequenzen für das Reich waren weniger tiefgreifend. Lothringen war verloren, aber hier hatten seit 1648 sowieso meist die Franzosen geherrscht, und sein Verhältnis zum Reich war schon seit dem 15. Jahrhundert zwiespältig. Ob das Reich durch die offizielle Abtretung angreifbarer wurde, ist zweifelhaft. Sicherlich gab es nun keine Hoffnung auf eine wirksame linksrheinische militärische Barriere gegen Frankreich mehr. In dieser Hinsicht fühlten sich Angehörige der Vorderen Kreise, die immer noch an das Barrierensystem aus der Zeit vor 1715 glaubten, erneut verraten. Aber das von französischen Territorien förmlich umzingelte Lothringen war selbst höchst verwundbar. Die rechtsrheinischen deutschen Verteidigungslinien, in den letzten fünfzig Jahren unter immensen Kosten errichtet, erwiesen sich hingegen als weitgehend wirksam und hinderten Frankreich, so verheerende Schäden auf deutschem Gebiet anzurichten wie in allen vorangegangenen Kriegen.9
Zu einem Wiederaufleben der antifranzösischen Propaganda der Vergangenheit führte der Konflikt offenbar nicht. Frankreich dominierte die Friedensverhandlungen und die folgenden Jahre, hatte aber seine Ambitionen mit der Akquisition von Lothringen befriedigt, die die Basis für eine Phase der Normalität und Stabilität an der französisch-deutschen Grenze zu bilden schien.10
Die deutschen Protestanten allerdings waren irritiert, weil die Bedingung ihrer Teilnahme am Krieg gewesen war, dass der Kaiser das Problem der Rijswijker Klausel löse, und er das Thema nicht einmal angeschnitten hatte. Das war in den 1730er Jahren aber von kaum mehr als symbolischer Bedeutung; das angeblich unter ihrem Schutz begangene Unrecht lag Jahrzehnte zurück und ließ sich nicht mehr gutmachen. Dennoch schwelte das Problem weiter. 1738 protestierte das Corpus Evangelicorum gegen die endgültige Fassung des Friedensvertrags. Als er im März 1740 dem Reichstag vorgelegt wurde, weigerten sich die Protestanten, zu unterschreiben. Da Karl VI. am 20. Oktober 1740 starb, wurde das Abkommen nie ratifiziert.11
Verschlimmert wurden die Probleme des Kaisers durch eine Folge katastrophaler Ereignisse im Osten. Da die Russen Truppen nach Schwaben entsandt hatten, konnte er ihre Bitte um Beistand gegen den Sultan nicht abschlagen. Dieser hatte 1735 einen Invasionsversuch auf der Krim zurückgeschlagen und Russland im Mai 1736 den Krieg erklärt. Die habsburgischen finanziellen wie militärischen Mittel erwiesen sich jedoch als deutlich zu gering. Der Reichstag gewährte Beihilfe in Höhe von 50 Römermonaten (etwa 3 Millionen Gulden); bilaterale Abkommen verstärkten die Streitkräfte und die kaiserliche Regierung nutzte ihr Recht, im ganzen Reich Soldaten zu rekrutieren. So kam eine Streitmacht von etwa 30 Prozent der in Ungarn stationierten Truppen zusammen.12 Letztlich jedoch war der Kaiser nicht in der Lage, die politischen und finanziellen Schulden, die er sich dadurch auflud, zu begleichen.
Das Reich trug wesentlich zum Türkenkrieg von 1736–1739 bei, aber der Konflikt entfachte nicht die patriotische Begeisterung zurückliegender Feldzüge.13 Wie viel von dem Geld, das der Reichstag zugesagt hatte, tatsächlich bezahlt wurde, ist nicht bekannt, aber selbst einige loyale Fürstbischöfe der Schönborn-Dynastie hielten diesen Krieg für eine rein habsburgische Angelegenheit, die nichts mit dem Reich zu tun hatte. Meldungen von österreichischen Niederlagen verstärkten die verhaltene Einstellung der deutschen Fürsten: Glorreiche Siege waren diesmal nicht zu feiern.14 Als der Trierer Kurfürst Franz Georg von Schönborn von der Panik der Wiener Bevölkerung vor einem neuen türkischen Angriff erfuhr, fiel ihm dazu nur ein, das geschehe dem Kaiser recht, nachdem er das Reich im Polnischen Erbfolgekrieg im Stich gelassen habe.15
Was war schiefgelaufen? Prinz Eugen, der wichtigste österreichische Militärkommandeur, war 1736 gestorben und es fand sich kein angemessener Nachfolger. Vor allem aber waren den Österreichern die türkischen Militär- und Verwaltungsreformen seit 1718 verborgen geblieben.16 Ihre eigenen finanziellen und militärischen Mittel hatten sich verschlechtert, die des Sultans verbessert. 1738 war Österreich bereit, französische Vermittlung zu akzeptieren, und schloss im Jahr darauf einen Separatfrieden mit den Türken, der deren Eroberungen in Nordserbien und der Kleinen Wallachei bestätigte. Die Serie von taktischen Fehlern der Militärführung verschlimmerte der österreichische Chefunterhändler Graf Neipperg, indem er es fertigbrachte, Österreich zu verpflichten, die praktisch unbezwingbaren Festungen von Belgrad und abac zu schleifen, für deren Erhalt er um jeden Preis sorgen sollte. Ein Großteil der Gewinne von 1718 war damit verloren.
In Wien lastete man die Niederlage den Generalen an und – eher zu Recht – Neipperg den Verlust von Belgrad. Dass die Kommandeure verhaftet und vor Gericht gestellt wurden, konnte jedoch nicht über die tieferen Probleme der Habsburger und ihrer übergroßen, aber unterversorgten Gebiete hinwegtäuschen. Selbst Prinz Eugen wäre es Ende der 1730er Jahre schwergefallen, das Blatt der unausweichlichen Niederlage zu wenden.
Die Folge von Rückschlägen seit 1733 trübte das Ansehen Karls VI. und ließ seine Autorität bröckeln. Die traditionelle Sichtweise, nur die Habsburger könnten das Reich gegen seine Feinde verteidigen, war untergraben. Der Niedergang der Reichskanzlei nach dem Rücktritt Friedrich Karl von Schönborns 1734 trug dazu bei. Schlimmer noch war jedoch der Zynismus, mit dem Wien Abkommen traf und Versprechungen machte, um sie gleich darauf zu widerrufen. Die Pfalz und Brandenburg-Preußen erhielten bezüglich der Erbfolge in Jülich-Berg so viele widersprüchliche Zusicherungen, dass der Kaiser 1739 einen Geheimvertrag mit Frankreich einging, in dem beide Parteien vereinbarten, Pfalz-Sulzbach solle für zwei Jahre die Besitzrechte erhalten, während der Reichshofrat die Rechtslage klärte.17 Es ist typisch für die Treibsanddiplomatie jener Jahre, die mit Finten, doppeltem Spiel, Zusicherung und Rückversicherung die gesamte europäische Politik prägte, dass Fleury umgehend einen weiteren Geheimvertrag mit Brandenburg abschloss, in dem er ihm Berg und ein kleines Stück Land (»une lisière«) am Rhein garantierte.
War Karl VI. am Ende? Hätte die Kontinuität der habsburgischen Thronfolge im Reich bewahrt werden können, wenn er zehn Jahre länger gelebt hätte? Sein plötzlicher Tod im Alter von fünfundfünfzig Jahren am 20. Oktober 1740 und das militärische Desaster, das dem preußischen Angriff auf Schlesien am 16. Dezember folgte, waren klare Vorboten einer tiefen Krise der Dynastie und hatten umfassende Folgen für Deutschland.
Aber dies war auf keinen Fall der Anfang vom Ende des Reichs. Ein längeres Leben und ein männlicher Nachkomme hätten dem Gewicht der habsburgischen Tradition im Reich weiterhin die gewohnte Geltung verschafft. Tatsächlich kam es 1745 mit der Wahl von Karls Schwiegersohn und Maria Theresias Gatten Franz Stephan von Lothringen zum Kaiser Franz I. genau so. Einstweilen jedoch führte die Entschlossenheit der Kritiker Österreichs, die Pragmatische Sanktion infrage zu stellen, zu einer kurzen Phase nichthabsburgischer Herrschaft, die das Reich, das Franz Stephan regieren sollte, grundlegend veränderte. Nicht wenige sahen in der Thronfolgekrise von 1740 die Chance zu Reform und Erneuerung.